2.10 Meesia Longiseta HEDW. Code: 1389 Anhang: II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PDF, Also Known As Version of Record License (If Available): CC by Link to Published Version (If Available): 10.1111/Nph.14553
Coudert, Y., Bell, N., Edelin, C., & Harrison, C. J. (2017). Multiple innovations underpinned branching form diversification in mosses. New Phytologist, 215(2), 840-850. https://doi.org/10.1111/nph.14553 Publisher's PDF, also known as Version of record License (if available): CC BY Link to published version (if available): 10.1111/nph.14553 Link to publication record in Explore Bristol Research PDF-document This is the final published version of the article (version of record). It first appeared online via Wiley at http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.14553/full. Please refer to any applicable terms of use of the publisher. University of Bristol - Explore Bristol Research General rights This document is made available in accordance with publisher policies. Please cite only the published version using the reference above. Full terms of use are available: http://www.bristol.ac.uk/red/research-policy/pure/user-guides/ebr-terms/ Research Multiple innovations underpinned branching form diversification in mosses Yoan Coudert1,2,3, Neil E. Bell4, Claude Edelin5 and C. Jill Harrison1,3 1School of Biological Sciences, University of Bristol, Life Sciences Building, 24 Tyndall Avenue, Bristol, BS8 1TQ, UK; 2Institute of Systematics, Evolution and Biodiversity, CNRS, Natural History Museum Paris, UPMC Sorbonne University, EPHE, 57 rue Cuvier, 75005 Paris, France; 3Department of Plant Sciences, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, CB2 3EA, UK; 4Royal Botanic Garden Edinburgh, 20a Inverleith Row, Edinburgh, EH3 5LR, UK; 5UMR 3330, UMIFRE 21, French Institute of Pondicherry, CNRS, 11 Saint Louis Street, Pondicherry 605001, India Summary Author for correspondence: Broad-scale evolutionary comparisons have shown that branching forms arose by con- C. -

Moss Occurrences in Yugyd Va National Park, Subpolar and Northern Urals, European North-East Russia
Biodiversity Data Journal 7: e32307 doi: 10.3897/BDJ.7.e32307 Data Paper Moss occurrences in Yugyd Va National Park, Subpolar and Northern Urals, European North-East Russia Galina Zheleznova‡, Tatyana Shubina‡, Svetlana Degteva‡‡, Ivan Chadin , Mikhail Rubtsov‡ ‡ Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Russia Corresponding author: Tatyana Shubina ([email protected]) Academic editor: Yasen Mutafchiev Received: 10 Dec 2018 | Accepted: 25 Mar 2019 | Published: 01 Apr 2019 Citation: Zheleznova G, Shubina T, Degteva S, Chadin I, Rubtsov M (2019) Moss occurrences in Yugyd Va National Park, Subpolar and Northern Urals, European North-East Russia. Biodiversity Data Journal 7: e32307. https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e32307 Abstract Background This study produced a dataset containing information on moss occurrences in the territory of Yugyd Va National Park, located in the Subpolar and Northern Urals, European North- East Russia. The dataset summarises occurrences noted by long-term bryological explorations in remote areas of the Subpolar and Northern Urals from 1943 to 2015 and from studies published since 1915. The dataset consists of 4,120 occurrence records. The occurrence data were extracted from herbarium specimen labels (3,833 records) and data from published literature (287 records). Most of the records (4,104) are georeferenced. A total of 302 moss taxa belonging to 112 genera and 36 families are reported herein to occur in Yugyd Va National Park. The diversity of bryophytes in this National Park has not yet been fully explored and further exploration will lead to more taxa. -

Mosses of Qinghai-Tibetan Plateau, China
J. Hattori Bot. Lab. No. 82: 305- 320 (July 1997) MOSSES OF QINGHAI-TIBETAN PLATEAU, CHINA 1 2 BENITO C. TAN AND JIA Yu ABSTRACT . A total of 57 genera and 109 species of mosses are reported based on collections made from the 1995 expedition to Yushu Prefecture of Qinghai province. Didymodon gaochienii and Or thomitrium schofieldii are described new to science. Encalypta intermedia, Hygrohypnum po/are and Leptopterygynandrum austro-alpinum are three moss records that have not previously been reported from China. Significant range extensions . are reported for Amblyodon dealbatum, Conardia compacta, Distichium hagenii, Grimmia anodon, Leptopterygynandrum subintegrum, Oedipodium gri.ffithianum, Orthotrichum pumilum, Philonotis calcarea, Plagiobryum demissum and Pylaisiella falcata . In addition, four new synonyms are proposed with their respective accepted names placed in side brackets: Aloina rubripila Aziz & Vohra [ =Aloina rigida var. obliquifolia (C. Muell.) Delgad.], Barbu/a anserino-capitata X.-J. Li [=Didymodonjohansenii (Williams) Zand.], Barbu/a longicosta ta X-J. Li [=Didymodon constrictus var. jlexicaulis (Chen) Saito] and Tortu/a longimucronata X.-J. Li [=Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. & Mohr]. INTRODUCTION The province of Qinghai, with an area of about 720,000 sq. km, is the fourth largest province in China. It consitutes the eastern flank of the massive Tibetan plateau. The nu merous mountain glaciers in the province form the headwater of many great river systems in China and Indochina, such as Yellow River, Yangtze River and Mekong River. Because of its great distance from the ocean, the prevailing climate is strongly continental with in tense diurnal changes of daily temperature and a long winter season. -

Action C.5 Milestone: Bryophyte Ex Situ Conservation Scheme Feb 2017
ESCAPE – UNIVERSITY OF HELSINKI Action C.5 Milestone Bryophyte ex situ conservation scheme Sanna Laaka-Lindberg & Xiaolan He 2/28/2017 Monitoring Meesia longiseta reintroduction site in 2016. Photo: Sanna Laaka-Lindberg An ex situ conservation scheme is presented on the basis of compiled results of the ESCAPE project as a model for bryophyte conservation. ESCAPE LIFE+2011 BIO/FI/917 Action C.5 Milestone Bryophyte ex situ conservation scheme Introduction Ex situ conservation is a species conservation method used as a compliment to the primary conservation tool in situ conservation, a process of protecting an endangered species in its natural habitat. Ex situ conservation is targeted to species in most serious threat, especially when the conservation measures in nature are not adequate for species survival. There are basically two different types of ex situ conservation tools: 1) tools aimed at storing and securing the species and its genetic variation e.g. on national or even on wider (global) level, and 2) tools aimed at increasing species survival ability in nature. The ultimate goal of ex situ conservation is to provide support for the survival of species in their natural environments. Conservation of biodiversity is a continuous and long-term assignment, so the decisions on ex situ conservation to a species need to be made on a solid basis. This involves thorough investigation on conservation priorities, background knowledge of the biology and ecology of the species to be conserved, and the feasibility of the conservation plan. In the ESCAPE project, a priority list was compiled for vascular plants (see Ryttäri 2013), but no such list is made for bryophytes. -

CBD First National Report
FIRST NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF SERBIA TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY July 2010 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS .................................................................................... 3 1. EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................... 4 2. INTRODUCTION ....................................................................................................... 5 2.1 Geographic Profile .......................................................................................... 5 2.2 Climate Profile ...................................................................................................... 5 2.3 Population Profile ................................................................................................. 7 2.4 Economic Profile .................................................................................................. 7 3 THE BIODIVERSITY OF SERBIA .............................................................................. 8 3.1 Overview......................................................................................................... 8 3.2 Ecosystem and Habitat Diversity .................................................................... 8 3.3 Species Diversity ............................................................................................ 9 3.4 Genetic Diversity ............................................................................................. 9 3.5 Protected Areas .............................................................................................10 -
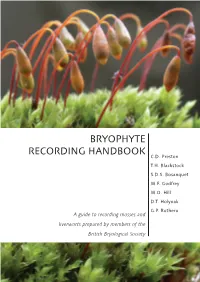
Bryophyte Recording Handbook C.D
Chapter BRYOPHYTE RECORDING HANDBOOK C.D. Preston T.H. Blackstock S.D.S. Bosanquet M.F. Godfrey M.O. Hill D.T. Holyoak G.P. Rothero A guide to recording mosses and liverworts prepared by members of the British Bryological Society i FOREWORD It is my pleasure as Recording Secretary of the British Bryological Society to commend to you this Handbook, setting out our procedures and recommendations for the future. All the authors of the Handbook are seasoned recorders. The Handbook distils our experience. In 1964, I recorded bryophytes on Harold Whitehouse’s Cambridge excursions. In 2012, I continue to record the bryophytes of Cambridgeshire with great enjoyment. The changes over 47 years are remarkable. Back in the 1960s Plagiochila asplenioides and Rhytidiadelphus triquetrus were common and locally abundant in the boulder-clay woods. Now they are scarce and seen only in small quantity. In those days, pollution-sensitive epiphytes such as Cryphaea heteromalla, Orthotrichum lyellii and O. pulchellum were absent or very rare. Now we see them on most excursions. Sometimes the causes of change are obvious: atmospheric sulfur has decreased dramatically, so the epiphytes have returned. But without good recording both here and in the rest of Europe, we cannot see clearly what is happening or understand Published 2012 by the British Bryological Society its wider significance. Orthotrichum pulchellum, for example, has extended its range www.britishbryologicalsociety.org.uk as well as its frequency. It used to be an ‘Atlantic’ species. Now it is widespread in central Europe. Likewise, Didymodon nicholsonii, long misunderstood on the All rights reserved. -

Kenai National Wildlife Refuge Species List, Version 2018-07-24
Kenai National Wildlife Refuge Species List, version 2018-07-24 Kenai National Wildlife Refuge biology staff July 24, 2018 2 Cover image: map of 16,213 georeferenced occurrence records included in the checklist. Contents Contents 3 Introduction 5 Purpose............................................................ 5 About the list......................................................... 5 Acknowledgments....................................................... 5 Native species 7 Vertebrates .......................................................... 7 Invertebrates ......................................................... 55 Vascular Plants........................................................ 91 Bryophytes ..........................................................164 Other Plants .........................................................171 Chromista...........................................................171 Fungi .............................................................173 Protozoans ..........................................................186 Non-native species 187 Vertebrates ..........................................................187 Invertebrates .........................................................187 Vascular Plants........................................................190 Extirpated species 207 Vertebrates ..........................................................207 Vascular Plants........................................................207 Change log 211 References 213 Index 215 3 Introduction Purpose to avoid implying -
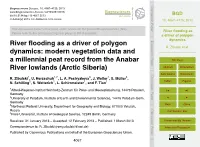
River Flooding As a Driver of Polygon Dynamics
EGU Journal Logos (RGB) Open Access Open Access Open Access Advances in Annales Nonlinear Processes Geosciences Geophysicae in Geophysics Open Access Open Access Natural Hazards Natural Hazards and Earth System and Earth System Sciences Sciences Discussions Open Access Open Access Atmospheric Atmospheric Chemistry Chemistry and Physics and Physics Discussions Open Access Open Access Atmospheric Atmospheric Measurement Measurement Techniques Techniques Discussions Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Open Access Biogeosciences Discuss., 10, 4067–4125, 2013 Open Access www.biogeosciences-discuss.net/10/4067/2013/ Biogeosciences Biogeosciences BGD doi:10.5194/bgd-10-4067-2013 Discussions © Author(s) 2013. CC Attribution 3.0 License. 10, 4067–4125, 2013 Open Access Open Access This discussion paper is/has been under review for the journal BiogeosciencesClimate (BG). Climate River flooding as Please refer to the correspondingof finalthe Past paper in BG if available. of the Past Discussions a driver of polygon dynamics Open Access River flooding as a driver of polygon Open Access Earth System Earth System R. Zibulski et al. dynamics: modernDynamics vegetation dataDynamics and Discussions Title Page Open Access a millennial peat record from the AnabarOpen Access Geoscientific Geoscientific River lowlandsInstrumentation (Arctic Siberia)Instrumentation Abstract Introduction Methods and Methods and Data Systems Data Systems Conclusions References 1 1,2 3 1 4 R. Zibulski , U. Herzschuh , L. A. Pestryakova , J. -

4.4 Biological Resources
4.4 BIOLOGICAL RESOURCES INTRODUCTION This section describes the existing biological resources that occur or have the potential to occur within the Project Area and vicinity. In addition, a description of applicable regulations is provided. The analysis evaluates the potential impacts to biological resources that could occur in association with the development of property in the commercial districts and the implementation of the Mobility Element. The Land Use Element/Zoning Code Amendments would modify the development regulations and no specific projects are proposed at this time. Likewise, the roadway and trail alignments are conceptual in nature. Therefore, the analysis is evaluated at a program‐level. With a programmatic study, such as this EIR, subsequent projects carried out under the proposed Land Use Element/ Zoning Code Amendments and Mobility Element Update may warrant site specific biological assessments and surveys once plans have been prepared. 1. ENVIRONMENTAL SETTING a. Regulatory Framework As part of the proposed Project’s review and approval there are a number of performance criteria and standard conditions that must be met. These include compliance with all of the terms, provisions, and requirements of applicable laws that relate to Federal, State, and local regulating agencies for impacts to biological resources. The following provides an overview of the applicable regulations with regard to the biological resources that may be present within the Project Area. (1) Federal (a) Migratory Bird Treaty Act The Migratory Bird Treaty Act (MBTA) protects individuals as well as any part, nest, or eggs of any bird listed as migratory. In practice, Federal permits issued for activities that potentially impact migratory birds typically have conditions that require pre‐disturbance surveys for nesting birds. -

Mosses: Weber and Wittmann, Electronic Version 11-Mar-00
Catalog of the Colorado Flora: a Biodiversity Baseline Mosses: Weber and Wittmann, electronic version 11-Mar-00 Amblystegiaceae Amblystegium Bruch & Schimper, 1853 Amblystegium serpens (Hedwig) Bruch & Schimper var. juratzkanum (Schimper) Rau & Hervey WEBER73B. Amblystegium juratzkanum Schimper. Calliergon (Sullivant) Kindberg, 1894 Calliergon cordifolium (Hedwig) Kindberg WEBER73B; HERMA76. Calliergon giganteum (Schimper) Kindberg Larimer Co.: Pingree Park, 2960 msm, 25 Sept. 1980, [Rolston 80114), !Hermann. Calliergon megalophyllum Mikutowicz COLO specimen so reported is C. richardsonii, fide Crum. Calliergon richardsonii (Mitten) Kindberg WEBER73B. Campyliadelphus (Lindberg) Chopra, 1975 KANDA75 Campyliadelphus chrysophyllus (Bridel) Kanda HEDEN97. Campylium chrysophyllum (Bridel) J. Lange. WEBER63; WEBER73B; HEDEN97. Hypnum chrysophyllum Bridel. HEDEN97. Campyliadelphus stellatus (Hedwig) Kanda KANDA75. Campylium stellatum (Hedwig) C. Jensen. WEBER73B. Hypnum stellatum Hedwig. HEDEN97. Campylophyllum Fleischer, 1914 HEDEN97 Campylophyllum halleri (Hedwig) Fleischer HEDEN97. Nova Guinea 12, Bot. 2:123.1914. Campylium halleri (Hedwig) Lindberg. WEBER73B; HERMA76. Hypnum halleri Hedwig. HEDEN97. Campylophyllum hispidulum (Bridel) Hedenäs HEDEN97. Campylium hispidulum (Bridel) Mitten. WEBER63,73B; HEDEN97. Hypnum hispidulum Bridel. HEDEN97. Cratoneuron (Sullivant) Spruce, 1867 OCHYR89 Cratoneuron filicinum (Hedwig) Spruce WEBER73B. Drepanocladus (C. Müller) Roth, 1899 HEDEN97 Nomen conserv. Drepanocladus aduncus (Hedwig) Warnstorf WEBER73B. -
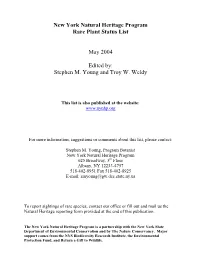
New York Natural Heritage Program Rare Plant Status List May 2004 Edited By
New York Natural Heritage Program Rare Plant Status List May 2004 Edited by: Stephen M. Young and Troy W. Weldy This list is also published at the website: www.nynhp.org For more information, suggestions or comments about this list, please contact: Stephen M. Young, Program Botanist New York Natural Heritage Program 625 Broadway, 5th Floor Albany, NY 12233-4757 518-402-8951 Fax 518-402-8925 E-mail: [email protected] To report sightings of rare species, contact our office or fill out and mail us the Natural Heritage reporting form provided at the end of this publication. The New York Natural Heritage Program is a partnership with the New York State Department of Environmental Conservation and by The Nature Conservancy. Major support comes from the NYS Biodiversity Research Institute, the Environmental Protection Fund, and Return a Gift to Wildlife. TABLE OF CONTENTS Introduction.......................................................................................................................................... Page ii Why is the list published? What does the list contain? How is the information compiled? How does the list change? Why are plants rare? Why protect rare plants? Explanation of categories.................................................................................................................... Page iv Explanation of Heritage ranks and codes............................................................................................ Page iv Global rank State rank Taxon rank Double ranks Explanation of plant -

(Bryopsida: Splachnaceae). Lily Roberta Lewis University of Connecticut, [email protected]
University of Connecticut OpenCommons@UConn Doctoral Dissertations University of Connecticut Graduate School 5-7-2015 Resolving Amphitropical Phylogeographic Histories in the Common Dung Moss Tetraplodon (Bryopsida: Splachnaceae). Lily Roberta Lewis University of Connecticut, [email protected] Follow this and additional works at: https://opencommons.uconn.edu/dissertations Recommended Citation Lewis, Lily Roberta, "Resolving Amphitropical Phylogeographic Histories in the Common Dung Moss Tetraplodon (Bryopsida: Splachnaceae)." (2015). Doctoral Dissertations. 747. https://opencommons.uconn.edu/dissertations/747 Resolving Amphitropical Phylogeographic Histories in the Common Dung Moss Tetraplodon (Bryopsida: Splachnaceae). Lily Roberta Lewis, PhD University of Connecticut, 2015 Many plants have geographic disjunctions, with one of the more rare, yet extreme being the amphitropical, or bipolar disjunction. Bryophytes (namely mosses and liverworts) exhibit this pattern more frequently relative to other groups of plants and typically at or below the level of species. The processes that have shaped the amphitropical disjunction have been infrequently investigated, with notably a near absence of studies focusing on mosses. This dissertation explores the amphitropical disjunction in the dung moss Tetraplodon, with a special emphasis on the origin of the southernmost South American endemic T. fuegianus. Chapter 1 delimits three major lineages within Tetraplodon with distinct yet overlapping geographic ranges, including an amphitropical lineage containing the southernmost South American endemic T. fuegianus. Based on molecular divergence date estimation and phylogenetic topology, the American amphitropical disjunction is traced to a single direct long-distance dispersal event across the tropics. Chapter 2 provides the first evidence supporting the role of migratory shore birds in dispersing bryophytes, as well as other plant, fungal, and algal diaspores across the tropics.