Prediger Und Bürger Reformation Im Städtischen Alltag 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
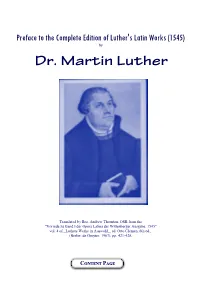
Preface to the Complete Edition of Luther's Latin Works (1545) by Dr
Preface to the Complete Edition of Luther's Latin Works (1545) by Dr. Martin Luther Translated by Bro. Andrew Thornton, OSB from the "Vorrede zu Band I der Opera Latina der Wittenberger Ausgabe. 1545" vol. 4 of _Luthers Werke in Auswahl_, ed. Otto Clemen, 6th ed., (Berlin: de Gruyter. 1967). pp. 421-428. C������ P��� Translator's Note: The material between square brackets is explanatory in nature and is not part of Luther's preface. The terms "just, justice, justify" in the following reading are synonymous with the terms "righteous, righteousness, make righteous." Both sets of English words are common translations of the Latin "justus" and related words. A similar situation exists with the word "faith"; it is synonymous with "belief." Both words can be used to translate Latin "fides." Thus, "We are justified by faith" translates the same original Latin sentence as does "We are made righteous by belief." Dear Reader, I have steadfastly resisted those who wanted my books published, or perhaps I had better call them the confused products of my nighttime study. First, I did not want the labors of the ancient authors to be buried under my new works and the reader to be hindered from reading them. Second, there now exists, thanks to the grace of God, a good number of systematically arranged books, especially the "Loci communes" of Philip, [Philip Melanchthon, scholar of Greek and associate of Luther at Wittenberg.] from which a theologian or bishop can get a thorough foundation [cf Titus 1:9], so that he might be strong in preaching the doctrine of virtue. -

Chronology of the Reformation 1320: John Wycliffe Is Born in Yorkshire
Chronology of the Reformation 1320: John Wycliffe is born in Yorkshire, England 1369?: Jan Hus, born in Husinec, Bohemia, early reformer and founder of Moravian Church 1384: John Wycliffe died in his parish, he and his followers made the first full English translation of the Bible 6 July 1415: Jan Hus arrested, imprisoned, tried and burned at the stake while attending the Council of Constance, followed one year later by his disciple Jerome. Both sang hymns as they died 11 November 1418: Martin V elected pope and Great Western Schism is ended 1444: Johannes Reuchlin is born, becomes the father of the study of Hebrew and Greek in Germany 21 September 1452: Girolamo Savonarola is born in Ferrara, Italy, is a Dominican friar at age 22 29 May 1453 Constantine is captured by Ottoman Turks, the end of the Byzantine Empire 1454?: Gütenberg Bible printed in Mainz, Germany by Johann Gütenberg 1463: Elector Fredrick III (the Wise) of Saxony is born (died in 1525) 1465 : Johannes Tetzel is born in Pirna, Saxony 1472: Lucas Cranach the Elder born in Kronach, later becomes court painter to Frederick the Wise 1480: Andreas Bodenstein (Karlstadt) is born, later to become a teacher at the University of Wittenberg where he became associated with Luther. Strong in his zeal, weak in judgment, he represented all the worst of the outer fringes of the Reformation 10 November 1483: Martin Luther born in Eisleben 11 November 1483: Luther baptized at St. Peter and St. Paul Church, Eisleben (St. Martin’s Day) 1 January 1484: Ulrich Zwingli the first great Swiss -

Muk-Publikationen 25
Gottfried Posch Luther im Religionsunterricht muk-publikationen 25 1 ISSN 1614-4244 herausgeber: fachstelle medien und kommunikation schrammerstraße 3 80333 münchen http://www.m-u-k.de Februar 2005 Der Text entstand im Zusammenhang eines Seminars zur Themenreihe "Ökumene" der Mentorate an der LMU und TU München für Lehramtsstudierende mit dem Fach Katholische Religionslehre. 2 1. Einführung – zum Experimentieren größer Grundsätzliches zur ist als in anderen Fächern? Ist Mediennutzung. es nicht so, dass viele neue methodische Anregungen für Im Religionsunterricht haben den Unterricht im RU entwi- wir es mit jungen Menschen zu ckelt wurden? Kann es da tun, die unterschiedliche Me- nicht sein, dass auch im Me- diennutzer sind und verschie- dienbereich der RU eine Vorrei- dene Mediensozialisationen terrolle spielen kann? Die unterschiedlichster Prägung Chancen dazu sind groß. haben. Mit dem Bild- und Medienein- Man kann sich über den Ein- satz sind im weiten didakti- satz von Filmen im Religions- schen Feld Grundsatzentschei- unterricht streiten. Es gibt je dungen zu fällen. Die alles ent- nach der eigenen Mediensozi- scheidende Frage ist: Wie wirkt alisation und den Erfahrungen das Bild, das Medium auf im Unterricht Gegner und Be- Schüler? fürworter. Der Religionsunterricht schul- Vernachlässigen wir im RU die det dem Schüler konkrete Le- medialen Vermittlungszugän- benshilfe. Der Einsatz audiovi- ge, können wir auf Dauer noch sueller Medien muss diesem weniger Schülerinnen und Ziel dienlich sein. Er hat auch Schülern, die eben immer stär- einen Beitrag zur Medienerzie- ker mediensozialisiert sind, un- hung zu leisten. sere Botschaft vermitteln. Dies heißt nun aber nicht: "Medien Für den Medieneinsatz eignen über alles", sondern die Mög- sich im Schulunterricht vor al- lichkeiten der Medien nutzen, lem Filme: um die Kommunikationsbedin- gungen im Zeitalter der Mas- - Medien, die einen Gegenpol senmedien effektiv einzuset- zur täglichen Gewalt via Bild- zen. -

Johann Tetzel in Order to Pay for Expanding His Authority to the Electorate of Mainz
THE IMAGE OF A FRACTURED CHURCH AT 500 YEARS CURATED BY DR. ARMIN SIEDLECKI FEB 24 - JULY 7, 2017 THE IMAGE OF A FRACTURED CHURCH AT 500 YEARS Five hundred years ago, on October 31, 1517, Martin Luther published his Ninety-Five Theses, a series of statements and proposals about the power of indulgences and the nature of repentance, forgiveness and salvation. Originally intended for academic debate, the document quickly gained popularity, garnering praise and condemnation alike, and is generally seen as the beginning of the Protestant Reformation. This exhibit presents the context of Martin Luther’s Theses, the role of indulgences in sixteenth century religious life and the use of disputations in theological education. Shown also are the early responses to Luther’s theses by both his supporters and his opponents, the impact of Luther’s Reformation, including the iconic legacy of Luther’s actions as well as current attempts by Catholics and Protestants to find common ground. Case 1: Indulgences In Catholic teaching, indulgences do not effect the forgiveness of sins but rather serve to reduce the punishment for sins that have already been forgiven. The sale of indulgences was initially intended to defray the cost of building the Basilica of St. Peter in Rome and was understood as a work of charity, because it provided monetary support for the church. Problems arose when Albert of Brandenburg – a cardinal and archbishop of Magdeburg – began selling indulgences aggressively with the help of Johann Tetzel in order to pay for expanding his authority to the Electorate of Mainz. 2 Albert of Brandenburg, Archbishop of Mainz Unused Indulgence (Leipzig: Melchior Lotter, 1515?) 1 sheet ; 30.2 x 21 cm. -

Punkt 3 Ausgabe 2017/14
20. Juli // Ausgabe 14/2017 Reisen in Berlin und Brandenburg Foto: DB AG Foto: 125 Jahre Hertha BSC: herzlichen Glückwunsch! Ein nagelneues Wandbild grüßt S-Bahn-Fahrgäste am frisch sanierten Treppenaufgang des S-Bahnhofs Gesundbrunnen. Ein weiteres Überraschungs- geschenk für „die Hertha“ ist Gesund- in Vorbereitung. m Seite 5 brunnen Schönhauser Allee <xrWxrQ> x1 x8 x8xiTx9 x2 D xwT Foto: LKEE/Andreas Franke x2 x5 B Spandau<x5 Friedrich- Potsdam Hbf<x7 x5x7xuT straße x5x7 Frankfurter x5 Ostbahnhof >Strausberg Nord Facettenreicher Streifzug durch die Geschichte Allee x7>Ahrensfelde x5x7 Berlin S-Bahn Grafik: Haupt- Alexander- xuT>Wartenberg bahnhof platz x5 Lichtenberg S-Bahn- x5x7xuT x5> Hönow Warschauer Straße Pendelzug Nöldner- über Wuhletal M platz ᵛ Oberbaum- Nöldnerplatz/ brücke Schlichtallee Ostkreuz E x3 x3>Erkner A F Rummels- " x8 C burg Karlshorst Treptower <xrQxrW> Park Reformation an xrTxrZxrU F xrUx8 Hermannstr. Neukölln §A A! Ferienzeit ist Bauzeit: Elbe und Elster Einschränkungen Michael Piero schlüpft als Gäste- Reformatoren: Luther hatte seine rund ums Ostkreuz führer im Museum „Mühlberg 1547“ Meinung in Bad Liebenwerda Wegen Bauarbeiten gibt es gern mal in die Tracht eines standhaft verteidigt und in vom 21. Juli bis 21. August Schreibers im Dienst Kaiser Karls V. Herzberg an der Elster die erste Einschränkungen zwischen Ein solcher hielt die Niederlage der reformatorische Schulordnung Lichtenberg/Karlshorst, Ostkreuz und Ostbahnhof. Eine Protestanten in der Schlacht von mit unterzeichnet. Grafik zeigt die alternativen Mühlberg an der Elbe für die Das und vieles mehr erfahren Routen im Überblick. m Seite 7 Nachwelt fest. Dabei sah es vorher Ausflügler auf dem Streifzug des so gut aus für die Sache der Monats im RE 3. -

History of the Lutheran Reformation
Celebrating the 500 th Anniversary of the Protestant Reformation Sola Gratia Grace Alone Sola Fide Faith Alone Sola Scriptura Scripture Alone Martin Luther nailing his 95 Theses on the church door. Wittenberg, Germany. October 31, 1517 Contents Main People.............................................................................................1 Important Words......................................................................................2 Important Cities.......................................................................................4 Reformation Map ....................................................................................5 Chronology..............................................................................................6 Contents of the Book of Concord............................................................8 Luther's 95 Theses...................................................................................9 Luther's own description of the Reformation........................................14 Who Are Lutherans? .............................................................................19 The Lutheran Reformation Main People Earlier Reformers John Wycliffe (died 1384) -- England, translated the Latin Bible to English Jan (John) Hus (died 1415) -- Bohemia, executed (burned at the stake) People with Luther Johann Staupitz -- Luther's mentor, head of the Augustinian monastery Duke Frederick the Wise of Saxony -- Luther's protector Georg Spalatin -- Duke Frederick's assistant and problem solver in -

The Spark for the Reformation: Indulgences
The Spark for the Reformation: Indulgences Although there were many causes of the Reformation, the immediate issue that sparked Luther into the position of a reformer was the sale of indulgences. Indulgences were remissions or exemptions for punishment due to an individual for the sins he had committed in life. They could be granted by the papacy because of the doctrine that it could draw on the treasury of merit or pool of spiritual wealth left by Christ and extraordinarily good Christians over time. As with some other practices of the Church, what was once used primarily for spiritual purposes, such as rewarding acts of penitence, was by the early sixteenth century being ""abused" for secular purposes, such as providing money for Church of officers. This was apparently the case with the sale of indulgences by Johann Tetzel (1465?-1519), a persuasive, popular Dominican friar who was appointed by Archbishop Albert of Mainz in 1517 to .sell indulgences in Germany. Proceeds of the sale were to be split between Albert and the papacy. The following is an excerpt from a sermon on indulgences by Tetzel. Consider: The most convincing "selling points" made by Tetzel; the requirements for obtaining effective indulgences; how Tetzel might have defended himself against attacks on this sale of indulgences as an abuse. You may obtain letters of safe conduct from the vicar of our Lord Jesus Christ, by means of which you are able to liberate your soul from the hands of the enemy, and convey it by means of contrition and confession, safe and secure from all pains of Purgatory, into the happy kingdom. -

Luther Im Religionsunterricht
http://www.mediaculture-online.de Autor: Posch, Gottfried. Titel: Luther im Religionsunterricht. Quelle: muk-Publikationen # 25. München, Februar 2005. http://www.muk.erzbistum- muenchen.de/ Verlag: muk – medien und kommunikation. Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags. Gottfried Posch Luther im Religionsunterricht 1. Einführung – Grundsätzliches zur Mediennutzung. Im Religionsunterricht haben wir es mit jungen Menschen zu tun, die unterschiedliche Mediennutzer sind und verschiedene Mediensozialisationen unterschiedlichster Prägung haben. Man kann sich über den Einsatz von Filmen im Religionsunterricht streiten. Es gibt je nach der eigenen Mediensozialisation und den Erfahrungen im Unterricht Gegner und Befürworter. 1 http://www.mediaculture-online.de Vernachlässigen wir im RU die medialen Vermittlungszugänge, können wir auf Dauer noch weniger Schülerinnen und Schülern, die eben immer stärker mediensozialisiert sind, unsere Botschaft vermitteln. Dies heißt nun aber nicht: "Medien über alles", sondern die Möglichkeiten der Medien nutzen, um die Kommunikationsbedingungen im Zeitalter der Massenmedien effektiv einzusetzen. Hier liegt eine der großen Chancen des RU - denn ist es nicht so, dass im RU das Feld zum Experimentieren größer ist als in anderen Fächern? Ist es nicht so, dass viele neue methodische Anregungen für den Unterricht im RU entwickelt wurden? Kann es da nicht sein, dass auch im Medienbereich der RU eine Vorreiterrolle spielen kann? Die Chancen dazu sind groß. Mit dem Bild- und Medieneinsatz sind im weiten didaktischen Feld Grundsatzentscheidungen zu fällen. Die alles entscheidende Frage ist: Wie wirkt das Bild, das Medium auf Schüler? Der Religionsunterricht schuldet dem Schüler konkrete Lebenshilfe. Der Einsatz audiovisueller Medien muss diesem Ziel dienlich sein. Er hat auch einen Beitrag zur Medienerziehung zu leisten. -

German Inter-Monastic Politics and the Reformation of the Sixteenth Century 115
German inter-monastic politics and the Reformation of the sixteenth century 115 German inter-monastic politics and the Reformation of the sixteenth century Rev Dr Mark W Worthing Mark Worthing, Dr Phil, Dr Theol, is a pastor of the LCA. After parish ministry in Adelaide, he taught in the field of historical and systematic theology at the former Luther Seminary, Adelaide, then at Tabor-Adelaide, and now serves as senior researcher with the research arm of Australian Lutheran College, the Australian Lutheran Institute for Theology and Ethics (ALITE). The story is well known among Protestants. When Pope Leo X learned of the dispute surrounding Luther’s 95 theses he mistakenly dismissed it as a monastic squabble.1 There is strong evidence, however, that while the Reformation of the sixteenth century proved to be ultimately much more than a monastic dispute, in its earliest phases much of what occurred can best be understood in light of the complexities of the inter-monastic rivalry between the Augustinians and Dominicans. The Augustinian movement Two types of Augustinians emerged during the medieval period: the Order of Canons Regular, who were largely clergy connected to specific churches or cathedrals; and the Augustinian hermits, who were a true monastic order.2 In the fifteenth century a split occurred within the Hermit tradition between ‘observant’ congregations that sought reform through strict adherence to the Rule, and the ‘conventuals’, who sought to interpret the Rule more flexibly.3 The monastery Luther entered was the Erfurt Observant Congregation of Augustinian Hermits.4 The philosophical and theological gulf between Augustinians and Dominicans The rediscovery of Aristotle in the West prompted the two greatest theologians of the Dominican Order, Albertus Magnus and his student Thomas Aquinas, to develop an 1 Cf. -

Annotated Luther V1 2Nd Pages 00FM-09.Indd
Introduction to Volume 1 TIMOTHY J. WENGERT On 31 October 1517 a little-known professor of theology at an out-of-the-way, relatively new university in the town of Wittenberg, Saxony, enclosed a copy of ninety-five state- ments concerning indulgences in a letter to Archbishop Albrecht of Mainz, primate of the Catholic churches� in the Holy Roman Empire of the German Nation.1 By 1520 that 1. For the most thorough account of same professor, an Augustinian friar named Martin Luther, Luther’s life during this period, see had become the world’s first living best-selling author while, Martin Brecht, Martin Luther: His Road to Reformation, 1483–1521, trans. James at the same time, was threatened with excommunication by L. Schaaf (Minneapolis: Fortress Press, Pope Leo X (1475–1521). The documents in this first volume 1985). of The Annotated Luther contain some of the most impor- tant documents from this period, beginning with the 95 Theses of 1517 and concluding with the tract The Freedom of a Christian from 1520. These writings outline Luther’s develop- ment from those early days to within six months of his dra- matic appearance before the imperial diet meeting in Worms in 1521, where he gave his defense for many of the writ- ings contained in this volume.a Whatever other differences between Luther and his opponents emerged in later stages of what came to be called the Reformation, these documents, a See Luther at the Diet of Worms (1521), in LW 32:101–31. 1 2 THE ROOTS OF REFORM and others that he wrote during this time, surely provided the initial sparks of that remarkable conflagration within the late medieval Western church. -
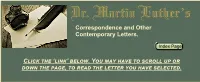
MARTIN LUTHER 500 LETTERS 1507- 1546 with Clickable Index
Dr. Martin Luther’s Correspondence and Other Contemporary Letters. Index Page C���� ��� ‘����’ �����. Y�� ��� ���� �� ������ �� �� ��� ��� ����, �� ���� ��� ������ ��� ���� ��������. 1. To John Braun, Vicar in Eisenach. April 255.Do. November 2.To John Braun, Vicar in Eisenach. March 256.Wenzel December 3.Augustinians in Erfurt. September 257.Elector John. December 4.George Spenlein, Augustinian in Memmingen. April 258.Town Council of Gottingen. January 5.George Leiffer, Augustinian in Erfurt. April 259.Nicolas Hausmann. January 6.Johann Bercken, Augustinian Prior in Mainz. May 260.John Gutel. January 7.George Spalatin. June 261.Martin Bucer. January 8.Michael Dressel, Augustinian Prior, Neustadt. June 262.Katherine Zell. January 9.John Lange, Prior at Erfurt. October 263.Nicolas Hausmann. February 10.Christoph Scheurl, Nurnberg. January 264.Rath of Gottingen. March 11.John Lange. March 265.John Gutel. March 12.Christoph Scheurl. May 266.Rath of Gottingen. March 13.John Lange. May 267.Nicolas Hausmann. May 14.George Spalatin. No date 268.His Mother. May 15.Christoph Scheurl. September 269.Conrad Cordatus. May 16.Archbishop Albrecht of Mayence. October 270.Christians in Zwickau. June 17.George Spalatin. November 271.Michael Stiefel. June or July 18.Elector Frederick of Saxony, the Wise. November 272.Bernard von Dolen. July or December 273.Elector John. August 14 19.George Spalatin. February 274.Nicolas Amsdoff. September 20.Christoph Scheurl. March 275.Nicolas Hausmann. October 21.John Lange. March 276.Do. November 22.Johann von Staupitz. March 277.Johann Bugenhagen. November 23.Do. May 278.Hans von Laser. December 24.Pope Leo X. May 279.Nicolas Gerbel, Strassburg. No date 25.Wenzel Link. July 280.Martin Gorlitz, Brunswick. -
Reformation Zwischen Elbe Und Elster“ Lädt Sie Ein, Das Kernland Der Reformation Neu Kennenzuler- Nen
Reformation zwischen Eine Kulturroute Elbe und Elster von Torgau nach Wittenberg auf zwei oder vier Rädern entdecken Lars-Arne Dannenberg und Matthias Donath, Zentrum für Kultur // Geschichte www.zkg-dd.de Der Reformation auf der Spur! Die Reformation war ein epochales Ereignis, das die Gesell- schaft des christlichen Abendlandes grundlegend veränderte. Auch 500 Jahre nach der Veröffentlichung der 95 Thesen durch Martin Luther in Wittenberg wird weit über Deutschlands Grenzen hinaus daran erinnert, welche Auswirkungen die da- maligen Ereignisse bis in die heutige Zeit haben. Die Kulturroute „Reformation zwischen Elbe und Elster“ lädt Sie ein, das Kernland der Reformation neu kennenzuler- nen. Die 190 Kilometer lange Tour führt Sie von der Katharina- Stadt Torgau links und rechts der Elbe zur Lutherstadt Witten- berg. Ob mit dem Rad oder dem Auto lässt sich die Route an einem verlängerten Wochenende oder mit Tagesausflügen be- quem „erfahren“. Entdecken Sie urige Altstädte mit ihren verwunschenen Schlössern, stolzen Rathäusern und prächtigen Kirchen und gehen Sie auf eine moderne Zeitreise ins Museum „Mühlberg 1547“. Sie spüren die unmittelbare Nähe zur Natur, wandeln auf den Spuren deutscher Geschichte und verbinden ganz neben bei Erholung und Kulturgenuss. Damit Sie auf Ihrer Reise in die Geschichte eintauchen kön- nen, hat der Städteverbund „Prediger und Bürger – Reformation Blick auf Mühlberg mit Elbe im städtischen Alltag“ einen Wegweiser herausgegeben, der Sie auf Ihrer Reise begleitet. Er stellt Ihnen Orte vor, an denen die Ereignisse der Reformation und ihre Folgen eindrucksvoll sichtbar werden. Gehen Sie auf Entdeckungsreise! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Michael Oecknigk Bürgermeister der Stadt Herzberg (Elster) und Reformationsbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg Landschaft und Geschichte zwischen Elbe und Elster Die Landschaft zwischen Elbe und Elster ist das Kernland der Reformation.