Diplomarbeiten 2020 Übersicht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Summary of Family Membership and Gender by Club MBR0018 As of December, 2009 Club Fam
Summary of Family Membership and Gender by Club MBR0018 as of December, 2009 Club Fam. Unit Fam. Unit Club Ttl. Club Ttl. District Number Club Name HH's 1/2 Dues Females Male TOTAL District 114 M 22048 BAD HALL 0 0 0 30 30 District 114 M 22050 BAD ISCHL 0 0 0 45 45 District 114 M 22051 ENNS-ST VALENTIN L C 0 0 0 35 35 District 114 M 22052 GMUNDEN 0 0 0 45 45 District 114 M 22053 HAUSRUCK 0 0 0 36 36 District 114 M 22058 KIRCHDORF 0 0 0 36 36 District 114 M 22062 LINZ 0 0 0 44 44 District 114 M 22063 LINZ DANUBIUS 0 0 0 41 41 District 114 M 22064 LINZ NIBELUNGEN 0 0 0 44 44 District 114 M 22068 PERG 0 0 0 33 33 District 114 M 22077 STEYR 0 0 0 29 29 District 114 M 22078 STEYR INNERBERG 0 0 0 36 36 District 114 M 22082 VOCKLABRUCK 0 0 0 41 41 District 114 M 22084 WELS 0 0 0 36 36 District 114 M 22090 BRUCK A M 0 0 0 42 42 District 114 M 22092 FELDBACH 0 0 0 46 46 District 114 M 22093 FUERSTENFELD 0 0 0 32 32 District 114 M 22094 GRAZ 0 0 0 40 40 District 114 M 22095 GRAZ JOANNEUM 0 0 0 34 34 District 114 M 22096 GRAZ STYRIA 0 0 0 19 19 District 114 M 22097 JUDENBURG-KNITTELFELD L C 0 0 0 35 35 District 114 M 22100 LEIBNITZ 0 0 0 40 40 District 114 M 22101 LEOBEN 0 0 0 38 38 District 114 M 22102 LIEZEN 0 0 0 47 47 District 114 M 22106 MURAU 0 0 0 40 40 District 114 M 22122 VOITSBERG KOFLACH 0 0 0 37 37 District 114 M 28060 WELS POLLHEIM 0 0 0 41 41 District 114 M 29390 WEYER 0 0 0 30 30 District 114 M 30019 SCHARDING-PRAMTAL 0 0 0 42 42 District 114 M 34775 ST ULRICH 0 0 0 35 35 District 114 M 35401 LINZ DELTA 0 0 0 31 31 District 114 M -

Neukonzeption Wirtschaftförderung Und Stadtmarketing Heilbronn
CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Linz Land Stadtentwicklung M a r k e t i n g Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement I m m o b i l i e n Präsentation am 09. Februar 2015 Ing. Mag. Georg Gumpinger Organisationsberatung K u l t u r T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen 2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf . Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte . Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 . „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Ansfelden Neuhofen an der Krems Asten Pasching Enns St. Florian Hörsching Traun Leonding 3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 1.150 830 Interviews in im Bezirk Linz Land Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 660 im Bezirk Linz Land City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte -

District 114 M.PDF
Lions Clubs International Clubs Missing a Current Year Club Officer (Only President, Secretary or Treasurer) as of August 01, 2010 District 114 M Club Club Name Title (Missing) 22048 BAD HALL President 22048 BAD HALL Secretary 22048 BAD HALL Treasurer 22050 BAD ISCHL President 22050 BAD ISCHL Secretary 22050 BAD ISCHL Treasurer 22051 ENNS-ST VALENTIN L C President 22051 ENNS-ST VALENTIN L C Secretary 22051 ENNS-ST VALENTIN L C Treasurer 22052 GMUNDEN President 22052 GMUNDEN Secretary 22052 GMUNDEN Treasurer 22053 HAUSRUCK President 22053 HAUSRUCK Secretary 22053 HAUSRUCK Treasurer 22058 KIRCHDORF President 22058 KIRCHDORF Secretary 22058 KIRCHDORF Treasurer 22062 LINZ President 22062 LINZ Secretary 22062 LINZ Treasurer 22063 LINZ DANUBIUS President 22063 LINZ DANUBIUS Secretary 22063 LINZ DANUBIUS Treasurer 22064 LINZ NIBELUNGEN President 22064 LINZ NIBELUNGEN Secretary 22064 LINZ NIBELUNGEN Treasurer 22068 PERG President 22068 PERG Secretary 22068 PERG Treasurer 22077 STEYR President 22077 STEYR Secretary 22077 STEYR Treasurer OFF0021 Run Date: 8/1/2010 8:12:05AM Page 1 of 8 Lions Clubs International Clubs Missing a Current Year Club Officer (Only President, Secretary or Treasurer) as of August 01, 2010 District 114 M Club Club Name Title (Missing) 22078 STEYR INNERBERG President 22078 STEYR INNERBERG Secretary 22078 STEYR INNERBERG Treasurer 22082 VOCKLABRUCK President 22082 VOCKLABRUCK Secretary 22082 VOCKLABRUCK Treasurer 22084 WELS President 22084 WELS Secretary 22084 WELS Treasurer 22090 BRUCK A M President 22090 BRUCK A M Secretary -

Gemeindeliste Sortiert Nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt Am: 21.05.2015 14:29:08
Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt am: 21.05.2015 14:29:08 Gemeinde Gemeinde PLZ des Gemeindename Status weitere Postleitzahlen kennziffer code Gem.Amtes 10101 Eisenstadt 10101 SS 7000 10201 Rust 10201 SS 7071 10301 Breitenbrunn am Neusiedler See 10301 M 7091 10302 Donnerskirchen 10302 M 7082 10303 Großhöflein 10303 M 7051 10304 Hornstein 10304 M 7053 2491 10305 Klingenbach 10305 7013 10306 Leithaprodersdorf 10306 2443 10307 Mörbisch am See 10307 7072 10308 Müllendorf 10308 7052 10309 Neufeld an der Leitha 10309 ST 2491 10310 Oggau am Neusiedler See 10310 M 7063 10311 Oslip 10311 7064 10312 Purbach am Neusiedler See 10312 ST 7083 10313 Sankt Margarethen im Burgenland 10313 M 7062 10314 Schützen am Gebirge 10314 7081 10315 Siegendorf 10315 M 7011 10316 Steinbrunn 10316 M 7035 2491 10317 Trausdorf an der Wulka 10317 7061 10318 Wimpassing an der Leitha 10318 2485 10319 Wulkaprodersdorf 10319 M 7041 10320 Loretto 10320 M 2443 10321 Stotzing 10321 2443 10322 Zillingtal 10322 7034 7033 7035 10323 Zagersdorf 10323 7011 10401 Bocksdorf 10401 7551 10402 Burgauberg-Neudauberg 10402 8291 8292 10403 Eberau 10403 M 7521 7522 10404 Gerersdorf-Sulz 10404 7542 7540 10405 Güssing 10405 ST 7540 7542 10406 Güttenbach 10406 M 7536 10407 Heiligenbrunn 10407 7522 10408 Kukmirn 10408 M 7543 10409 Neuberg im Burgenland 10409 7537 10410 Neustift bei Güssing 10410 7540 10411 Olbendorf 10411 7534 10412 Ollersdorf im Burgenland 10412 M 7533 8292 Q: STATISTIK AUSTRIA 1 / 58 Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand -

Steel-Town-Man Linz - Olympische Distanz 2012 Ergebnisliste Olympische Distanz - 1,5K / 40K / 10K - Nach Zeit Sortiert 2012-07-07 Seite 1
Steel-Town-Man Linz - Olympische Distanz 2012 Ergebnisliste Olympische Distanz - 1,5k / 40k / 10k - nach Zeit sortiert 2012-07-07 Seite 1 Rang Stnr Name Jg. Nat. Verein/Ort Klasse KRg. Swim/Rg. T1 Bike/Rg. T2 Run/Rg. Strafe Gesamt 1 1 Birngruber Christian, Mag. 83 AUT RLC Elmer Reichör M-ELITE1 1 0:20:38/4. 00:34 0:57:48/2. 00:33 0:36:10/2. 1:55:44 2 2 Buxhofer Matthias 73 AUT Tri Dornbirn ÖPolSV M-ELITE2 1 0:24:48/15. 00:38 0:56:11/1. 00:32 0:36:30/3. 1:58:40 3 5 Molnar Gergö 86 HUN LTU Linz M-ELITE1 2 0:20:24/1. 00:37 1:04:17/24. 00:41 0:37:17/6. 2:03:18 4 6 Keller Bernhard 69 AUT RATS AMstetten M-MAS40 1 0:24:12/12. 00:37 1:03:15/11. 00:31 0:36:39/4. 2:05:16 5 8 Froschauer Christian 67 AUT Team Zisser Enns M-MAS45 1 0:22:41/6. 00:38 1:03:18/12. 00:34 0:39:05/12. 2:06:17 6 171 Schöpf Christoph 87 AUT LTU Linz M-ELITE1 3 0:22:50/8. 00:40 1:02:15/6. 00:39 0:40:00/17. 2:06:26 7 166 Auer Christian 77 AUT TriPowerWimbergerHausFreistadt M-ELITE2 2 0:25:06/19. 00:40 1:04:25/26. 00:35 0:35:44/1. 2:06:32 8 4 Prem Andreas 91 AUT LTU Linz M-U23 1 0:20:28/2. -
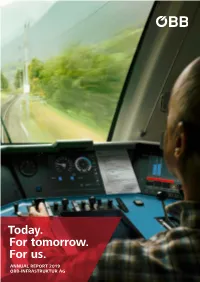
Today. for Tomorrow. for Us
Today. For tomorrow. For us. ANNUAL REPORT 2019 ÖBB-INFRASTRUKTUR AG Contents CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT 2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 80 A. Group structure and investments 2 Consolidated Income Statement 2019 80 B. General conditions and market environment 5 Consolidated Statement of Comprehensive Income 2019 81 C. Economic report and outlook 10 Consolidated Statement of Financial Position as of Dec 31, 2019 82 D. Research and development 29 Consolidated Statement of Cash Flows 2019 83 E. Group relationships 31 Consolidated Statement of Changes in Equity 2019 84 F. Opportunity and risk report 32 G. Non-financial statement 37 Notes to the Consolidated Financial Statements as of Dec 31, 2019 H. Notes to the Group Management Report 77 85 A. Basis and Methods 85 Glossary 78 B. Notes to the Consolidated Statement of Financial Position Statement pursuant to Section 124 (1) of the and the Consolidated Income Statement 106 Stock Exchange Act 79 C. Other Notes to the Consolidated Financial Statements 133 Audit Certificate 162 ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Consolidated Management Report | Consolidated Financial Statements Consolidated Management Report A. Group structure and investments 2 The ÖBB-Infrastruktur Group must ensure the economic and efficient use of Austria's railway infrastructure and its aavailabilityvailability to all railway operators on a non-discriminatory basis. At the same time, the ÖBB-Infrastruktur Group builds Austria's railway infrastructure on behalf of the Republic of Austria. The financing of the capital expenditures in rail infrastructure development is ensured through the cash flow generated, outside capital and guarantees and investment grants from the federal government on the basis of multi-year master plans. -

Marktgemeinde Neuhofen an Der Krems
Marktgemeinde Neuhofen an der Krems 210000-1/12-2014-HAM Auskünfte Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Tel.: (+43 732) 7720-11426 Fax: (+43 732) 7720-214089 E-Mail: [email protected] www.lrh-ooe.at Impressum Herausgeber: Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Redaktion: Oberösterreichischer Landesrechnungshof Herausgegeben: Linz, im Mai 2014 Marktgemeinde Neuhofen an der Krems Mai 2014 INHALTSVERZEICHNIS Kurzfassung ...............................................................................................................1 Struktur der Gemeinde .............................................................................................. 7 Eckdaten und Lageplan ..................................................................................................... 7 Strukturelle Entwicklung .................................................................................................... 8 Gemeindevertretung .................................................................................................. 8 Organisation ...............................................................................................................9 Personalstand und Dienstposten ....................................................................................... 9 Ziel- und wirkungsorientierte Verwaltungsführung........................................................... 11 Aufbau- und Ablauforganisation der Amtsverwaltung ..................................................... 11 Allgemeines .............................................................................................................. -

LEONDING | Nöbauerstraße EXKLUSIVES WOHNEN in AUSSICHTS- LAGE
LEONDING | Nöbauerstraße EXKLUSIVES WOHNEN IN AUSSICHTS- LAGE Symbolbild HOCHWERTIGE EIGENTUMSWOHNUNGEN & DOPPELHÄUSER IN SONNIGER LAGE NAHE DES ZENTRUMS INHALT | VORWORT 03 210 550 210 2a 60 230 90 230 Doppelgarage Estrich beschichtet 38,64 m2 90 Garage Top 2 200 Estrich beschichtet VR/Diele Fliesen 13,13 m2 AR WC 90 200 80 Fliesen Fliesen 1,00 m2 1,66 m2 200 80 200 80 200 93 220 90 Küche/Essen Holz 230 0425,29 m2 200 140 Wohnen Holz 20,01 m2 90 275 330 275 Terrasse Keramik 19,04 m2 Eigengarten 254,13 m2 inkl. Stützmauer und Fläche unter Stützmauer 0 5 10 cm Bemerkungen: Erdgeschoss 61,09m² Änderungen infolge Behördenauflagen, haustechnischer und konstruktiver Maßnahmen Doppelhaushälfte 2a Grundgrenze vorbehalten. Statische und bauphysikalische DetailsZaun sind nicht Planinhalt. Die Wohnungs- Obergeschoss 70,44m² und Raumgrößen sind ca. Angaben und können sich aufgrund der Detail- und Ausführungsplanung Erdgeschoss Gesamt 131,53 m² sowie Bautoleranzen ändern. Dieser Plan ist zum Anfertigen von Einbaumöbeln nicht geeignet. Einrichtung erfolgt lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung. Haustechniksymbole12 und Sanitärkeramik 20 ( Badewannen, Waschtisch, WC's etc. ) sind nicht massgenau und definieren nur die Lage. M 1:100 Terrasse 19,04m² Einrichtungsgegenstände sind im Kaufpreis nicht inkludiert. Stand 16.09.2020 Garten ~ 254 m² Lageplan WOHNEN IN LEONDING Dieses exklusive Neubauprojekt bestehend aus einem Wohnhaus mit zwei wunderschö- nen Eigentumswohnungen sowie einem char- 26 manten Doppelhaus, befindet sich in einer der begehrtesten Wohngegenden im Zentrum von Leonding und gewährleistet dadurch kur- ze Wege und eine ausgezeichnete Infrastruk- tur. Neben einer geräumigen 4 Zimmer Erd- geschoßwohnung mit großzügigem Ei- gengarten, entsteht im Obergeschoß eine moderne Wohneinheit mit einer großen, süd- 27 westseitigen Dachterrasse von welcher Sie einen traumhaften Ausblick bis ins Gebirge genießen. -

Vorläufiger Stellungsplan Oberösterreich
Vorläufiger Stellungsplan des Militärkommandos OBERÖSTERREICH Geburtsjahrgang 2003 Bitte beachten Sie Folgendes: 1. Für den Bereich des Militärkommandos Oberösterreich werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskommission Oberösterreich, Garnisonstraße 36, 4018 Linz der Stellung unterzogen. Das Stellungsverfahren nimmt in der Regel 1 1/2 Tage in Anspruch. 2. Die Stellungspflichtigen haben sich bis 0600 des Stellungstages im Stellungshaus einzufinden, können aber, wenn es aus verkehrstechnischen Gründen zwingend erforderlich ist, schon am Vorabend bis 2100 Uhr erscheinen (für Unterkunft im Stellungshaus ist gesorgt). Aufgrund der aktuellen COVID-Lage wird empfohlen, erst am Stellungstag anzureisen. 3. Zur Überprüfung der Identität und Staatsbürgerschaft sind mitzubringen: Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis der Republik Österreich, Führerschein usw.), eigener Staatsbürgerschaftsnachweis (entfällt bei Vorlage von Reisepass oder Personalausweis der Republik Österreich), bei Doppelstaatsbürgerschaft ein entsprechender Nachweis, Geburtsurkunde, E-Card, eventuell Heiratsurkunde. 4. Zur Beurteilung des Gesundheitszustandes sind mitzunehmen: Eventuell vorhandene ärztliche Atteste (hierfür besteht kein Anspruch auf Kostenvergütung) sowie der ausgefüllte und unterschriebene medizinische Fragebogen, falls er dem Stellungspflichtigen zugestellt wurde. 5. Zur Beurteilung des Ausbildungsstandes ist mitzunehmen: Eine gültige Schulbestätigung bzw. ein gültiger Lehrvertrag. 6. Bei Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe besteht -

Ergebnisse Der Gemeinden Und Bezirke Bürgermeisterwahl Fortsetzung Nächste Seite ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE Wahl- Wahl- Gültige Bürgermeister Gem.Nr Gemeinde Berecht
Ergebnisse der Gemeinden und Bezirke Bürgermeisterwahl Fortsetzung nächste Seite ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE Wahl- Wahl- gültige Bürgermeister Gem.Nr Gemeinde berecht. bet. in% Stimmen Stimm. Ant.% Diff.% Stimm. Ant.% Diff.% Stimm. Ant.% Diff.% Stimm. Ant.% Diff.% 4 Oberösterreich 1.155.084 78,7 864.257 409.453 47,38 -1,94 275.244 31,85 -6,30 109.585 12,68 +5,20 30.185 3,49 +1,86 WK Linz Umgebung 265.204 71,6 183.046 51.300 28,03 -6,68 76.958 42,04 -12,46 30.287 16,55 +9,01 17.200 9,40 +7,76 WK Innviertel 175.954 78,8 133.100 73.782 55,43 +0,59 29.567 22,21 -6,38 19.453 14,62 +4,00 1.173 0,88 -0,15 WK Hausruckviertel 285.059 79,9 215.401 107.472 49,89 -2,26 61.940 28,76 -3,89 35.061 16,28 +5,66 3.989 1,85 -0,22 WK Traunviertel 205.781 78,8 153.866 65.524 42,59 -0,12 60.043 39,02 -5,06 19.443 12,64 +5,27 3.979 2,59 +0,22 WK Mühlviertel 223.086 85,4 178.844 111.375 62,27 +0,41 46.736 26,13 -4,39 5.341 2,99 +1,44 3.844 2,15 +1,24 40101 Linz 152.493 67,66 99.202 Stichwahl: VP/SP 20.914 21,08 -11,35 43.420 43,77 -14,28 17.201 17,34 +9,25 12.827 12,93 +12,93 152.493 43,24 64.599 Luger Klaus-Peter SP 25.208 39,02 39.391 60,98 40201 Steyr 29.424 68,8 19.298 Hackl Gerald SP 2.172 11,26 -8,17 11.008 57,04 -2,64 3.783 19,60 +6,43 1.680 8,71 +2,40 40301 Wels 43.973 70,91 30.458 Stichwahl: SP/FP 5.228 17,16 -2,90 8.310 27,28 -15,66 14.496 47,59 +18,38 1.515 4,97 -1,47 43.973 60,85 25.729 Mag. -

Medienservice
MEDIENSERVICE Der Bezirk Linz-Land ist ein Topeinkaufs- standort für fast alle Oberösterreicher Knapp drei Viertel der Kaufkraft werden im Bezirk gebunden Linz, 9. Februar 2015 Ihre Gesprächspartner: Manfred Benischko Obmann der WKO Linz-Land Andrea Danda -Bäck Bezirksstellenleiterin der WKO Linz-Land Georg Gumpinger CIMA Beratung + Management GmbH Medienservice im Internet: wko.at/ooe/Medienservice Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: WKO Oberösterreich | Hessenplatz 3| 4020 Linz T 05-90909-3315 | F 05-90909-3311 | E [email protected] | w wko.at/ooe | DVR 0043087 Kaufkraft-Ströme in Linz-Land Medienservice Der Bezirk Linz-Land ist ein Topeinkaufsstandort für fast alle Oberösterreicher – Knapp drei Viertel der Kaufkraft werden im Bezirk gebunden „Mit einem Einzelhandelsumsatz von rund 1,2 Milliarden Euro behauptet sich Linz-Land im Oberösterreich-Vergleich hinter der Landeshauptstadt an zweiter Stelle. Gleich drei Gemein- den – Ansfelden, Pasching und Leonding finden sich im oö. Ranking der Einzelhandelsumsätze unter den ersten zehn. Zu- dem gelingt es Linz-Land fast drei Viertel der Kaufkraft im Be- zirk zu binden. Besonders hoch fällt diese Standorttreue mit 86 Prozent Bezirksbindung bei den Waren des täglichen Ge- brauchs aus. Die Kaufkraftbilanz des Bezirks Linz-Land fällt mit einem Plus von 342 Millionen Euro deutlich positiv aus. Die am stärksten wachsende Konkurrenz des Bezirks-Einzelhandels ist der Online-Handel. Ein überdurchschnittliches Kaufkraftni- veau, hohe Standorttreue und eine deutlich positive Kauf- kraftbilanz machen den Handel zu einem großen Wirtschafts- faktor in Linz-Land“, ist Manfred Benischko, Obmann der WKO Linz-Land, mit dem Ergebnis der aktuellen Kaufkraftstudie zu- frieden. „Die guten Handelskennzahlen sprechen eine deutli- che Sprache und zeigen, dass Linz-Land als attraktive Ein- kaufsregion sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Be- zirks geschätzt wird. -

Lions Clubs International
Lions Clubs International Clubs Missing a Current Year Club Officer (Only President, Secretary or Treasurer) as of November 01, 2010 (No District) Club Club Name Title (Missing) 27949 PAPEETE President 27949 PAPEETE Secretary 27949 PAPEETE Treasurer 27952 MONACO DOYEN President 27952 MONACO DOYEN Treasurer 34968 SAN ESTEVAN President 34968 SAN ESTEVAN Secretary 34968 SAN ESTEVAN Treasurer 44697 ANDORRA DE VELLA Secretary 44697 ANDORRA DE VELLA Treasurer 54912 ULAANBAATAR CENTRAL President 54912 ULAANBAATAR CENTRAL Secretary 54912 ULAANBAATAR CENTRAL Treasurer 58998 ST PETERSBURG GOLDEN PELICAN President 58998 ST PETERSBURG GOLDEN PELICAN Secretary 58998 ST PETERSBURG GOLDEN PELICAN Treasurer 59954 SARAJEVO GRAD President 59954 SARAJEVO GRAD Secretary 59954 SARAJEVO GRAD Treasurer 60727 PHNOM PENH OBAYKHOM President 60727 PHNOM PENH OBAYKHOM Secretary 60727 PHNOM PENH OBAYKHOM Treasurer 63886 ULAANBAATAR KHERIEN Treasurer 63891 PHNOM PENH CENTRAL President 63891 PHNOM PENH CENTRAL Secretary 63891 PHNOM PENH CENTRAL Treasurer 63902 EREVAN ARARAT President 63902 EREVAN ARARAT Secretary 63902 EREVAN ARARAT Treasurer 64243 TIRANA President 64243 TIRANA Secretary 64243 TIRANA Treasurer OFF0021 Run Date: 11/1/2010 8:01:24AM Page 1 of 694 Lions Clubs International Clubs Missing a Current Year Club Officer (Only President, Secretary or Treasurer) as of November 01, 2010 (No District) Club Club Name Title (Missing) 77337 TIMOR LESTE President 77337 TIMOR LESTE Secretary 77337 TIMOR LESTE Treasurer 78932 LVIV Secretary 82297 DUBOSSARY President