Abschlussbericht Südafrika Inhalt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(Ccid) Business Plan
CAPE TOWN CENTRAL CITY IMROVEMENT DISTRICT (CCID) BUSINESS PLAN JULY 2020 – JUNE 2025 This business plan is available at www.capetownccid.org 2 CONTENTS 1. Introduction 3 The CCID: Background, nature and function 3 Achievements over the past 5 years 4 2. Strategic Objectives 7 Improving Public Safety 7 Maintaining, Cleaning & Upgrading Public Areas 7 Promoting Sustainable Social Development 7 Promoting the CCID & Economic Investment in the CBD 8 3. Improving Public Safety 9 CCID Department: Public Safety 9 Services 10 Projects 12 Major Deliverables across the 2020-2025 Period 13 4. Maintaining the Urban Environment 14 CCID Department: Urban Management 14 Services 15 Projects 17 Major Deliverables across the 2020-2025 Period 20 5. Promoting Social Development 21 CCID Department: Social Development 21 Services 22 Projects 24 Major Deliverables across the 2020-2025 Period 25 6. Promotion of the CCID 26 CCID Department: Communications 26 Services 26 Projects 28 Major Deliverables across the 2020-2025 Period 30 7. Financial Impact of the CCID 31 5-Year Budget 31 Budget allocation 32 Management Structure 32 8. Permissible Amendments to the Business Plan 33 9. Annexure A: 5-Year Budget 34 Annexure B: 5-Year Implementation & Programme Plan 3 1. INTRODUCTION THE CT CCID: BACKGROUND, NATURE & FUNCTION The Cape Town Central City Improvement District (CCID) was established in November 2000, as the operational arm of the then Cape Town Partnership. Covering the core of the CBD, it became the first legally bound City Improvement District (CID) in South Africa. Since then it has gained a reputation internationally as an acclaimed model of public-private partnership. -

The South African on 20 March Johan Keuler of Aurecon Gave a Small with the Essay Topics from Mid Year
environmentally effective manner.” A brave Engineer who SNIPPETS FROM COUNCIL (16 APRIL) tells the client he doesn't really need what he wants! Interviews for registration: ECSA has decided to do away The South African On 20 March Johan Keuler of Aurecon gave a small with the essay topics from mid year. SAICE was the only Institution of Civil Engineering audience a really fascinating talk on the project that won institution that wanted essays... Makes one think. By end Western Cape Branch last year's community-based category national award. a October there'll have been 150 reviews over two years. “pilot” programme of 7522 units in the City of Cape The Water Division wants SPEBS bursaries to be Town's Community Residential Unit Refurbishment available to post-graduate students too. Under discussion. NEWSLETTER No 2/2013 April/May 2013 Programme, spanning the years 2008 to 2015. Aurecon, Several branches have now appointed administrative appointed as implementing agents, put out tenders and pay assistants, and we are encouraged to do so as well. contractors (back to back client/ consulting engineer / National Office has the assistants on their books and pays FROM THE EDITOR contractor risk-sharing agreements). Problems included a portion of the salary (aiming at better financial reporting). rival gangs (not to be mixed or shaken), logistics Pietermaritzburg's lecture on the geology of the region BRANCH BUZZZZING complicated by the units under repair being scattered, up to was followed by a site visit wending its way up to the 19 people from a two-bedroom unit (taking turns to sleep) Drakensberg. -

Global Students 21,745 Students Are Becoming 13,123 Increasingly Mobile…
Global Living 2019 GLOBAL LIVING 2019 3 Welcome to the fifth edition of our Global Living report, Welcome where we examine the housing markets in 35 global cities. They include the most exciting cities in the world, from emerging technology-driven powerhouses like Shenzhen and Bangkok and more traditional capital cities such as Rome and Lisbon, to rapidly evolving modern urban centres like Dubai and Johannesburg. How have they all performed over the last year? House prices continued to grow in all but five of The most expensive city in which to rent a property the 35 cities we analysed - and four cities, Barcelona, today is New York, with Abu Dhabi, Hong Kong, Dublin, Shanghai and Madrid, saw double digit Jeddah and London not far behind. growth. The highest property prices, by some margin, are in Hong Kong, followed by Singapore, Shanghai Whether you are an owner, renter or investor in and Vancouver. residential property, we hope you find this report illuminating and informative. Hong Kong also leads the global residential property market on a $ per sq ft basis, while other cities in the top 10 include hotspots such as Paris, London and New York. As observed in last year’s report, some of the cities with the highest prices have introduced effective cooling measures to improve affordability and reduce an oversupply of housing stock. Jennet Siebrits Head of Residential Research Demand for flexible rental properties keeps on rising across the world, which impacts rental costs. Five European cities feature in the top 10 annual rental growth table, including Lisbon, Madrid, Dublin, Barcelona and London, with the other five from Asia (Hong Kong), North America (Vancouver, Toronto and Montreal), and South Africa (Cape Town). -
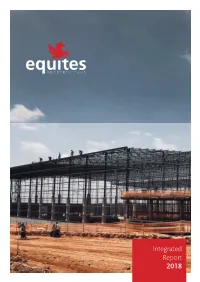
Integrated Report 2018 Front Cover: Premier FMCG, Equites Park Lords View, Gauteng Inside Cover: Tekstiel Road, Parow Industria, Cape Town
Integrated Report 2018 Front cover: Premier FMCG, Equites Park Lords View, Gauteng Inside cover: Tekstiel Road, Parow Industria, Cape Town. Equites Property Fund Limited Integrated Report 2018 1 About this report Report scope and Boundary provides an overview of the group’s performance, strategy, Report Approval and Independent Assurance The board of directors (the “board”) of Equites Property Fund risks and governance. The report focuses on both the The board has approved this Integrated Report and believes Limited (“Equites”, or the “group”, or the “company”) are group’s operations in South Africa (“SA”) and in the United that it has been prepared in accordance with best practice pleased to present this fourth Integrated Report for the year Kingdom (“UK”). and addresses all material aspects of the group. Independent ended 28 February 2018. The report has been compiled in assurance has been provided over all financial and certain accordance with International Financial Reporting Standards Materiality non-financial information presented in this report. (“IFRS”), the requirements of the Companies Act of South Equites identifies the concept of materiality to represent any PricewaterhouseCoopers Inc., as our external auditors, have Africa, 2008 (the “Companies Act”), the JSE Listings item that could substantively affect the group’s ability to issued an unqualified audit opinion on our consolidated and Requirements, and the King Report on Corporate create value and influence the decisions of stakeholders. All separate financial statements. Governance for South Africa (“King IV”). This report covers items identified as being material by the board have been financial and non-financial performance of the group and disclosed in this report. -

Gateway Precinct) �����������������������!����
DOCK ROAD, VICTORIA AND ALFRED WATERFRONT (GATEWAY PRECINCT) ! V`1 :$"] 1J ` ^_`! `]R`Q` .V 1H R`R: `QJ0]7 G7 11 . 1HQCV `QJ$ 3G: VV1$J %$% VICTORIA & ALFRED GATEWAY PRECINCT HIA 1 1HQC::%I:JJ1J:QH1:QJ11 .1HQCV `QJ$ 30 8 "!0" 8 @RR7 ]8 8 1 VCQH:QJ ]8 8 1 R] ]8 8 V$`:IV1@ ]8 8 3:IV1@ ]8 8 VR7 ]8 8 "!"0!" 8 % H.R ]8 888 %`1:C$`R 888 3:QJ 8 `1.R^ R _ ]8 88 %`1:C$`R 888 3:QJ 8 `1.R^ R _ ]8 888 %`1:C$`R 888 3:QJ 8 3!"@"@"3"00 88 I V`RG7 ]8 8 %`1:C$`R`RR0V ]8 8 11QJ" % V ]8 8 !"@""0!!3 APPROVED PRECINCT PLAN 8 I V`RV7 ]8 8 11QJ " % V ]8 8 1%:CH07GR75 V`R75R ]8 .VV: 8 0VV6]`: V1:7R 1J `G 107R ]8 : `QJ8 8 " ]V :QJ ]8 8 !^07@]_ ]8 8 "00" 8 0]" % `Q``H.1 VH %`5:$0VV ]8 8 `:1C1 7 77 ]8 8 .V03RQJ ]8 VICTORIA & ALFRED GATEWAY PRECINCT HIA 2 1HQC::%I:JJ1J:QH1:QJ11 .1HQCV `QJ$ 8 !"@"03@3! 0[! 8 .V`V VJ` V`R7R" % V ]8 88 R`]]] VVG@ Q`V RQJ V6` :7 88 .V1J V$`:`7 ]G]]7 VI 88 .V`V VJ`0 R`QI .V:7 88 R`Q`:`H.:VQCQ$1H:C1J0V$:5R]]] VHQJV`0:QJ IVR75R ]V :8 8 .V`V VJ` 1V0 @7Q .VQQJ:7 ]8 @R 8 6]`: V1:7R : `QJ ]8 8 " V$`:07: `QJ ]8 8 0]G70 V63:IV1@]GRG707`0]Q1J ]8 RQQ`R RR0]: `QJ 8 00"!0" ]8 !0 ]8 7 Q`1H0V`0L "0 "7! "7!0"05 5" "07"!3!! "7" "7[!@"! "37!!! "@7"@!"0"35@ "7"@!"0"0 ""703"0 "_70"305 @ 3"@! 377 ]]]`0]Q1J.Q11J$ .VCQH:`@ V1:78 37 `@ V1:7]]Q6 V:`` V`R78 37@ V1:7VH1JH 370 5 5 5 3 7]`G757 7RQ`RQ .V1V`VJ$`:H. -

Accelerate Property Fund Limited March 2017 Roadshow
ACCELERATE PROPERTY FUND LIMITED MARCH 2017 ROADSHOW 1 EXECUTIVE SUMMARY • Continued focus on strategic nodes and building a portfolio of high-quality property assets Established track record of delivering on strategic objectives Recent value enhancing acquisitions, including Eden Meander (George, Western Cape) and the establishment of an offshore platform in Central and Eastern Europe (“European Strategy”) • Portfolio value of R11.1 billion, which represents a 32.3% growth on the March 2016 portfolio of R8.39 Successfully deployed capital raised billion • Value enhancing properties acquired under the European Strategy • Entered into agreements to purchase two new properties (“Acquisitions”) A building, anchored by Murray & Roberts Holdings (“Murray & Roberts”), with a 5,470m2 GLA, and Acquisitions introduce strategic assets a parking lot with 11,230m2 available bulk, situated in the Cape Town Foreshore (“Murray & Roberts with development potential into the Acquisition”) portfolio A building, anchored by Citibank (Johannesburg Branch) (“Citibank”) with a 12,433m2 GLA, situated in Sandton, Johannesburg (“Citibank Acquisition”) • The Acquisitions will be funded via a combination of debt and equity (up to approximately 58 million shares Capital raise to fund the Acquisitions currently available) 2 INVESTMENT CASE Successful execution of growth strategy to • 101% growth in property portfolio since listing in 2013, significantly improving portfolio quality date • As at 30 September 2016, the Accelerate portfolio held strong fundamentals: -

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC of SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA September Vol. 615 Pretoria, 2 2016 September No. 40240 PART 1 OF 2 LEGAL NOTICES A WETLIKE KENNISGEWINGS ISSN 1682-5843 N.B. The Government Printing Works will 40240 not be held responsible for the quality of “Hard Copies” or “Electronic Files” submitted for publication purposes 9 771682 584003 AIDS HELPLINE: 0800-0123-22 Prevention is the cure 2 No. 40240 GOVERNMENT GAZETTE, 2 SEPTEMBER 2016 WARNING!!! To all suppliers and potential suppliers of goods to the Government Printing Works The Government Printing Works would like to warn members of the public against an organised syndicate(s) scamming unsuspecting members of the public and claiming to act on behalf of the Government Printing Works. One of the ways in which the syndicate operates is by requesting quotations for various goods and services on a quotation form with the logo of the Government Printing Works. Once the official order is placed the syndicate requesting upfront payment before delivery will take place. Once the upfront payment is done the syndicate do not deliver the goods and service provider then expect payment from Government Printing Works. Government Printing Works condemns such illegal activities and encourages service providers to confirm the legitimacy of purchase orders with GPW SCM, prior to processing and delivery of goods. To confirm the legitimacy of purchase orders, please contact: Renny Chetty [email protected] (012) 748-6375 Anna-Marie du Toit [email protected] (012) 748-6292 Siraj Rizvi [email protected] (012) 748-6380 This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za STAATSKOERANT, 2 SEPTEMBER 2016 No. -

2016 REPORT and CAPE TOWN 01 in GENERAL EXECUTIVE SUMMARY Welcome to the Cape Town Central City, Within Ithe CCID’S Boundaries
1 01_SOCC16_PIC.indd 1 2017/04/09 10:48 PM INTRODUCING THE 2016 REPORT AND CAPE TOWN 01 IN GENERAL EXECUTIVE SUMMARY Welcome to the Cape Town Central City, within ithe CCID’s boundaries. These A major catalyst for this is expected to be and to the fifth edition of our annual “neighbourhoods”, in many ways, have the City of Cape Town’s Foreshore Freeway investment guide, this time looking at now evolved into their own personalities Precinct project, which has generated 2016 in review. and the business done within each of much discussion and interest both in how This publication is compiled and them has evolved as well. to incorporate affordable housing into the brought to you by the Cape Town Central The usual synopses still exist among CBD to ensure that it can provide homes City Improvement District (CCID), an this publication's pages, but as it has for all tiers of its economy, and as a model organisation that has been the custodian always been an investment guide to to relieve traffic congestion. of the city’s traditional CBD since 2000. assist investors to make well-informed At the end of the day, a downtown’s The economic growth and prosperity our decisions, we hope it will now assist success can only be measured in terms of downtown has witnessed in the past those decision makers, across the how it meets the demands of the people 17 years has been extremely gratifying, broadest economic spectrum, to drill who use it. To this end, we believe many but the rise in investor confidence we down to discover even more about the opportunities still exist, whether they lie have witnessed in just the past five CBD. -
Capital Expenditure Project Listing
CAPITAL EXPENDITURE PROJECT LISTING 1 January 1993 to 31 December 2015 NEDBANK GROUP ECONOMIC UNIT 16 March 2016 Comment: mixed-use development in Sedibeng worth R4,0 billion, the Menlyn Maine development precinct in The year 2015 was one of the most difficult for the South African economy, with weak global and Pretoria, worth R1,8 billion, and the final phase of the luxurious Umhlanga Pearl Sky in Durban, worth local demand, historically low global commodity prices, loadshedding, a sharp depreciation of the R1,3 billion. rand, as well as rising input costs, among other factors, weighing negatively on economic activity. These also hurt both consumer and business confidence. Although firms remained very cautious The transport, storage and communication sector announced 21 projects accounting for 25% of of committing to large-capacity expansion programmes, there was some improvement in capital the total and amounting to R21,3 billion, up from R8,9 billion in 2014. Most of the projects in this expenditure plans. Nedbank's Capital Expenditure Project Listing shows an increase in both sector involve the rehabilitation and construction of roads. The biggest project recorded in the second the number and value of projects announced in 2015. The projects amounted to R152,4 billion, up half was the Maluti-A-Phofung special economic zone (SEZ), worth R4,8 billion, which involves the from R58,6 billion in 2014. construction of a new 1 000 ha SEZ near Harrismith, which will provide road and rail logistics. It will Nedbank schedule: R billion (constant 2015 prices) Actual growth in capital formation % also act as a handling facility for the Gauteng–Durban port corridor and link it to the Bloemfontein– 1000 20 Cape Town corridor. -
Download the Mobimelk Grains Lower This Week, Because Zambian Onion Pro- Ing and Cooling Solutions for Dairy Businesses
ISSN 1028-1215 FOUNDED 1980 SA: R15.00 (Incl. VAT) JULY 2017 Golden Arrow fly Wooden homes boost 1 000 Gantry cranes supplied No stopping this bus. 3 Stalwart takes the helm. 13 Heavy lift champions. 19 A cuppa good Cape fortunes fall cheer HE Western Cape’s investment tycoons have seen billions of Rands Tin value wiped away by treacherous economic and political developments at home and abroad. Investors, of late, have endured tough times with the political will to grow a very sluggish local economy alarmingly absent. Sentiment has been further hammered by ominous political developments in South Africa – including the growing suspicions of state capture seemingly articulated in the 17 million contributed to com- replacement of respected finance minister munity upliftment over the Pravin Gordhan with untried Malusi Rpast decade has had far reach- Gigaba. ing effects for a local Cape community To make matters worse, those investors involved in the production of the lo- that in the last few years hoped to hedge cally found and proudly South African against an ailing and compromised South produce - rooibos tea. African economy are now finding that price Over 900 children have been posi- of externalising wealth is sometimes awfully tively influenced; 7 students have steep. Unexpected political developments completed tertiary studies with full like Brexit in the UK and the election of bursaries, with another 21 currently the blustering businessman Donald Trump studying with bursaries; 330 perma- as president of the USA has added nasty nent workers and 1500 seasonal work- complications to offshore forays by South ers have been positively impacted Africa investors – especially with the Rand – all through local tea manufacturer, showing a rare determination to strengthen Carmien Tea and its social uplift- against major global currencies. -

Nedbank Capital Expenditure Project Listing January 2021
Nedbank Capital Expenditure Project Listing January 2021 Economics | South Africa 135 Rivonia Road Campus 135 Rivonia Road Group Economic Unit: Sandton Johannes Khosa 2196 +27 10 234 8359 http://nedbankgroup.co.za [email protected] Table of content Part 1 : General trends in fixed investment Page 1.1 Long-term trends: Stuck on a downward slope 6 1.2 Long-term trends: Where did the weakness come from? 7 1.3 Long-term trends: Which assets are organisations investing in? 10 1.4 Recent developments 12 Part 2 : Nedbank Capital Expenditure Project Listing 2.1 How many new projects were announced in 2020? 13 2.2 Which institutions were the most active? 14 2.3 Which industries were featured strongly? 15 2.4 Conclusion and outlook 18 Part 3: Tables & Project Lists 3.1 Table 1: Announced projects per year in current prices 19 3.2 Table 2: Announced projects per year in constant prices 20 3.3 List of major new projects 21 2021/02/02 Nedbank Group Economic Unit 2 Some definitions & terminology 1.1 What is fixed investment? ▪ Fixed investment is spending on physical assets such buildings, infrastructure, plant, machinery and equipment, which adds to production capacity. ▪ Fixed investment is a flow concept, consisting of additions to the capital stock of a firm, a public enterprise or government. ▪ It can take two forms: ❖ Replacement investment maintains the existing capital stock, replacing depleted or fully depreciated assets. ❖ Expansionary investment allows for the production of more goods and services. These are projects that increase production capacity, such as new plants or infrastructure and expansions to existing operations. -

Companies - Maatskappye Notice 866 of 2008
COMPANIES - MAATSKAPPYE NOTICE 866 OF 2008 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY NOTICE IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973) THE FOLLOWING NOTICE RELATING TO INCORPORATION AND REGISTRATION OF COMPANIES, CONVERSIONS OF COMPANIES, REGISTRATION OF CHANGES OF NAMES, TRANSLATED AND SHORTENED FORMS OF NAMES. DEFENSIVE NAMES, REDUCTIONS OF CAPITAL AND DISSOLUTIONS IS PUBLISHED FOR GENERAL INFORMATION. THE ClPRO WEBSITE AT WWW.CIPRO.GOV.ZA CAN BE VISITED FOR MORE INFORMATION. NO GUARANTEE IS GIVEN IN RESPECT OF THE ACCURACY OF THE PARTICULARS FURNISHED AND NO RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR ERRORS AND OMISSIONS OR THE CONSEQUENCES THEREOF. R. J. MATHEKGA REGISTRAR OF COMPANIES - -. KENNISGEWING 866 VAN 2008 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID KENNISGEWING INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET 1973 (WET 61 VAN 1973) DIE VOLGENDE KENNISGEWING IN VERBAND MET INLYWING EN REGlSTRASlE VAN MAATSKAPPYE, OMSKEPPINGS VAN MAATSKAPPYE, REGI- STRASIE VAN NAAMSVERANDERINGE, VERTAALDE EN VERKORTE VORME VAN NAME, DEFENSIEWE NAME, VERMINDERINGS VAN KAPITAAL EN ONTBlNDlNGS WORD VIR ALGEMENE INLIGTING BEKEND GEMAAK. DIE ClPRO WEBTUISTE BY WWW.CIPRO.GOV.ZA KAN BESOEK WORD VIR MEER INLIGTING. GEEN WAARBORG TEN OPSIGTE VAN DIE JUlSTHElD VAN DIE BESONDERHEDE VERSTREK, WORD GEGEE NIE EN GEEN VERANTWOORDELIKHEID VIR FOUTE EN WEGLATINGS OF DIE GEVOLGE DAARVAN WORD AANVAAR NIE. R. J. MATHEKGA REGISTRATEUR VAN MAATSKAPPYE Incorporation and Registration of Companies lnlywing en Registrasie van Maatskappye From 01105i2008 To 31/05/2008 Van 0110512008 Tot 31i0512008 Registration