Checkliste Und Rote Liste Der Wanzen Der Steiermark (Insecta: Heteroptera)1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gattung Brachycoleus F , 1858
Gattung Brachycoleus F, 1858 Von den neun paläarktischen Arten kommen zwei im Gebiet vor. Brachycoleus decolor R, 1887 6,5-9,1 mm. Abb. 51, 52. Östliche Art, deren Areal aus dem sibirisch-zentralasiatischen Bereich über Russland bis in den nördlichen Mittelmeerraum und nach Mitteleuropa reicht. In Deutschland nur im Osten (von Ostmecklenburg bis Sachsen) und im Süden, sie fehlt im Westen nördlich der Mainlinie. Selten. In Österreich vor allem in den Tieflagen im Osten, dort lokal häufig. B. decolor lebt auf verschiedenen Apiaceae, vor allem an größeren Arten wie z. B. Peuceda- num oreoselinum oder Pastinaca sativa, aber auch auf Eryngium campestre. Die Art ist nur an warmen, sonnigen Standorten zu erwarten, sowohl auf Kalk- als auch auf Sandböden, vor allem die Erwachsenen halten sich meist auf den Blütenständen ihrer Wirtspflanzen auf. Die Ernährungsweise ist zoophytophag bis vorwiegend zoophag. Außer auf Apiaceae werden Ima- gines auch öfters auf Euphorbia und Centaurea gefunden. Die Überwinterung findet als Ei statt. Die Imagines werden von Ende Mai bis Juli gefunden, im August und September nur noch vereinzelte Weibchen. Abb. 51. Brachycoleus decolor 58 59 Abb. 52. Brachycoleus decolor, Larve. Brachycoleus pilicornis (P, 1805) 5,9-7,5 mm. Abb. 53. Eine paläarktische Art, die von der kaspischen Region bis in das nörd- liche Mittelmeergebiet und Mitteleuropa vorkommt. In Europa hat sie einen südöstlichen Verbreitungsschwerpunkt. In Deutschland im Süden stellenweise häufiger, nach Norden deutlich seltener werdend, im Norddeutschen Tiefland fehlend. In Österreich nur verstreute Nachweise und seit 1950 nicht mehr gefunden. B. pilicornis lebt an trockenwarmen Standorten (Kalk- und Sandböden) auf Euphorbia-Arten (bevorzugt auf E. -

Súčasný Stav Poznania Bzdôch (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Na Poľskej a Slovenskej Strane Pohoria Pienin
Pieniny – Przyroda i Człowiek 15: 65–82 (2018) Súčasný stav poznania bzdôch (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) na poľskej a slovenskej strane pohoria Pienin Present knowledge of true bugs (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) in the Polish and Slovak sides of the Pieniny Mts. Vladimír Hemala Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika; e-mail: [email protected] Abstract. True bugs are relatively poorly known in the Pieniny Mts., while, significantly better situation is in the Polish part of the mountains where 263 species have been known until now. Unfortunately, only 34 species had been recorded from the Slovak part of the Pieniny Mts. until 2017. During the last short survey in 2017, which took place within XLI. East Slovak Camp of Environmentalists, 54 previously unrecorded species were examined increasing the number of species known from the Slovak part of Pieniny Mts. to 88. The total number of species in Polish and Slovak parts of the Pieniny Mts. reaches as many as 272. Key words: Heteroptera, Poland, Slovakia, Carpathians, Pieniny Mts., faunistics ÚVOD 2000; Hoberlandt 1977; Biesiadka 1979; Bazyluk, Liana 1982; Lis 1988, 1989a, b, 1990a, b; Gor- Pohorie Pienin je súčasťou Západných Karpát czyca 1991, 1992, 2004, 2007; Skórka 1995; Lis a leží na slovensko-poľskom pomedzí. Väčšina 1996, 2001; Stroiński 2001; Gorczyca, Chłond územia pohoria patrí do pôsobnosti dvoch národ- 2005; Lis, Lis 2009; Gorczyca, Wolski 2011; Lis ných parkov: Pieninský národný park (PIENAP) et al. 2012; Hebda, Ścibior 2013, 2016; Doma- na slovenskej strane a Pieniński Park Narodowy gała, Ziaja 2016; Taszakowski, Gierlasiński 2017; (PPN) na poľskej strane. -

Spermathecae Morphology in Four Species of Eurydema Laporte, 1833 (Heteroptera: Pentatomidae) from Turkey: a Scanning Electron M
Journal of Entomology and Zoology Studies 2014; 2 (3): 206-213 ISSN 2320-7078 Spermathecae morphology in Four Species of JEZS 2014; 2 (2): 206-213 © 2014 JEZS Eurydema Laporte, 1833 (Heteroptera: Received: 30-04-2014 Accepted: 21-06-2014 Pentatomidae) from Turkey: A Scanning Electron Selami Candan Microscope Study Gazi University, Science Faculty, Department of Biology, 06500, Ankara, Turkey, Selami Candan, Mahmut Erbey, Nurcan Özyurt and Zekiye Suludere Mahmut Erbey ABSTRACT Ahi Evran University, Arts and The spermathecae of four species of Eurydema (E. fieberi Schummel 1837, E. oleraceum (Linnaeus 1758), Science Faculty, Department of E. ornatum (Linnaeus, 1758), and E. spectabilis Horváth, 1882) were compared using both light and Biology, Kırşehir, Turkey scanning electron microscope (SEM) images. All the spermathecae which are examined species are contains spermathecal bulb (reservoir), a pumping region, distal and proximal flanges, proximal and distal Nurcan Özyurt spermathecal ducts, dilation of spermathecal duct and a genital chamber with two ring sclerites. Gazi University, Science Faculty, Spermathecal bulb shape is changed from oval or oblong (E. fieberi) semi –oblong (E. oleraceum, E. Department of Biology, 06500 ornatum) ,and semi-spherical (E. spectabilis). Distal and proximal flanges of four species of Eurydema Ankara, Turkey, have strongly sclerotized and median spermathecal dilations a resemble balloons and sclerotized rods are present. Generally, in all species proximal spermathecal duct is long with muscular surface. Zekiye Suludere Gazi University, Science Faculty, Keywords: Heteroptera, Pentatomidae, Eurydema, Spermatheca, light and scanning electron microscope Department of Biology, 06500 (SEM). Ankara, Turkey, 1. Introduction The spermatheca is an accessory female reproductive organ that occurs in all orders of insects except for Protura and Collembola [29]. -
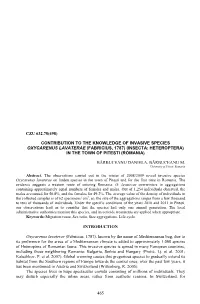
2. Lawrence, J.F., Newton, A.F. Families and Subfamilies of Coleoptera (With Selected Genera, Notes, References and Data on Family-Group Names)
2. Lawrence, J.F., Newton, A.F. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names). In: Pakaluk, J., Slipinski, S. A. (Eds.), Biology, phylogeny and classification of Coleoptera: papers celebrating the 80th birthday of Roy A. Crowson. 1995. Vol. 2. Museum i Instytut Zoologii PAN, Warsaw, pp. 779-1006 3. Majerus, M.E.N. Ladybirds. London: Harper Collins, 1994. 359 p. ISBN 0-00-219935 - 1 4. MКУФКăC.G.ăТă MМCШЫqЮШНКХОăD.B.ă – Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of the Atlantic Maritime Ecozone. In: Assessment of Species Diversity in the Atlantic Maritime Ecozone. Canada, Ottawa: D.F. McAlpine and I.M. Smith. NRC Research Press, 2010. pp. 436 – 452, 5. Thalji R. Composition of Coccinellid Comunities in Suger Beet Fields in Vojvidina. In: Proc. Nat. Sci., Matica Srpska Novi Sad. 2006. no. 110, pp. 267 – 273 6. Vandenberg N.J. Coccinellidae Latreille 1807. In: Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., Frank, J.H. (Eds.), American Beetles. CRC Press, Boca Raton, 2002. pp. 371-389 7. VьЫЭОТЮă AЧКă – Maria, Grozea IШКЧК,ă ЭОПă RКЦШЧК,ă VХКНă M.,ă DШЛЫТЧă IШЧОХК. Faunistic study of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) in the Banat region, Romania. In: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Agriculture, 2015. vol. 72 (ьЧăМЮЫЬăНОăКЩКЫТТО) CZU 632.78(498) CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF INVASIVE SPECIES OXYCARENUS LAVATERAE (FABRICIUS, 1787) (INSECTA: HETEROPTERA) IN THE TOWN OF PITESTI (ROMANIA) BRBUCEANUăDANIELA,ăBRBUCEANUăM. UЧТЯОrЬТЭвăШПăPТЭОşЭТ,ăRШЦКЧТК Abstract. The observations carried out in the winter of 2008/2009 reveal invasive species Oxycarenus lavaterae ШЧă ХТЧНОЧă ЬЩОМТОЬă ТЧă ЭСОă ЭШаЧă ШПă PТЭОşЭТă КЧНă ПШЫă ЭСОă ПТЫЬЭă ЭТЦОă ТЧă RШЦКЧТК.ă TСОă evidence suggests a western route of entering Romania. -

Proceedings of the Thirty-Sixth Meeting of the Canadian Forest Genetics Association
PROCEEDINGS OF THE THIRTY-SIXTH MEETING OF THE CANADIAN FOREST GENETICS ASSOCIATION PART 1 Minutes and Member’s Reports PART 2 Symposium Applied Forest Genetics – Where do we want to be in 2049? Génétique forestière appliquée - où voulons-nous être en 2049? COMPTES RENDUS DU TRENTE-SIXIÈME CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE GÉNÉTIQUE FORESTIÈRE 1re PARTIE Procès-verbaux et rapports des membres 2e PARTIE Colloque National Library of Canada cataloguing in publication data Canadian Forest Genetics Association. Meeting (36th : 2019 : Lac Delage, QC) Proceedings of the Thirty-sixth Meeting of the Canadian Forest Genetics Association Includes preliminary text and articles in French. Contents: Part 1 Minutes and Member's Reports. Part 2 Symposium CODE TO BE DETERMINED CODE TO BE DETERMINED 1 Forest genetics – Congresses. 2 Trees – Breeding – Congresses. 3 Forest genetics – Canada – Congresses. I Atlantic Forestry Centre II Title: Applied Forest Genetics – Where do we want to be in 2049? III Title: Proceedings of the Thirty-sixth Meeting of the Canadian Forest Genetics Association Données de catalogage avant publication de la Bibliothèque nationale du Canada L'Association canadienne de génétique forestière. Conférence (36e : 2019 : Lac Delage, QC) Comptes rendus du trente-sixième congrès de l'Association canadienne de génétique forestière Comprend des textes préliminaires et des articles en français. Sommaire : 1re partie Procès-verbaux et rapports des membres. 2e partie Colloque CODAGE CODAGE 1 Génétiques forestières – Congrès. 2 Arbres – Amélioration – Congrès. 3 Génétiques forestières – Canada – Congrès. I Centre de foresterie de l’Atlantique II Titre : Génétique forestière appliquée - où voulons-nous être en 2049? III Titre : Comptes rendus du trente-sixième congrès de l'Association canadienne de génétique forestière PROCEEDINGS OF THE THIRTY-SIXTH MEETING OF THE CANADIAN FOREST GENETICS ASSOCIATION PART 1 Minutes and members’ reports Lac Delage, Quebec August 19 – 23, 2019 Editors D.A. -

Malaise-Hyönteispyynti Lapin Suojelualueilla 2012–2014
Jukka Salmela, Stefan Siivonen, Patrycja Dominiak, Antti Haarto, Kai Heller, Juhani Kanervo, Petri Martikainen, Matti Mäkilä, Lauri Paasivirta, Aki Rinne, Juha Salokannel, Guy Söderman ja Pekka Vilkamaa Malaise-hyönteispyynti Lapin suojelualueilla 2012–2014 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 221 Jukka Salmela, Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, jukka.salmela(at)metsa.fi Stefan Siivonen, Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, stefan.siivonen(at)metsa.fi Patrycja Dominiak, Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, University of Gdansk, heliocopris(at)gmail.com Antti Haarto, Mietoinen, ahaarto(at)gmail.com Kai Heller, Quickborn, kaiheller(at)gmx.de Juhani Kanervo, Turku, jussi.kanervo(at)luukku.com Petri Martikainen, Juva, petri.martikainen(at)uef.fi Matti Mäkilä, Rovaniemi, makila.entomology(at)gmail.com Lauri Paasivirta, Salo, lauri.paasivirta(at)suomi24.fi Aki Rinne, Helsinki, aki.rinne(at)pintakasittelytekniikka.fi Juha Salokannel, Tampere, juha.salokannel(at)gmail.com Guy Söderman, Helsinki, guy.soderman(at)pp.inet.fi Pekka Vilkamaa, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, pekka.vilkamaa(at)helsinki.fi Kansikuva: Malaise-pyydys Pallas–Yllästunturin kansallispuiston Röyninkurussa 2013. Lähteisten latvapurojen varret, varsinkin sellaiset joita ympäröi luonnontilainen havu- metsä, ovat monimuotoisia elinympäristöjä. Tältä paikalta havaittiin mm. Euroopalle uusi sienissääskilaji Mycetophila monstera, erittäin harvinainen pikkuvaaksiainen ou- taruskokirsikäs (Limonia messaurea) ja pohjoinen surviaissääski -

Annotated Checklist of the Plant Bug Tribe Mirini (Heteroptera: Miridae: Mirinae) Recorded on the Korean Peninsula, with Descriptions of Three New Species
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGYENTOMOLOGY ISSN (online): 1802-8829 Eur. J. Entomol. 115: 467–492, 2018 http://www.eje.cz doi: 10.14411/eje.2018.048 ORIGINAL ARTICLE Annotated checklist of the plant bug tribe Mirini (Heteroptera: Miridae: Mirinae) recorded on the Korean Peninsula, with descriptions of three new species MINSUK OH 1, 2, TOMOHIDE YASUNAGA3, RAM KESHARI DUWAL4 and SEUNGHWAN LEE 1, 2, * 1 Laboratory of Insect Biosystematics, Department of Agricultural Biotechnology, Seoul National University, Seoul 08826, Korea; e-mail: [email protected] 2 Research Institute of Agriculture and Life Sciences, Seoul National University, Korea; e-mail: [email protected] 3 Research Associate, Division of Invertebrate Zoology, American Museum of Natural History, New York, NY 10024, USA; e-mail: [email protected] 4 Visiting Scientists, Agriculture and Agri-food Canada, 960 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1A, 0C6, Canada; e-mail: [email protected] Key words. Heteroptera, Miridae, Mirinae, Mirini, checklist, key, new species, new record, Korean Peninsula Abstract. An annotated checklist of the tribe Mirini (Miridae: Mirinae) recorded on the Korean peninsula is presented. A total of 113 species, including newly described and newly recorded species are recognized. Three new species, Apolygus hwasoonanus Oh, Yasunaga & Lee, sp. n., A. seonheulensis Oh, Yasunaga & Lee, sp. n. and Stenotus penniseticola Oh, Yasunaga & Lee, sp. n., are described. Eight species, Apolygus adustus (Jakovlev, 1876), Charagochilus (Charagochilus) longicornis Reuter, 1885, C. (C.) pallidicollis Zheng, 1990, Pinalitopsis rhodopotnia Yasunaga, Schwartz & Chérot, 2002, Philostephanus tibialis (Lu & Zheng, 1998), Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 1794), Yamatolygus insulanus Yasunaga, 1992 and Y. pilosus Yasunaga, 1992 are re- ported for the fi rst time from the Korean peninsula. -

PP Elm Seed Bug, Arocatus Melanocephalus: an Exotic Invasive
Elm seed bug, Arocatus melanocephalus: an exotic invasive pest new to the U.S. Idaho State Department of Agriculture In summer 2012, the elm seed bug (ESB), an invasive insect new to the U.S., was first identified from specimens collected in Ada and Canyon counties in Idaho. During 2013 it was found to have spread to Elmore, Gem, Owyhee, Payette, and Washington counties as well as Malheur County, Oregon. Commonly distributed in south-central Europe, ESB feeds primarily on the seeds of elm trees, although they have also been collected from oak and linden trees in Europe. The insect does not damage trees or buildings, nor does it present any threat to human health. However, due to its habit of entering houses and other buildings in large numbers to escape the summer heat and later to Adult elm seed bugs overwinter, it can be a significant nuisance to ISDA photo homeowners. Elm seed bug biology Elm seed bugs spend the winter as hibernating adults, mate during the spring and lay eggs on elm trees. Immature ESB feed on elm seeds from May through June becoming adults by early summer. Elm seed bugs are most noticeable in springtime as overwintering ESB begin to emerge inside buildings and try to escape, during hot periods in the summer when ESB attempt to enter buildings to get away from the heat, and in the autumn when they enter buildings to overwinter. When disturbed or crushed, the bugs produce Current reported range of Elm Seed Bug in the US an unpleasant odor. Map from USDA APHIS PPQ PP Photos courtesy of Charles Olsen, USDA APHIS PPQ – Bugwood.org Identification Elm seed bug belongs to the order Hemiptera (the “true bugs”) and is related to the boxelder bug and stink bug. -

Ploštice (Heteroptera) Chráněné Krajinné Oblasti Kokořínsko True Bugs (Heteroptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area
Bohemia centralis, Praha, 27: 267–294, 2006 Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko True bugs (Heteroptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Josef Bryja1, 2 a Petr Kment 3, 4 1 Oddělení populační biologie, Ústav biologie obratlovců AV ČR, CZ - 675 02 Studenec 122, Česká republika; e-mail: [email protected] 2 Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, CZ - 611 37 Brno, Česká republika 3 Entomologické oddělení, Národní muzeum, Kunratice 1, CZ - 148 00 Praha, Česká republika; e-mail: [email protected] 4 Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, CZ - 128 44 Praha, Česká republika ▒ Abstract. Faunistic research of true bugs (Heteroptera) in the Kokořínsko Protected Landsape Area (PLA) received only little attention in the past (data on only 22 species were published). Here, we summarize both published and comprehensive recent faunistic data on the true bugs occurring in the PLA. The heteropteran fauna of the PLA Kokořínsko now comprises 305 species (35.6% of species occurring in the Czech Republic) and is characterized by the occurrence of rare species living in well preserved xerothermic or wetland habitats. The observed species richness is slightly higher than that of similarly studied protected areas in the Czech Republic. Twenty one species (6.9% of recorded species richness) is included in the Redlist of the Czech Heteroptera and those species prefer habitats already protected in natural reserves. ▒ Key words: faunistics, Heteroptera, Czech Republic, Bohemia, true bugs, nature conservation 267 BOHEMIA CENTRALIS 27 Úvod a historie výzkumu Přestože více či méně systematický faunistický výzkum ploštic v Čechách započal už v 70. -

Proje Sahibi T.C
Proje Sahibi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Projenin Adı Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi Projenin Yeri Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Raporu Hazırlayan Kuruluş AKS Planlama Mühendislik Ltd. Şti. Adresi Cinnah Cad. Willy Brant Sok. 2/11 Çankaya/ANKARA Telefonu ve Faks Numarası 0312 440 23 20 / 0312 438 19 16 Rapor Sunum Tarihi 25 Nisan 2012 i FETHİYE-GÖCEK ÖÇKB KARASAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU AKS PLANLAMA PROJE EKİBİ: Bitki Sosyolojisi Uzmanı: Prof. Dr. Hayri DUMAN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Ekoloji Uzmanı: Prof. Dr. Zeki AYTAÇ, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Bitki Sistematiği Uzmanı: Prof. Dr. Murat EKİCİ, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Memeli Uzmanı: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Kuş Uzmanı: Doç. Dr. Zafer AYAŞ, Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Sürüngen Uzmanı: Prof. Dr. Yusuf KUMLUTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Omurgasız Uzmanı: Yrd. Doç. Dr. Orhan MERGEN, Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Hidrojeoloji Uzmanı: Yrd. Doç. Dr. Erkan DİŞLİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Uzmanı: Umut CIRIK, Şehir ve Bölge Plancısı TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Proje Kontrol Teşkilatı: Süreyya IŞIKLAR-Biyolog Nisa Nur ÇiÇEK-Biyolog Tuba TOPRAK- Biyolog Muayene Kabul Komisyonu: Ayhan TOPRAK- Biyolog Leyla AKDAĞ- Şube Md. V. Eyüp YÜKSEL- Biyolog ii FETHİYE-GÖCEK ÖÇKB KARASAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU ÖNSÖZ Uluslararası Koruma Sözleşmeleri ve Çevre Mevzuatı da dikkate alınarak Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla her türlü icraatta bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır. -

Key for the Separation of Halyomorpha Halys (Stål)
Key for the separation of Halyomorpha halys (Stål) from similar-appearing pentatomids (Insecta : Heteroptera : Pentatomidae) occuring in Central Europe, with new Swiss records Autor(en): Wyniger, Denise / Kment, Petr Objekttyp: Article Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society Band (Jahr): 83 (2010) Heft 3-4 PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-403015 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das -

ICDPP București - Specii Invazive În România
ICDPP București - Specii Invazive în România Alina - Gabriela Geicu PLOȘNIȚA SEMINȚELOR DE TEI - OXYCARENUS LAVATERAE Încadrare sistematică: Regn: Animalia Încrengătura: Arthropoda Clasa: Insecta Ordin: Hemiptera Famila: Lygaeidae Gen: Oxycarenus Specia: Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) Răspândire: În ultima vreme, ploșnița semințelor de tei sau ploșnita Mediteraneană (Oxycarenus lavaterae) își face tot mai simțită prezența în zona urbană, pe trunchiul pomilor de tei din parcuri sau aliniamente stradale. Ploșnița este o specie invazivă originară din zona vest Mediteraneană, de unde și numele de ploșnita Mediteraneană. O. lavaterae s-a răspândit rapid cu populații masive în regiunea Fig. 1. Oxycarenus lavaterae Palearctică, din nord-vestul continentului African până în vestul Europei. În Europa este răspândită în majoritatea țărilor din est, centru și sud-est. În ultimii 20 de ani ploșnița s-a răspândit spre nord și a fost găsită în Muntenegru (1985), Ungaria (1994), Slovacia (1995), Serbia (1996), Bulgaria (1998), Nordul Franței (1999), Austria (2001), Elveția de Nord (2002), Finlanda (2003), Republica Cehă (2004), Germania (2004), România (2008) și Republica Moldova (2016). Principalele căi de pătrundere a dăunătorului în zone noi libere: Căile posibile de pătrundere a ploșniței teiului din zonele unde specia există în zone libere sunt accentuate de comerțul și schimbul de material săditor din speciile gazdă afectate. În plus, iernile cu temperaturi blânde, așa cum sunt de ceva vreme, permit supraviețuirea populațiilor peste iarnă întărind rezerva biologică a dăunătorului (Derjanschi & Elisoveţcaia, 2017). Distribuție în România: Prima semnalare a speciei în România a fost în 2008 pe specii de tei din orașul Pitești (Bărbuceanu, 2012). În 2009, specia a fost observată și în regiunea Banatului.