Das Punische Im Römischen Reich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bibliography
Bibliography Many books were read and researched in the compilation of Binford, L. R, 1983, Working at Archaeology. Academic Press, The Encyclopedic Dictionary of Archaeology: New York. Binford, L. R, and Binford, S. R (eds.), 1968, New Perspectives in American Museum of Natural History, 1993, The First Humans. Archaeology. Aldine, Chicago. HarperSanFrancisco, San Francisco. Braidwood, R 1.,1960, Archaeologists and What They Do. Franklin American Museum of Natural History, 1993, People of the Stone Watts, New York. Age. HarperSanFrancisco, San Francisco. Branigan, Keith (ed.), 1982, The Atlas ofArchaeology. St. Martin's, American Museum of Natural History, 1994, New World and Pacific New York. Civilizations. HarperSanFrancisco, San Francisco. Bray, w., and Tump, D., 1972, Penguin Dictionary ofArchaeology. American Museum of Natural History, 1994, Old World Civiliza Penguin, New York. tions. HarperSanFrancisco, San Francisco. Brennan, L., 1973, Beginner's Guide to Archaeology. Stackpole Ashmore, w., and Sharer, R. J., 1988, Discovering Our Past: A Brief Books, Harrisburg, PA. Introduction to Archaeology. Mayfield, Mountain View, CA. Broderick, M., and Morton, A. A., 1924, A Concise Dictionary of Atkinson, R J. C., 1985, Field Archaeology, 2d ed. Hyperion, New Egyptian Archaeology. Ares Publishers, Chicago. York. Brothwell, D., 1963, Digging Up Bones: The Excavation, Treatment Bacon, E. (ed.), 1976, The Great Archaeologists. Bobbs-Merrill, and Study ofHuman Skeletal Remains. British Museum, London. New York. Brothwell, D., and Higgs, E. (eds.), 1969, Science in Archaeology, Bahn, P., 1993, Collins Dictionary of Archaeology. ABC-CLIO, 2d ed. Thames and Hudson, London. Santa Barbara, CA. Budge, E. A. Wallis, 1929, The Rosetta Stone. Dover, New York. Bahn, P. -

Lucan's Natural Questions: Landscape and Geography in the Bellum Civile Laura Zientek a Dissertation Submitted in Partial Fulf
Lucan’s Natural Questions: Landscape and Geography in the Bellum Civile Laura Zientek A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington 2014 Reading Committee: Catherine Connors, Chair Alain Gowing Stephen Hinds Program Authorized to Offer Degree: Classics © Copyright 2014 Laura Zientek University of Washington Abstract Lucan’s Natural Questions: Landscape and Geography in the Bellum Civile Laura Zientek Chair of the Supervisory Committee: Professor Catherine Connors Department of Classics This dissertation is an analysis of the role of landscape and the natural world in Lucan’s Bellum Civile. I investigate digressions and excurses on mountains, rivers, and certain myths associated aetiologically with the land, and demonstrate how Stoic physics and cosmology – in particular the concepts of cosmic (dis)order, collapse, and conflagration – play a role in the way Lucan writes about the landscape in the context of a civil war poem. Building on previous analyses of the Bellum Civile that provide background on its literary context (Ahl, 1976), on Lucan’s poetic technique (Masters, 1992), and on landscape in Roman literature (Spencer, 2010), I approach Lucan’s depiction of the natural world by focusing on the mutual effect of humanity and landscape on each other. Thus, hardships posed by the land against characters like Caesar and Cato, gloomy and threatening atmospheres, and dangerous or unusual weather phenomena all have places in my study. I also explore how Lucan’s landscapes engage with the tropes of the locus amoenus or horridus (Schiesaro, 2006) and elements of the sublime (Day, 2013). -

Foreign Influences and Consequences on the Nuragic
FOREIGN INFLUENCES AND CONSEQUENCES ON THE NURAGIC CULTURE OF SARDINIA A Thesis by MARGARET CHOLTCO Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS December 2009 Major Subject: Anthropology FOREIGN INFLUENCES AND CONSEQUENCES ON THE NURAGIC CULTURE OF SARDINIA A Thesis by MARGARET CHOLTCO Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS Approved by: Chair of Committee, Shelley Wachsmann Committee Members, Deborah N. Carlson Steven Oberhelman Head of Department, Donny L. Hamilton December 2009 Major Subject: Anthropology iii ABSTRACT Foreign Influences and Consequences on the Nuragic Culture of Sardinia. (December 2009) Margaret Choltco, B.A., The Pennsylvania State University Chair of Advisory Committee: Dr. Shelley Wachsmann Although it is accepted that Phoenician colonization occurred on Sardinia by the 9th century B.C., it is possible that contact between Sardinia‟s indigenous population and the Levantine region occurred in the Late Bronze Age (LBA). Eastern LBA goods found on the island are copper oxhide ingots and Aegean pottery. Previously, it has been suggested that Mycenaeans were responsible for bringing the eastern goods to Sardinia, but the presence of Aegean pottery shards does not confirm the presence of Mycenaean tradesmen. Also, scholars of LBA trade have explained the paucity of evidence for a Mycenaean merchant fleet. Interpretations of two LBA shipwrecks, Cape Gelidonya and Uluburun, indicate that eastern Mediterranean merchants of Cypriot or Syro-Canaanite origin, transported large quantities of oxhide ingots from the Levant towards the west. -

Warships of the First Punic War: an Archaeological Investigation
WARSHIPS OF THE FIRST PUNIC WAR: AN ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION AND CONTRIBUTORY RECONSTRUCTION OF THE EGADI 10 WARSHIP FROM THE BATTLE OF THE EGADI ISLANDS (241 B.C.) by Mateusz Polakowski April, 2016 Director of Thesis: Dr. David J. Stewart Major Department: Program in Maritime Studies of the Department of History Oared warships dominated the Mediterranean from the Bronze Age down to the development of cannon. Purpose-built warships were specifically designed to withstand the stresses of ramming tactics and high intensity impacts. Propelled by the oars of skilled rowing crews, squadrons of these ships could work in unison to outmaneuver and attack enemy ships. In 241 B.C. off the northwestern coast of Sicily, a Roman fleet of fast ramming warships intercepted a Carthaginian warship convoy attempting to relieve Hamilcar Barca’s besieged troops atop Mount Eryx (modern day Erice). The ensuing naval battle led to the ultimate defeat of the Carthaginian forces and an end to the First Punic War (264–241 B.C.). Over the course of the past 12 years, the Egadi Islands Archaeological Site has been under investigation producing new insights into the warships that once patrolled the wine dark sea. The ongoing archaeological investigation has located Carthaginian helmets, hundreds of amphora, and 11 rams that sank during the course of the battle. This research uses the recovered Egadi 10 ram to attempt a conjectural reconstruction of a warship that took part in the battle. It analyzes historical accounts of naval engagements during the First Punic War in order to produce a narrative of warship innovation throughout the course of the war. -

Death Ritual in Punic Malta Nicholas C
A face from the past: death ritual in Punic Malta Nicholas C. Vella Era il torrido agosto del 1993 quando incontrai funeral chamber was cut at each end at the bottom. per la prima volta il Professor Giovanni Tore. The chamber to the west, had the slab sealing the Appena ventenne, ero stato mandato in Sardegna entrance still in situ. Red soil had penetrated into the chamber to a small extent. The tomb had been dall’Università di Malta per conoscere in prima used over and over again and the various groups of persona i resti fenicio-punici dell’isola. Il Professore pottery deposited with the dead could be seen as left mi ospitò a Cabras dove ho incontrato alcuni dei by those who sealed the tomb after the last burial suoi colleghi e allievi sommersi da libri e lavoro. Era ceremony. A peculiar feature of this tomb were l’inizio di quella che sarebbe diventata nei successivi the recesses cut in the wall for the preservation of quattro anni un’amicizia profonda. Il Ferragosto lo funeral pottery, and a ledge of rock left all along the tomb for the deposition of the body. This kind passammo in gita a Cagliari e nel pomeriggio andammo of funeral couch, 7ʹ3ʺ [2.21 m] long, was quite a visitare la necropoli di Tuvixeddu. Una delle tombe, plain except for a raised protuberance at one end sopra il portello, presentava in bassorilievo una on which a human face was roughly carved. The rappresentazione gorgonica. «Dovresti studiarli», skeleton of a male body was found laying [sic] on rispose al mio commento sul fatto che in alcune this couch with the head just behind the carved face. -
![An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography](https://docslib.b-cdn.net/cover/8605/an-atlas-of-antient-i-e-ancient-geography-1938605.webp)
An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography
'V»V\ 'X/'N^X^fX -V JV^V-V JV or A?/rfn!JyJ &EO&!AElcr K T \ ^JSlS LIBRARY OF WELLES LEY COLLEGE PRESENTED BY Ruth Campbell '27 V Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries http://www.archive.org/details/atlasofantientieOObutl AN ATLAS OP ANTIENT GEOGRAPHY BY SAMUEL BUTLER, D.D. AUTHOR OF MODERN AND ANTJENT GEOGRAPHY FOR THE USE OF SCHOOLS. STEREOTYPED BY J. HOWE. PHILADELPHIA: BLANQHARD AND LEA. 1851. G- PREFATORY NOTE INDEX OF DR. BUTLER'S ANTIENT ATLAS. It is to be observed in this Index, which is made for the sake of complete and easy refer- ence to the Maps, that the Latitude and Longitude of Rivers, and names of Countries, are given from the points where their names happen to be written in the Map, and not from any- remarkable point, such as their source or embouchure. The same River, Mountain, or City &c, occurs in different Maps, but is only mentioned once in the Index, except very large Rivers, the names of which are sometimes repeated in the Maps of the different countries to which they belong. The quantity of the places mentioned has been ascertained, as far as was in the Author's power, with great labor, by reference to the actual authorities, either Greek prose writers, (who often, by the help of a long vowel, a diphthong, or even an accent, afford a clue to this,) or to the Greek and Latin poets, without at all trusting to the attempts at marking the quantity in more recent works, experience having shown that they are extremely erroneous. -
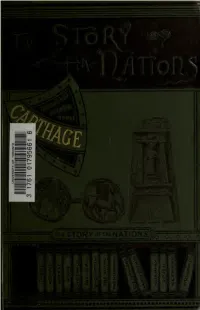
The Story of Carthage, Because One Has to Tell It Without Sympathy, and from the Standpoint of Her Enemies
li^!*^'*,?*^','. K lA, ZT—iD v^^ )A Cfce ®tor? of tfte iSations. CARTHAGE THE STORY OF THE NATIONS. Large Crown 8vo, Cloth, Illustrated, ^s. 1. ROME. Arthur Oilman, M.A. 2. THE JEWS. Prof. J. K. Hosmer. 3. GERMANY. Rev. S. Baring-Gould, M.A. 4. CARTHAGE. Prof. A. J. Church. 5. ALEXANDER'S EMPIRE. Prof. J. P. Mahaffy. 6. THE MOORS IN SPAIN. Stanley Lane-Poole. 7. ANCIENT EGYPT. Canon Raw- LINSON. 8. HUNGARY. Prof. A. Vambery. 9. THE SARACENS. A. Oilman, M.A. 10. IRELAND. Hon. Emily Lawless. 11. THE GOTHS. Henry Bradley. 12. CHALD^A. Z. A. Ragozin. 13. THE TURKS. Stanley Lane-Poole. 14. ASSYRIA. Z. A. Ragozin. 15. HOLLAND. Prof. J. E. Thorold Rogers. 16. PERSIA. S.W.Benjamin. London ; T. PISHEE UNWIN, 2 6, Paternoster Square, E.G. CARTHAGE OR THE EMPIRE OF AFRICA ALFRED J. CHURCH, M.A. '* PROFESSOR OF LATIN IN UNIVERSITY COLLEGE, LONDON, AUTHOR OP STORIES FROM HOMER," ETC., ETC. WITH THE COLLABORA TION OF ARTHUR OILMAN, M.A. THIRD EDITION, gtrnhon T. FISHER UNWIN 26 PATERNOSTER SQUARE NEW YORK : O. P. PUTNAM'S SONS MDCCCLXXXVII SEEN BY PRESERVATION SERVICES M } 7 4Q«^ Entered at Stationers' Hall By T. fisher UNWIN. Copyright by G. P. Putnam's Sons, 1886 (For the United States of America), PREFACE. It is difficult to tell the story of Carthage, because one has to tell it without sympathy, and from the standpoint of her enemies. It is a great advantage, on the other hand, that the materials are of a manage- able amount, and that a fairly complete narrative may be given within a moderate compass. -

Greek-Levantine Cultural Exchange in Orientalising and Archaic Pottery Shapes
doi: 10.2143/AWE.10.0.2141813 AWE 10 (2011) 11-42 GREEK-LEVANTINE CULTURAL EXCHANGE IN ORIENTALISING AND ARCHAIC POTTERY SHAPES RICHARD N. FLETCHER Abstract This paper offers several observations on the phenomenon of Levantine influence on Greek pottery shapes of the Orientalising and Archaic periods. The evidence suggests that Levantine influence upon Greek pottery is of greater importance than is currently thought. The article focuses upon pottery shape as an indicator of foreign influence, but also demonstrates that the cultural exchange seen in the Mediterranean before the Classical period was a complex phe- nomenon in which there was a flow of ideas, practices and influences involving the Aegean, the various cultures of the Levant, Anatolia and Egypt. The blending of Mediterranean and Near Eastern cultures that we call Hellenism after Alexander had, in fact, been going on in a limited manner for centuries. This can be demonstrated in terms of pottery shapes: the so- called eclectic nature of Phoenician material culture can be seen all over the eastern Mediter- ranean from Syria to Egypt and to some extent in Greek pottery as well. In the Aegean, Eastern sources are clear for the discoid lip of Corinthian perfume vessels, the sack-shaped olpe and alabastron, and for the various types of Archaic lekythoi and East Greek vessels. Introduction The archaeology of the Orientalising and Archaic periods in Greece has tradition- ally emphasised the study of the decorative arts, particularly in the study of Greek pottery. Such a tendency is easily explained as arising directly from the character of the archaeological record of these periods: the Orientalising revolution is, after all, easily visible in Protocorinthian pottery, whose marked change in decorative style is emblematic, and may serve as a kind of shorthand for the broader socio-cultural changes of the period. -

The First Punic War, 264 to 241 B.C
Carthage Scenario Book V2.0 July, 2013 VOLUME #2 of THE ANCIENT WORLD SERIES A RICHARD H. BERG GAME DESIGN SCENARIO BOOK Version 2.0 July, 203 T A B L E O F C O N T E N T S CR .0 Introduction ................................................... 2 7.6 Naval Transport ........................................... 2 CR 2.0 Components ................................................... 2 7.7 Port Harbor Capacity and Winter ................ 22 CR 2. The Maps ................................................ 2 CR 8.0 Land Combat ................................................. 23 CR 2.2 Counters ................................................. 2 CR 9.0 Cities and Sieges ............................................ 23 CR 2.3 Player Aids ............................................. 4 CR 0.0 Manpower .................................................... 24 CR 3.0 The Sequence of Play .................................... 4 10. Raising Legions ......................................... 24 The Roman Political and Command System ............ 5 10.2 Placement of Roman Manpower ............... 25 CR 5. The Magistrates of Rome ....................... 5 10.3 Legion Training ......................................... 25 CR 5.2 Elections and Assignment of Magistrates . 7 10.4 Carthaginian Manpower ............................ 25 CR 5.3 Prorogue of Imperium ............................ 10 10.5 Carthaginian Army Efficiency ................... 26 CR 5.4 Magistrate Restrictions .......................... 10 CR 2.0 Diplomacy .................................................. -

Tophets in the 'Punic World'
ISSN 2239-5393 Tophets in the ‘Punic World’ Josephine Crawley Quinn (Worcester College, University of Oxford) Abstract There is no evidence for a contemporary ancient concept analogous to our ‘Punic World’, and such modern ethno-cultural categorizations can obscure more interesting ancient communities of identification and practice. This essay looks at a case study of such a community, the small set of Phoenician-speaking cities in the central Mediterranean that established child-sacrifice sanctuaries. I start not from an assumption that these so-called tophets reflected generic colonial identities but from the specific identifications that the sanctuaries made between themselves. I argue that these cannot be satisfactorily explained simply in the context of a diasporic ‘Punic World’, or solely through the actions of Carthage, and that taken on their own terms these cultural phenomena have the potential to reveal new narratives in the western Mediterranean. Keywords Tophet, Punic, culture-history, colonization, imperialism. 1. The problems of the Punic World Despite its popularity among scholars1, the ‘Punic World’ wouldn’t have made sense to the people who are supposed to have lived there, and this paper is an attempt to go beyond and below that abstract concept to get to their own stories. We can start with the problem of defining the modern term ‘Punic’, which does not map onto contemporary ancient vocabulary: Jonathan Prag demonstrated some years ago that there is no good evidence for anyone ever calling themselves (or for that matter their culture) ‘Punic’2, and more recently that there is no basic difference in sense between Greek Phoinix and Latin Poenus or Punicus: both could be applied interchangeably to eastern or western Phoenicians until at least the middle of the first century BCE, long after the destruction of Carthage3. -

Tel Anafa II
Tel Anafa II, iii Sponsors: The Kelsey Museum of Archaeology, University of Michigan, Ann Arbor The Museum of Art and Archaeology of the University of Missouri–Columbia The National Endowment for the Humanities The Smithsonian Institution Copyright © 2018 Kelsey Museum of Archaeology 434 South State Street, Ann Arbor, MI 48109-1390, USA ISBN 978-0-9906623-8-9 KELSEY MUSEUM OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN MUSEUM OF ART AND ARCHAEOLOGY OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI–COLUMBIA TEL ANAFA II, iii Decorative Wall Plaster, Objects of Personal Adornment and Glass Counters, Tools for Textile Manufacture and Miscellaneous Bone, Terracotta and Stone Figurines, Pre-Persian Pottery, Attic Pottery, and Medieval Pottery edited by Andrea M. Berlin and Sharon C. Herbert KELSEY MUSEUM FIELDWORK SERIES ANN ARBOR, MI 2018 CONTENTS Preface . vii Summary of Occupation Sequence . .viii Site Plan with Trenches . ix 1 Wall Plaster and Stucco by Benton Kidd, with Catalogue Adapted from Robert L. Gordon, Jr. (1977) . .1 2 Personal Adornment: Glass, Stone, Bone, and Shell by Katherine A. Larson . .79 3 Glass Counters by Katherine A. Larson . .137 4 Tools for Textile Manufacture by Katherine A. Larson and Katherine M. Erdman . 145 Appendix: Catalogue of Miscellaneous Bone Objects by Katherine M. Erdman . 211 5 Terracotta and Stone Figurines by Adi Erlich . 217 6 Pottery of the Bronze and Iron Ages by William Dever and Ann Harrison . 261 7 The Attic Pottery by Ann Harrison and Andrea M. Berlin . 335 8 Medieval Ceramics by Adrian J. Boas . .359 PREFACE Tel Anafa II, iii comprises the last installment of final reports on the objects excavated at the site between 1968 and 1986 by the University of Missouri and the University of Michigan. -
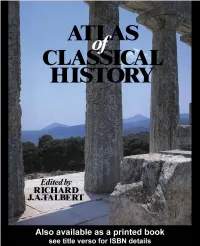
ATLAS of CLASSICAL HISTORY
ATLAS of CLASSICAL HISTORY EDITED BY RICHARD J.A.TALBERT London and New York First published 1985 by Croom Helm Ltd Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003. © 1985 Richard J.A.Talbert and contributors All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data Atlas of classical history. 1. History, Ancient—Maps I. Talbert, Richard J.A. 911.3 G3201.S2 ISBN 0-203-40535-8 Master e-book ISBN ISBN 0-203-71359-1 (Adobe eReader Format) ISBN 0-415-03463-9 (pbk) Library of Congress Cataloguing in Publication Data Also available CONTENTS Preface v Northern Greece, Macedonia and Thrace 32 Contributors vi The Eastern Aegean and the Asia Minor Equivalent Measurements vi Hinterland 33 Attica 34–5, 181 Maps: map and text page reference placed first, Classical Athens 35–6, 181 further reading reference second Roman Athens 35–6, 181 Halicarnassus 36, 181 The Mediterranean World: Physical 1 Miletus 37, 181 The Aegean in the Bronze Age 2–5, 179 Priene 37, 181 Troy 3, 179 Greek Sicily 38–9, 181 Knossos 3, 179 Syracuse 39, 181 Minoan Crete 4–5, 179 Akragas 40, 181 Mycenae 5, 179 Cyrene 40, 182 Mycenaean Greece 4–6, 179 Olympia 41, 182 Mainland Greece in the Homeric Poems 7–8, Greek Dialects c.