Die Lübke-Legende, Teil II 107
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Entsatzschlacht Bei Stalingrad 1942
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Ein ‚Wintergewitter‘ ohne ‚Donnerschlag‘“ Die Entsatzschlacht bei Stalingrad 1942 – Ein Unternehmen mit Aussicht auf Erfolg? UND Prüfung von Feldpostquellen aus Stalingrad für den Einsatz in der neuen kompetenzorientierten Reifeprüfung Verfasser Dominik Ender angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie aus der Studienrichtung Geschichte, Sozialkunde/Politische Bildung (Mag. phil.) Innsbruck, 2014 Studienkennzahl lt. Studienblatt: C 190 313 344 Studienrichtung lt. Studienblatt: Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde/Politische Bildung Unterrichtsfach Englisch Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Albrich BArch, Bild 101I-090-3914-29 A Eigene Darstellung 2 „Wir hatten Wind gesät, jetzt mußten wir Sturm ernten.“1 [Joachim Wieder, Offizier in Stalingrad] 1 Joachim Wieder/Heinrich Graf von Einsiedel, Stalingrad und die Verantwortung des Soldaten, München 19932, S. 141. 3 Inhaltsverzeichnis Teil I Einleitung …………………………………………………………………………………….. 7 1. Der Beginn von „Barbarossa“ ……………………………………………………………... 8 1.1 Angriff ohne Kriegserklärung …………………………………………………..... 9 1.2 Vernichtungskrieg im „Operationsgebiet“ ………………………………………. 10 2. Stationen des deutschen Vormarsches 1941-42 ………………………………………….. 13 2.1 „Führer befiehl, wir folgen dir!“ ………………………………………………... 15 2.2 Der Vorstoß nach Smolensk …………………………………………………….. 16 2.3 Weisung Nr. 33 und 34 ………………………………………………………….. 18 2.3.1 Die Eroberung der Ukraine …………………………………………… 20 2.3.2 Der Marsch auf Leningrad …………………………………………….. 22 2.3.3 900 Tage Belagerung ………………………………………………….. 23 2.3.4 Der Weg nach Moskau ………………………………………………… 24 2.3.5 Die Niederlage im Winter 1941 ……………………………………….. 25 2.3.6 Der Kessel von Demjansk …………………………………………….. 29 2.3.7 Der Status Quo an der Ostfront ……………………………………….. 30 2.4 Der „Fall Blau“ …………………………………………………………………. 31 2.4.1 Von Charkow bis Woronesch ………………………………………….. 32 2.4.2 „Mit der einen Faust nach Stalingrad, mit der anderen nach‘m Kaukasus“ …………………………………………………………….. -

LEUCHTKRAFT N Editorial: 20 Jahre DEFA-Stiftung Jeder Tag Ein Abenteuer
LEUCHTKRAFT 2018 Journal der DEFA-Stiftung Journal derJournal DEFA-Stiftung n Editorial: 20 Jahre DEFA-Stiftung Jeder Tag ein Abenteuer So hieß ein Buch, das mich durch meine Kindheit be- kraft« vor und spielen auf einen Film an, den die Mit- gleitete. Der Autor, seinen Namen habe ich vergessen, arbeiterinnen und Mitarbeiter der DEFA-Stiftung sehr beschrieb eine Fahrradtour rund um die Welt. Eine lieben, Jochen Kraußers grotesken Leuchtkraft der Reise, die von platten Reifen, verschlissenen Felgen, Ziege. Wir wollen damit einige Schlaglichter auf unsere steinigen Aufstiegen, kurvenreichen Abfahrten und Arbeit werfen, auf Geleistetes und noch Kommendes. vielen Begegnungen mit meist sympathischen Zeitge- Ein Text über Marion Keller, die erste Regisseurin der nossen begleitet war. Jeder Tag ein Abenteuer? – Das DEFA, soll neugierig machen auf das im Februar 2019 wäre für die Arbeit in der DEFA-Stiftung womöglich erscheinende Buch »Sie«, in dem wir rund sechzig übertrieben. Ganz falsch ist dieser Vergleich aber nicht: Porträts von Frauen versammeln, die zwischen 1945 und Unser Archiv mit rund 12.000 Filmen aus fast fünf Jahr- 1990 in den DEFA-Studios arbeiteten. Außerdem erin- zehnten birgt so viel Spannendes, Überraschendes und nert sich Filmkomponist Peter Rabenalt an seine Lehrer noch Unentdecktes, dass es eine andauernde Freude von der DEFA und Filmhistoriker Jeanpaul Goergen an ist, diese Schätze zu heben und sie gemeinsam mit un- Karlheinz Munds außergewöhnlichen Dokumentarfilm seren Partnern und Freunden für ein heutiges, vor allem Memento über die jüdischen Friedhöfe Berlins. Lutz junges Publikum zu erschließen. Dammbeck, Sylke Laubenstein-Polenz und Melanie Vor zwanzig Jahren, am 6. Dezember 1998, wurde die Hauth reflektieren über aktuelle Probleme und Chan- DEFA-Stiftung gegründet. -
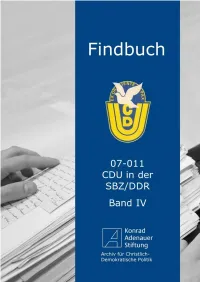
Findbuch Der CDU in Der SBZ/DDR Band IV
ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 07 – 011 CDU IN DER SBZ/DDR BAND IV SANKT AUGUSTIN 2018 I Inhaltsverzeichnis 1 Hauptgeschäftsstelle - Mitglieder Sekretariat mit Abteilungen und Referaten 1945 - 1990 1 1.1 Mitglieder Sekretariat bzw. Wissenschaftliche Mitarbeiter 1969 -1989 1 1.1.1 Zentrale Veranstaltungen 1987 - 1989 1 1.1.2 Fahl, Ulrich 1984 - 1989 1 1.1.3 Fischer, Gerhard 1981 - 1989 1 1.1.4 Niggemeier, Adolf 1989 - 1990 1 1.1.5 Ordnung, Karl 1959 - 1990 2 1.1.5.1 Abteilung "Frieden und Sicherheit" 1989 - 1990 2 1.1.5.2 Berichte und Vermerke 1960 - 1990 2 1.1.5.3 Korrespondenz 1964 - 1990 4 1.1.5.3.1 Allgemein 1964 - 1976 4 1.1.5.3.2 DDR 1975 - 1990 5 1.1.5.3.3 Westdeutschland 1968 - 1990 6 1.1.5.3.4 Ausland 1975 - 1990 7 1.1.5.4 Pressearbeit (Gutachten und Manuskripte) 1959 - 1989 7 1.1.5.5 Veröffentlichungen 1975 - 1989 9 1.1.5.6 Evangelisch-methodistische Kirche 1969 - 1989 9 1.1.6 Wirth, Günter 1951 - 1990 10 1.1.6.1 Chefredakteur STANDPUNKT 1969 - 1990 10 1.1.6.2 Parteileitung 1951 - 1989 10 1.1.6.3 Wissenschaftliche Arbeitsgruppe 1990 11 1.1.6.4 Bezirksverbände und Kreisverbände 1959 - 1990 11 1.1.6.5 Bezirksverband 15 Berlin 1966 - 1990 11 1.1.7 Wünschmann, Werner 1966 - 1989 11 1.1.8 Zillig, Johannes 1976 - 1989 13 1.2 Parteivorsitzender - Abteilung Finanzen, Gästehäuser, Ferienhäuser und Verwaltung 13 1945 - 1990 1.2.1 Abteilung Finanzen - Haushalt und Bilanzen CDU, Bezirksverbände, 13 Kreisverbände, VOB-Union 1945 - 1990 1.2.1.1 Richtlinien und Revision 1945 - 1990 13 1.2.1.1.1 -

Auschwitz Und Staatssicherheit
Henry Leide Auschwitz und Staatssicherheit Strafverfolgung, Propaganda und Geheimhaltung in der DDR BF informiert 40 (2019) Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Abteilung Kommunikation und Wissen 10106 Berlin [email protected] Die Meinungen, die in dieser Schriftenreihe geäußert werden, geben ausschließlich die Auffassungen der Autoren wieder. Abdruck und publizistische Nutzung sind nur mit Angabe des Verfassers und der Quelle sowie unter Beachtung des Urheberrechtsgesetzes gestattet. Schutzgebühr: 5,00 € Berlin 2021 3., erweiterte und überarbeitete Auflage ISBN 978-3-946572-29-9 Eine PDF-Version dieser Publikation ist unter der folgenden URN kostenlos abrufbar: urn:nbn:de:0292-97839465722990 Inhalt Anstatt eines Vorwortes: Warum Auschwitz und nur Auschwitz? 7 Einleitung 9 Der NS-Judenmord und die DDR 9 NS-Verbrechen als Thema der DDR-Propaganda 27 1. Strafverfolgung von Auschwitz-Tätern 49 1.1 Strafverfolgung durch nichtdeutsche Gerichte 49 1.2 Die Strafverfolgung in der Bundesrepublik Deutschland 63 1.3 Die Strafverfolgung in der DDR 67 1.4 Sonderfall »Waldheimer Prozesse« 74 1.5 Gab es ein »Unsere-Leute-Prinzip«? 83 2. Das MfS und die Verfügungsgewalt über die NS-Akten 95 3. Der Umgang mit Tatverdächtigen 105 4. Verurteilungen von Auschwitz-Tätern 111 4.1 Willkür der sowjetischen Militärjustiz ohne Korrektur: der Fall Ernst Thiele 111 4.2 Der Kapo – das Urteil gegen Alexander Bartell 127 4.3 Der Fall Grönke: im Westen nochmals belangt 133 4.4 Der Fall Paul Barteldt: ein Lebenslänglich, das tatsächlich lebenslänglich war 136 4.5 Schauprozess mit dürftiger Beweislage: das Todesurteil gegen Herbert Fink 138 4.6 Im Schatten des 1. -

Geschichte Neuerwerbungsliste 3. Quartal 2002
Geschichte Neuerwerbungsliste 3. Quartal 2002 Geschichte: Allgemeines und Einführungen ........................................................................................................... 2 Geschichtsschreibung und Geschichtstheorie.......................................................................................................... 2 Teilbereiche der Geschichte (Politische Geschichte, Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte allgemein)........ 4 Historische Hilfswissenschaften.............................................................................................................................. 6 Ur- und Frühgeschichte; Mittelalter- und Neuzeitarchäologie ................................................................................ 8 Allgemeine Weltgeschichte, Geschichte der Entdeckungen, Geschichte der Weltkriege ..................................... 14 Alte Geschichte ..................................................................................................................................................... 22 Europäische Geschichte in Mittelalter und Neuzeit .............................................................................................. 24 Deutsche Geschichte ............................................................................................................................................. 28 Geschichte der deutschen Laender und Staedte..................................................................................................... 36 Geschichte der Schweiz, Österreichs, Ungarns, -

Der Egsdorfer Horst Geschichte 2. Ausgabe
Idylle und Illusionen auf den Teupitzer Inseln Egsdorfer Horst Liebesinsel 1 Der Autor: Dr. phil. Lothar Tyb‘l, Jahrgang 1937, wohnhaft in Berlin, Teupitzchronist, publizierte mehrere Bücher, etwa 40 Broschüren und über 250 Artikel zur Stadtgeschichte von Teupitz. Mit dem vorliegenden Aufsatz wendet sich der Autor der Geschichte des „Egsdorfer Horst“ und der „Liebesinsel“ zu. Als besonderer Stadtteil ist die Geschichte dieser Inseln untrennbar mit der Teupitzgeschichte verbunden. Nach über einem Viertel Jahrhundert Beitritt der DDR zur BRD wird die „Transforma- tionsphase“ der Stadt und ihrer Inseln nach Herstellung der staatlichen Einheit aus zwei Gründen Gegenstand der Heimatgeschichtsschreibung: 1. In ihr widerspiegelt sich deutlich das Für und Wider im deutschen Einigungsprozess und dessen Auswirkungen auf die Gegen- wart und Zukunft. 2. Sie unterstreicht die Bedeutung lokaler Fragen sowie der Heimatver- bundenheit für die Bürger in einer Periode der Globalisierung und Europäisierung unseres Landes. Gestaltung: Autor Fotos auf dem Deckblatt: Luftaufnahmen Reinhard Hensel 2012 und Autor 2000 Foto auf der Rückseite: Radweg Teupitz-Schwerin, Autor 2017 Redaktionsschluss: 31. Dezember 2017; zweite, ergänzte Auflage 2. Mai 2018 Druck: Herausgeber: Selbstverlag © Alle Rechte vorbehalten. Lothar Tyb’l. 2017/2018 Beim Auswerten der Recherchedaten und beim Schreiben des Aufsatzes ließ sich der Autor davon leiten, die Vorschriften des Datenschutzes und die Persönlichkeitsrechte der „Insu- laner“ strikt zu wahren. Die Schrift ist einschließlich aller ihrer Teile urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen jeder Art oder Einspeicherungen in elektronische Systeme sind ohne Zustimmung des Au- tors unzulässig. 2 Inhalt 1. Überfahrt zu den Inseln 5 2. Vorgeschichte und Glückstag für Teupitz 6 3. Parzellierung und Besiedlung in der Weimarer Republik und Nazi-Zeit 7 4. -

Bundespressekonferenz: Los Orígenes Del Modelo Alemán De Conferencia De Prensa Federal
Bundespressekonferenz: los orígenes del modelo alemán de conferencia de prensa federal GUNNAR KRÜGER Bundespressekonferenz: los orígenes del modelo alemán de conferencia de prensa federal Kruger, Gunnar Bunderpressekonferenz: los origenes del modelo aleman de conferencia de prensa federal. - 1a ed. - Buenos Aires : Konrad Adenauer Stiftung, 2009. 176 p. ; 23x16 cm. ISBN 978-987-1285-15-0 1. Periodismo. I. Título CDD 070.4 Foto de tapa: El Canciller Konrad Adenauer brindando una conferencia de prensa en Bonn, 1961. (Foto DPA Nr. 6842231) Título original en alemán “Wir sind doch kein Exklusiver Club!” Die Bundespressekonferenz in der Ära Adenauer”. Editorial LIT, Münster 2005. Traducción del original: Mariana Dimópulos Corrección: Jorge Galeano Diseño de interior y tapa: Ana Uranga © Fundación Konrad Adenauer Programa Regional Medios de Comunicación y Democracia en Latinoamérica Suipacha 1175, 2° piso C1008AAW Buenos Aires Argentina Tel.: +54-11-43 93 28 60 www.kasmedios.org ISBN: 978-987-1285-15-0 Impreso en Argentina Hecho el déposito que establece la Ley 11.723 Prohibida su reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia, sin la autorización expresa de los editores Junio 2009 ÍNDICE 7 | Un poco de libertad de prensa Nota introductoria de Reinhard Appel 15 | Prólogo 17 | 1. Entre la modernización y la restauración: conflictos periodísticos 23 | 2. Política, opinión pública, medios: actores e instituciones 2.1 El gobierno 2.2 La opinión pública mediática y política 2.3 La Bundespressekonferenz 33 | 3. Los precursores y la fundación de la Bundespressekonferenz 3.1 Las conferencias de prensa en las capitales alemanas antes de 1949 3.2 Aguda necesidad de información, precursores comprometidos e intereses aliados 47 | 4. -

HELMUT ROEWER Nur Für Den Dienstgebrauch
HELMUT ROEWER Nur für den Dienstgebrauch Roewer -- Verfassungsschutz-Chef [Ares 2012].indb 1 06.09.2012 14:59:25 Roewer -- Verfassungsschutz-Chef [Ares 2012].indb 2 06.09.2012 14:59:25 Helmut Roewer Als Verfassungs- schutz-Chef im Osten Deutschlands Roewer -- Verfassungsschutz-Chef [Ares 2012].indb 3 06.09.2012 14:59:26 Umschlaggestaltung: Digitalstudio Rypka GmbH, Dobl, Thomas Hofer, www.rypka.at Bildnachweis: Umschlagabb. Vorderseite: Archiv des Autors Bildnachweis Innenteil: Sofern nicht anders vermerkt: Archiv des Autors. Aus die- sem stammen auch die abgedruckten Karikaturen von „Nel“, die in den Jahren ab 1995 zum Zwecke der Weiterverwendung erworben wurden. Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber aus!n- dig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht re- cherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten. Bibliogra!sche Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra!e; detaillierte bibliogra!sche Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar. Hinweis Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefel- frei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu: Ares Verlag GmbH Hofgasse 5/Postfach 438 A-8011 Graz Tel.: +43 (0)316/82 16 36 Fax: +43 (0)316/83 56 12 E-Mail: [email protected] www.ares-verlag.com ISBN 978-3-902732-09-5 Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechani- sche Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeiche- rung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten. -

Eop Axis Military Necessity Evacuation
EoP Axis Military Necessity Evacuation EoP Axis Applicants Correspondence [PDF] Sent Individually to Stan McChrystal [PDF] 01 PDF: 19 Sep 2015 – 21 May 2016 For correspondence sent Collectively to All EoP Axis Applicants [PDF] Re: 21 May 2016 Update: 10 May MB Hack Data blog provides a copy of all the 10 May 2016 EoP v WiP NWO Negotiations update data -- that had (a) been updated; or not yet updated; in MILED Clerk Notice or EoP Legal Submissions Case's PDF document; and (b) been updated but re-positioned on EoP v WiP NWO Neg: Comments Correspondence blog; including EoP Applicants: Tim McVeigh [PDF] & Stan McChrystal [PDF]-- when EoP Acting Clerk's computer was hacked and motherboard crashed; as detailed in 14 May 2016 correspondence to EoP Applicants. EoP Axis documentation is available at: EoP NWO social contract options→ EoP Axis Military Necessity Evacuation. GMC 4643-13 Applicant 17 Oct 2013 – 18 Sep 2015: Stan McChrystal [PDF] GMC 4643-13 documentation is available at: GMC 4643-13: Lara Johnstone et al v Brad Blanton et al. Sent: Saturday, September 19, 2015 4:05 PM Subject: RE: GMC 4643-13: RE: Stan McChrystal: Re: EoP PoW Axis MilNec Evac Notice From: MILED EoP-PoW Clerk: Andrea Muhrrteyn [mailto:[email protected]] Sent: Saturday, September 19, 2015 4:05 PM To: 'Stan McChrystal' Cc: 'Cherylanne Anderson'; 'Timothy McVeigh' Subject: RE: GMC 4643-13: RE: Stan McChrystal: Re: EoP PoW Axis MilNec Evac Notice Stan McChrystal McChrystal Group CC: Cherylanne Anderson ([email protected]) CC: Timothy McVeigh ([email protected]) Stan: GMC 4643-13: RE: Stan McChrystal: Re: EoP PoW Axis MilNec Evac Notice You are still listed as a GMC 4643-13 applicant; consequently you are included with other applicants in the EoP Axis Military Necessity Evacuation: 26 September Lotto Notice [PDF].