Anliegen Natur 40(1), 2018 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Litteratura Coleopterologica (1758–1900)
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 583: 1–776 (2016) Litteratura Coleopterologica (1758–1900) ... 1 doi: 10.3897/zookeys.583.7084 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Litteratura Coleopterologica (1758–1900): a guide to selected books related to the taxonomy of Coleoptera with publication dates and notes Yves Bousquet1 1 Agriculture and Agri-Food Canada, Central Experimental Farm, Ottawa, Ontario K1A 0C6, Canada Corresponding author: Yves Bousquet ([email protected]) Academic editor: Lyubomir Penev | Received 4 November 2015 | Accepted 18 February 2016 | Published 25 April 2016 http://zoobank.org/01952FA9-A049-4F77-B8C6-C772370C5083 Citation: Bousquet Y (2016) Litteratura Coleopterologica (1758–1900): a guide to selected books related to the taxonomy of Coleoptera with publication dates and notes. ZooKeys 583: 1–776. doi: 10.3897/zookeys.583.7084 Abstract Bibliographic references to works pertaining to the taxonomy of Coleoptera published between 1758 and 1900 in the non-periodical literature are listed. Each reference includes the full name of the author, the year or range of years of the publication, the title in full, the publisher and place of publication, the pagination with the number of plates, and the size of the work. This information is followed by the date of publication found in the work itself, the dates found from external sources, and the libraries consulted for the work. Overall, more than 990 works published by 622 primary authors are listed. For each of these authors, a biographic notice (if information was available) is given along with the references consulted. Keywords Coleoptera, beetles, literature, dates of publication, biographies Copyright Her Majesty the Queen in Right of Canada. -

Communities in Apple and Pear Orchards in Hungary
Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 39 (1–3), pp. 71–89 (2004) Species Composition of Carabid (Coleoptera: Carabidae) Communities in Apple and Pear Orchards in Hungary CS. KUTASI1, V. MARKÓ2 and A. BALOG2 1Natural History Museum of Bakony Mountains, Zirc, Hungary, e-mail: [email protected] 2Department of Entomology, BUESPA, H-1052 Budapest, P. O. Box 53, Hungary, e-mail: [email protected], [email protected] Species richness and composition of carabid assemblages were investigated on the ground surface of differently treated (abandoned, commercial and IPM) apple and pear orchards in Hungary. Extensive sampling was carried out by pitfall trapping in 13 apple and 3 pear orchards located in ten different regions. 28 230 indi- viduals belonging to 174 species were collected. Additional four species were collected by trunk-traps and 23 species were found during the review of earlier literature. Altogether 201 carabid species representing 40% of the carabid fauna of Hungary were found in our and earlier studies. The species richness varied between 23 and 76 in the different orchards, the average species richness was 43 species. The common species, occurring with high relative abundance in the individual orchards in decreasing order were: Pseudoophonus rufipes, Harpalus distinguendus, Harpalus tardus, Anisodactylus bino- tatus, Calathus fuscipes, Calathus erratus, Amara aenea, Harpalus affinis and Pterostichus melanarius. The species with wide distribution, occurring in more than 75% of the investigated orchards in decreas- ing order were: Pseudoophonus rufipes, Trechus quadristriatus, Harpalus tardus, Harpalus distinguendus, Pterostichus melanarius, Amara aenea, Amara familiaris Calathus fuscipes, Poecilus cupreus, Calathus ambi- guus, Calathus melanocephalus, Pseudoophonus griseus and Harpalus serripes. -

Supplementary Materials To
Supplementary Materials to The permeability of natural versus anthropogenic forest edges modulates the abundance of ground beetles of different dispersal power and habitat affinity Tibor Magura 1,* and Gábor L. Lövei 2 1 Department of Ecology, University of Debrecen, Debrecen, Hungary; [email protected] 2 Department of Agroecology, Aarhus University, Flakkebjerg Research Centre, Slagelse, Denmark; [email protected] * Correspondence: [email protected] Diversity 2020, 12, 320; doi:10.3390/d12090320 www.mdpi.com/journal/diversity Table S1. Studies used in the meta-analyses. Edge type Human Country Study* disturbance Anthropogenic agriculture China Yu et al. 2007 Anthropogenic agriculture Japan Kagawa & Maeto 2014 Anthropogenic agriculture Poland Sklodowski 1999 Anthropogenic agriculture Spain Taboada et al. 2004 Anthropogenic agriculture UK Bedford & Usher 1994 Anthropogenic forestry Canada Lemieux & Lindgren 2004 Anthropogenic forestry Canada Spence et al. 1996 Anthropogenic forestry USA Halaj et al. 2008 Anthropogenic forestry USA Ulyshen et al. 2006 Anthropogenic urbanization Belgium Gaublomme et al. 2008 Anthropogenic urbanization Belgium Gaublomme et al. 2013 Anthropogenic urbanization USA Silverman et al. 2008 Natural none Hungary Elek & Tóthmérész 2010 Natural none Hungary Magura 2002 Natural none Hungary Magura & Tóthmérész 1997 Natural none Hungary Magura & Tóthmérész 1998 Natural none Hungary Magura et al. 2000 Natural none Hungary Magura et al. 2001 Natural none Hungary Magura et al. 2002 Natural none Hungary Molnár et al. 2001 Natural none Hungary Tóthmérész et al. 2014 Natural none Italy Lacasella et al. 2015 Natural none Romania Máthé 2006 * See for references in Table S2. Table S2. Ground beetle species included into the meta-analyses, their dispersal power and habitat affinity, and the papers from which their abundances were extracted. -

Download File
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 846 Acta BIOlOGICA NR 22 2015 DOI 10.18276/ab.2015.22-14 BRYGIDA RADAWIEC* Łukasz Baran** andrzej zawal** A CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF THE GROUND BEETLES (INSECTA, COLEOPTERA: CARABIDAE) OF WOLIN ISLAND Abstract In the course of a one-year investigation (17.04–13.09 2007) 2,144 specimens of carabid beetles belonging to 86 species were collected. Of these, 30 species had not previously been recorded on Wolin Island, and Bembidion (Phyla) obtusum Audinet-Serville, 1821 is new to the Polish Baltic Sea coast. All faunistic data on the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) were recorded on Wolin Island. A total of 145 species are listed in the table (Tab. 1). The data are based on our own new material (86 species) as well as published materials. Two of the carabid species noted are legally protected in Poland: Carabus convexus and C. glabratus. Some rare species noted are listed on the red list of declining or endangered Animals in Poland: Bembidion obtusum – CR; Oodes helopioides and Masoreus wetterhallii – NT; Carabus convexus, Acupalpus exiguus and Amara quenseli silvicola – VU; and Broscus cephalotes – DD. * Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian Academy in Slupsk, e-mail: [email protected] ** Deperment of Invertebrate Zoology & Limnology, University of Szczecin 198 B. Radawiec, Ł. Baran, A. Zawal The presence of some previously recorded species was not confirmed: 9 spe- cies known from 160 years ago (Amara montivaga, Agonum thoreyi, Asaphid- ion pallipes, Bembidion fumigatum, Bembidion stephensi, Carabus marginalis, Demetrias imperialis, Demetrias monostigma and Harpalus neglectus), 2 species from about 100 years ago (Bembidion transparens and nebria livida), one spe- cies from 70 years ago (Amara municipalis) and one from 40 years ago (Bembid- ion assimile). -

Mickiewiczologia – Tradycje I Potrzeby Słupsk 1999
Słupskie Prace Biologiczne Nr 13 ss. 5-18 2016 ISSN 1734-0926 Przyjęto: 7.11.2016 © Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku Zaakceptowano: 16.01.2017 ADDITIONS, CORRECTIONS AND COMMENTS TO THE CARABIDAE PART OF: I. LÖBL & A. SMETANA 2003. CATALOGUE OF PALAEARCTIC COLEOPTERA. VOL. 1, ARCHOSTEMATA – MYXOPHAGA – ADEPHAGA FOR BELARUS, UKRAINE AND POLAND Oleg Aleksandrowicz1 Mieczysław Stachowiak2 Aleksandr Putchkov3 1 Pomeranian University in Słupsk, Poland e-mail: [email protected] 2 University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland 3 I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev ABSTRACT Additions and corrections are given to the Carabidae part of the Catalogue of Löbl & Smetana (2003) regarding the east and south-east part of Central Europe. Many species were erroneously quoted from Belarus (26 species), Poland (15 spe- cies) and Ukraine (10 species) and them should be deleted from the Catalogue. Oth- er species actually occurring in these countries were missing. The list of missed spe- cies includes 89 certainly old members of the Polish fauna, 84 – of Ukraine’s, and 71 – of the Belarus’. Absence in the Catalogue of 25% of species of well studied fauna of Belarus, 18% of fauna of Poland, and 11% of fauna of Ukraine reduces in- formation value of this work. Some taxonomical comments are also given. Key words: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Carabidae, additions and correc- tions, Poland, Belarus, Ukraine INTRODUCTION This publication seems overdue, after all the Catalogue has been published for a long time already – since 2003. However, the text of the Catalogue became more accessible to experts from the Eastern Europe only now. -

Contributions to the Knowledge of the Rare Or Localized Species Distribution from the Carabus Genre in Romania
Research Journal of Agricultural Science, 44 (2), 2012 CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE RARE OR LOCALIZED SPECIES DISTRIBUTION FROM THE CARABUS GENRE IN ROMANIA J. BARLOY(1) , F. PRUNAR(2) (1)Agrocampus Ouest (FR), 65, Rue de Saint-Brieuc CS 84215, Rennes Cedex 35042, (2)Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agricultural Sciences, Timisoara, Calea Aradului no. 119, RO-300645, Romania, E-mail: [email protected] Abstract: In Romania several species of the genre the Romanian Carpathians); Carabus Carabus are considered rare or localized. Using (Platycarabus) fabricii malachiticus C.G.Thomson, old references which are confronted with recent 1875, from Rodnei and Calimani Mountains, at observations this paper work sets the researches high height; occupant of the reduced zones: history for the rare or geographically localised Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792, species inciting to the new checks in the field to (a single confirmed station), Carabus achieve the targeted species management (Morphocarabus) rothi alutensis Sãvulescu, 1972, programs. Their distribution rests partially on endemic Romania occupying a bounded area ancient data not systematically confirmed by recent (National Park Cozia, Calimanesti, Ramnicu collections. The notion of rarity can also result Valcea), Carabus (Procerus) gigas Creutzer, 1799 from an insufficiency of entomological prospecting. (species has a diffuse distribution in Banat); being These must be encouraged by the recent results situated on the verge of the area of distribution of having allowed the discovery of new species the species Carabus (Mesocarabus) problematicus (example of Carabus (Pachystus) cavernosus holdhausi Born, 1911 (several mountain summits) Frivaldsky, 1837 in Rimetea, by Kutasi 2000) or of Carabus (Trachycarabus) besseri Fischer, 1822 new stations Carabus (Tomocarabus) marginalis (sporadic in romanian Moldavia). -
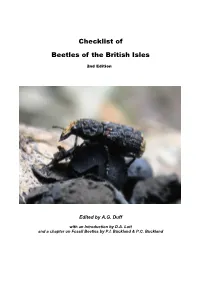
Checklist of Beetles of the British Isles, 2012 Edition
Checklist of Beetles of the British Isles 2nd Edition Edited by A.G. Duff with an Introduction by D.A. Lott and a chapter on Fossil Beetles by P.I. Buckland & P.C. Buckland Checklist of Beetles of the British Isles Copyright © A.G. Duff, 2012. First edition 2008 published by A.G. Duff Revised edition 2012 ISBN: 978-0-9573357-0-7 Published by Pemberley Books (Publishing), United Kingdom. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without written permission from the publisher. Although every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher and authors assume no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein. Within the meaning of Article 8.2 of the International Code of Zoological Nomenclature (4th Edition, 1999), this work is not issued for the purposes of zoological nomenclature. Pemberley Books 18 Bathurst Walk, Iver SL0 9AZ United Kingdom Tel.: +44(0)1753 631114 Fax: +44(0)1753 631115 E-mail: [email protected] WWW: www.pemberleybooks.com Cover: Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) (Anthribidae) © John Walters Summary of changes in the 2012 edition This section details the main changes in the current edition of the checklist, compared to the previous edition (Duff, 2008). For further details of these changes, please refer to the endnotes. Family-group names: . Nomenclature of family-group names follows Bouchard et al. (2011) . Family PAELOBIIDAE is renamed to HYGROBIIDAE . -

Download in Portable Document Format
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66(Suppl.), pp. 69–96, 2020 DOI: 10.17109/AZH.66.Suppl.69.2020 THE TYPE OF FOREST EDGE GOVERNS THE SPATIAL DISTRIBUTION OF DIFFERENT-SIZED GROUND BEETLES Tibor Magura1 and Gábor L. Lövei2 1Department of Ecology, University of Debrecen, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1, Hungary; E-mail: [email protected]; https://orcid.org/0000-0002-9130-6122 2Department of Agroecology, Aarhus University, Flakkebjerg Research Centre DK-4200 Slagelse, Denmark; E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-6467-9812 Worldwide human-induced habitat fragmentation intensifies the emergence of forest edg- es. In addition to these edges, there are edges evolved by natural processes. Edge-main- taining processes (natural vs. anthropogenic) fundamentally determine edge responses, and thus edge functions. Species with various traits show fundamentally different edge response, therefore the trait-based approach is essential in edge studies. We evaluated the edge effect on the body size of ground beetles in forest edges with various maintaining processes. Our results, based on 30 published papers and 221 species, showed that natural forest edges were impenetrable for small species, preventing their dispersal into the forest interiors, while both the medium and the large species penetrated across these edges and dispersed into the forest interiors. Anthropogenic edges maintained by continued human disturbance (agriculture, forestry, urbanisation) were permeable for ground beetles of all size, allowing them to invade the forest interiors. Overwintering type (overwintering as adults or as larvae) was associated with body size, since almost two-thirds of the small spe- cies, while slightly more than a third of both the medium and the large species were adult overwintering. -

Invertebrates
Pennsylvania’s Comprehensive Wildlife Conservation Strategy Invertebrates Version 1.1 Prepared by John E. Rawlins Carnegie Museum of Natural History Section of Invertebrate Zoology January 12, 2007 Cover photographs (top to bottom): Speyeria cybele, great spangled fritillary (Lepidoptera: Nymphalidae) (Rank: S5G5) Alaus oculatus., eyed elater (Coleoptera: Elateridae)(Rank: S5G5) Calosoma scrutator, fiery caterpillar hunter (Coleoptera: Carabidae) (Rank: S5G5) Brachionycha borealis, boreal sprawler moth (Lepidoptera: Noctuidae), last instar larva (Rank: SHG4) Metarranthis sp. near duaria, early metarranthis moth (Lepidoptera: Geometridae) (Rank: S3G4) Psaphida thaxteriana (Lepidoptera: Noctuidae) (Rank: S4G4) Pennsylvania’s Comprehensive Wildlife Conservation Strategy Invertebrates Version 1.1 Prepared by John E. Rawlins Carnegie Museum of Natural History Section of Invertebrate Zoology January 12, 2007 This report was filed with the Pennsylvania Game Commission on October 31, 2006 as a product of a State Wildlife Grant (SWG) entitled: Rawlins, J.E. 2004-2006. Pennsylvania Invertebrates of Special Concern: Viability, Status, and Recommendations for a Statewide Comprehensive Wildlife Conservation Plan in Pennsylvania. In collaboration with the Western Pennsylvania Conservancy (C.W. Bier) and The Nature Conservancy (A. Davis). A Proposal to the State Wildlife Grants Program, Pennsylvania Game Commission, Harrisburg, Pennsylvania. Text portions of this report are an adaptation of an appendix to a statewide conservation strategy prepared as part of federal requirements for the Pennsylvania State Wildlife Grants Program, specifically: Rawlins, J.E. 2005. Pennsylvania Comprehensive Wildlife Conservation Strategy (CWCS)-Priority Invertebrates. Appendix 5 (iii + 227 pp) in Williams, L., et al. (eds.). Pennsylvania Comprehensive Wildlife Conservation Strategy. Pennsylvania Game Commission and Pennsylvania Fish and Boat Commission. Version 1.0 (October 1, 2005). -

Coleoptera, Carabidae) of Warsaw and Ma- Zovia
POLISH ACADEMY OF SCIENCES • INSTITUTE OF ZOOLOGY MEMORABILIA ZOOLOGICA MEMORABILIA ZOOL. 34 119— 144 1981 WOJCIECH CZECHOWSKI CARABIDS (COLEOPTERA, CARABIDAE) OF WARSAW AND MA- ZOVIA ABSTRACT A total number of 276 carabid species occur within the administrative boundaries of Warsaw, including 258 species in suburban areas and 113 species in urban green areas (parks, housing estates, and the centre of the town). The species of urban green areas account for 35% of the potential carabid fauna of this area, 323 species being recorded from Mazovia. The species with large geographical ranges (Holarctic, Palaearctic, and Euro- -Siberian) are best adapted to urban conditions. To the species most resistant to urban pressure belong those occupying a wide spectrum of habitat types (eurytopic and polytopic), field und ubiquitous, and also xerophilous and omnivorous. The dominant species of urban green areas are Pterostichus vulgaris (L.), Nebria brevicollis (Fabr.) and Calathus fuscipes (Goeze). INTRODUCTION HISTORICAL VIEW Carabids as a group of insects have drawn the attention of workers since the earliest times. This is one of the best known families of the beetles taxonomically, as well as faunistically and ecologically. Even urban areas, usually little attractive to faunists, were not disregarded by collectors in the remote past. Due to this, now when the study on urban areas dynamically develop, we have relatively rich data on the urban and, in particular, Warsaw carabid fauna. A general picture of faunistic studies carried out so far in Warsaw and Mazovia is presented elsewhere [14]. The history of the studies on Carabidae of Warsaw goes back to the second half of the 19th century. -

DNA Barcoding Facilitates a Rapid Biotic Survey of a Temperate Nature Reserve
Biodiversity Data Journal 3: e6313 doi: 10.3897/BDJ.3.e6313 Taxonomic Paper Biodiversity inventories in high gear: DNA barcoding facilitates a rapid biotic survey of a temperate nature reserve Angela C Telfer‡‡§‡‡‡, Monica R Young , Jenna Quinn , Kate Perez , Crystal N Sobel , Jayme E Sones , Valerie Levesque-Beaudin‡, Rachael Derbyshire ‡, Jose Fernandez-Triana |, Rodolphe Rougerie ¶, Abinah Thevanayagam‡‡‡#‡, Adrian Boskovic , Alex V Borisenko , Alex Cadel , Allison Brown , Anais Pages¤, Anibal H Castillo ‡, Annegret Nicolai «, Barb Mockford Glenn Mockford», Belén Bukowski˄, Bill Wilson»§, Brock Trojahn , Carole Ann Lacroix˅, Chris Brimblecombe¦, Christoper Hayˀ, Christmas Ho‡, Claudia Steinke‡‡, Connor P Warne , Cristina Garrido Cortesˁ, Daniel Engelking‡‡, Danielle Wright , Dario A Lijtmaer˄, David Gascoigne», David Hernandez Martich₵, Derek Morningstar ℓ, Dirk Neumann ₰, Dirk Steinke‡, Donna DeBruin Marco DeBruin», Dylan Dobiasˁ, Elizabeth Sears‡, Ellen Richardˁ, Emily Damstra»‡, Evgeny V Zakharov , Frederic Labergeˁ, Gemma E Collins¦, Gergin A Blagoev ‡, Gerrie Grainge»‡, Graham Ansell , Greg Meredith₱, Ian Hogg¦, Jaclyn McKeown ‡, Janet Topan ‡, Jason Bracey»»‡‡‡, Jerry Guenther , Jesse Sills-Gilligan , Joseph Addesi , Joshua Persi , Kara K S Layton₳, Kareina D'Souza‡, Kencho Dorji₴, Kevin Grundy», Kirsti Nghidinwa₣, Kylee Ronnenberg‡, Kyung Min Lee₮, Linxi Xie ₦, Liuqiong Lu‡, Lyubomir Penev₭, Mailyn Gonzalez ₲, Margaret E Rosati ‽, Mari Kekkonen‡‡‡, Maria Kuzmina , Marianne Iskandar , Marko Mutanen₮, Maryam Fatahi‡, Mikko Pentinsaari₮, -

CONTENT of ORGANIC C and Ph of BOG and POST-BOG SOILS VERSUS the PRESENCE of GROUND BEETLES CARABIDAE in STARY DWÓR NEAR OLSZTYN
J. Elementol. 2010, 15(3): 581–591 581 CONTENT OF ORGANIC C AND pH OF BOG AND POST-BOG SOILS VERSUS THE PRESENCE OF GROUND BEETLES CARABIDAE IN STARY DWÓR NEAR OLSZTYN Mariusz Nietupski1, Pawe³ Sowiñski2, Wojciech S¹dej1, Agnieszka Kosewska1 1Chair of Fitopatology and Entomology 2Department of Soil Science and Soil Protection University of Warmia and Mazury in Olsztyn Abstract The present study consisted of an evaluation of assemblages of epigeic carabid beetles (Col. Carabidae) colonizing hydrogenic soils (bog and post-bog ones), different in the soil development degree. The observations were conducted on a drained, low bog area called Stary Dwór, which today is used as a cut meadow. This is an oblong depression, filled in with (partly mucky) rush peats and situated in the sandur landscape. It lies in the mesore- gion called Pojezierze Olsztyñskie (Olsztyn Lake District) near Olsztyn (UTM DE 65), abo- ut 3 km of the southern borders of the town. The field observations for determination of the soil type were conducted using soil catenas. A transect was established, which cut across different types and sub-types of bog and post-bog soils. In this paper, the authors have attempted to answer the question whether the sequence of hydrogenic soils and some pa- rameters chosen to describe them have any influence on assemblages of epigeic carabid beetles dwelling in such habitats. Based on the results, it has been concluded that the soils present in the analyzed peat bog were characterized by the following sequence: muckous soils → peat-muck soils → peat soils. Their properties depended on the position in the soil relief, advancement of muck formation and content of organic carbon.