Checkliste Der Schleimpilze (Myxomycetes) Thüringens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Old Woman Creek National Estuarine Research Reserve Management Plan 2011-2016
Old Woman Creek National Estuarine Research Reserve Management Plan 2011-2016 April 1981 Revised, May 1982 2nd revision, April 1983 3rd revision, December 1999 4th revision, May 2011 Prepared for U.S. Department of Commerce Ohio Department of Natural Resources National Oceanic and Atmospheric Administration Division of Wildlife Office of Ocean and Coastal Resource Management 2045 Morse Road, Bldg. G Estuarine Reserves Division Columbus, Ohio 1305 East West Highway 43229-6693 Silver Spring, MD 20910 This management plan has been developed in accordance with NOAA regulations, including all provisions for public involvement. It is consistent with the congressional intent of Section 315 of the Coastal Zone Management Act of 1972, as amended, and the provisions of the Ohio Coastal Management Program. OWC NERR Management Plan, 2011 - 2016 Acknowledgements This management plan was prepared by the staff and Advisory Council of the Old Woman Creek National Estuarine Research Reserve (OWC NERR), in collaboration with the Ohio Department of Natural Resources-Division of Wildlife. Participants in the planning process included: Manager, Frank Lopez; Research Coordinator, Dr. David Klarer; Coastal Training Program Coordinator, Heather Elmer; Education Coordinator, Ann Keefe; Education Specialist Phoebe Van Zoest; and Office Assistant, Gloria Pasterak. Other Reserve staff including Dick Boyer and Marje Bernhardt contributed their expertise to numerous planning meetings. The Reserve is grateful for the input and recommendations provided by members of the Old Woman Creek NERR Advisory Council. The Reserve is appreciative of the review, guidance, and council of Division of Wildlife Executive Administrator Dave Scott and the mapping expertise of Keith Lott and the late Steve Barry. -

Slime Moulds
Queen’s University Biological Station Species List: Slime Molds The current list has been compiled by Richard Aaron, a naturalist and educator from Toronto, who has been running the Fabulous Fall Fungi workshop at QUBS between 2009 and 2019. Dr. Ivy Schoepf, QUBS Research Coordinator, edited the list in 2020 to include full taxonomy and information regarding species’ status using resources from The Natural Heritage Information Centre (April 2018) and The IUCN Red List of Threatened Species (February 2018); iNaturalist and GBIF. Contact Ivy to report any errors, omissions and/or new sightings. Based on the aforementioned criteria we can expect to find a total of 33 species of slime molds (kingdom: Protozoa, phylum: Mycetozoa) present at QUBS. Species are Figure 1. One of the most commonly encountered reported using their full taxonomy; common slime mold at QUBS is the Dog Vomit Slime Mold (Fuligo septica). Slime molds are unique in the way name and status, based on whether the species is that they do not have cell walls. Unlike fungi, they of global or provincial concern (see Table 1 for also phagocytose their food before they digest it. details). All species are considered QUBS Photo courtesy of Mark Conboy. residents unless otherwise stated. Table 1. Status classification reported for the amphibians of QUBS. Global status based on IUCN Red List of Threatened Species rankings. Provincial status based on Ontario Natural Heritage Information Centre SRank. Global Status Provincial Status Extinct (EX) Presumed Extirpated (SX) Extinct in the -

Biodiversity of Plasmodial Slime Moulds (Myxogastria): Measurement and Interpretation
Protistology 1 (4), 161–178 (2000) Protistology August, 2000 Biodiversity of plasmodial slime moulds (Myxogastria): measurement and interpretation Yuri K. Novozhilova, Martin Schnittlerb, InnaV. Zemlianskaiac and Konstantin A. Fefelovd a V.L.Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia, b Fairmont State College, Fairmont, West Virginia, U.S.A., c Volgograd Medical Academy, Department of Pharmacology and Botany, Volgograd, Russia, d Ural State University, Department of Botany, Yekaterinburg, Russia Summary For myxomycetes the understanding of their diversity and of their ecological function remains underdeveloped. Various problems in recording myxomycetes and analysis of their diversity are discussed by the examples taken from tundra, boreal, and arid areas of Russia and Kazakhstan. Recent advances in inventory of some regions of these areas are summarised. A rapid technique of moist chamber cultures can be used to obtain quantitative estimates of myxomycete species diversity and species abundance. Substrate sampling and species isolation by the moist chamber technique are indispensable for myxomycete inventory, measurement of species richness, and species abundance. General principles for the analysis of myxomycete diversity are discussed. Key words: slime moulds, Mycetozoa, Myxomycetes, biodiversity, ecology, distribu- tion, habitats Introduction decay (Madelin, 1984). The life cycle of myxomycetes includes two trophic stages: uninucleate myxoflagellates General patterns of community structure of terrestrial or amoebae, and a multi-nucleate plasmodium (Fig. 1). macro-organisms (plants, animals, and macrofungi) are The entire plasmodium turns almost all into fruit bodies, well known. Some mathematics methods are used for their called sporocarps (sporangia, aethalia, pseudoaethalia, or studying, from which the most popular are the quantita- plasmodiocarps). -

Slime Molds: Biology and Diversity
Glime, J. M. 2019. Slime Molds: Biology and Diversity. Chapt. 3-1. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Bryological 3-1-1 Interaction. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists. Last updated 18 July 2020 and available at <https://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology/>. CHAPTER 3-1 SLIME MOLDS: BIOLOGY AND DIVERSITY TABLE OF CONTENTS What are Slime Molds? ....................................................................................................................................... 3-1-2 Identification Difficulties ...................................................................................................................................... 3-1- Reproduction and Colonization ........................................................................................................................... 3-1-5 General Life Cycle ....................................................................................................................................... 3-1-6 Seasonal Changes ......................................................................................................................................... 3-1-7 Environmental Stimuli ............................................................................................................................... 3-1-13 Light .................................................................................................................................................... 3-1-13 pH and Volatile Substances -

The Mycetozoa of North America, Based Upon the Specimens in The
THE MYCETOZOA OF NORTH AMERICA HAGELSTEIN, MYCETOZOA PLATE 1 WOODLAND SCENES IZ THE MYCETOZOA OF NORTH AMERICA BASED UPON THE SPECIMENS IN THE HERBARIUM OF THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN BY ROBERT HAGELSTEIN HONORARY CURATOR OF MYXOMYCETES ILLUSTRATED MINEOLA, NEW YORK PUBLISHED BY THE AUTHOR 1944 COPYRIGHT, 1944, BY ROBERT HAGELSTEIN LANCASTER PRESS, INC., LANCASTER, PA. PRINTED IN U. S. A. To (^My CJriend JOSEPH HENRI RISPAUD CONTENTS PAGES Preface 1-2 The Mycetozoa (introduction to life history) .... 3-6 Glossary 7-8 Classification with families and genera 9-12 Descriptions of genera and species 13-271 Conclusion 273-274 Literature cited or consulted 275-289 Index to genera and species 291-299 Explanation of plates 301-306 PLATES Plate 1 (frontispiece) facing title page 2 (colored) facing page 62 3 (colored) facing page 160 4 (colored) facing page 172 5 (colored) facing page 218 Plates 6-16 (half-tone) at end ^^^56^^^ f^^ PREFACE In the Herbarium of the New York Botanical Garden are the large private collections of Mycetozoa made by the late J. B. Ellis, and the late Dr. W. C. Sturgis. These include many speci- mens collected by the earlier American students, Bilgram, Farlow, Fullmer, Harkness, Harvey, Langlois, Macbride, Morgan, Peck, Ravenel, Rex, Thaxter, Wingate, and others. There is much type and authentic material. There are also several thousand specimens received from later collectors, and found in many parts of the world. During the past twenty years my associates and I have collected and studied in the field more than ten thousand developments in eastern North America. -

The Classification of Lower Organisms
The Classification of Lower Organisms Ernst Hkinrich Haickei, in 1874 From Rolschc (1906). By permission of Macrae Smith Company. C f3 The Classification of LOWER ORGANISMS By HERBERT FAULKNER COPELAND \ PACIFIC ^.,^,kfi^..^ BOOKS PALO ALTO, CALIFORNIA Copyright 1956 by Herbert F. Copeland Library of Congress Catalog Card Number 56-7944 Published by PACIFIC BOOKS Palo Alto, California Printed and bound in the United States of America CONTENTS Chapter Page I. Introduction 1 II. An Essay on Nomenclature 6 III. Kingdom Mychota 12 Phylum Archezoa 17 Class 1. Schizophyta 18 Order 1. Schizosporea 18 Order 2. Actinomycetalea 24 Order 3. Caulobacterialea 25 Class 2. Myxoschizomycetes 27 Order 1. Myxobactralea 27 Order 2. Spirochaetalea 28 Class 3. Archiplastidea 29 Order 1. Rhodobacteria 31 Order 2. Sphaerotilalea 33 Order 3. Coccogonea 33 Order 4. Gloiophycea 33 IV. Kingdom Protoctista 37 V. Phylum Rhodophyta 40 Class 1. Bangialea 41 Order Bangiacea 41 Class 2. Heterocarpea 44 Order 1. Cryptospermea 47 Order 2. Sphaerococcoidea 47 Order 3. Gelidialea 49 Order 4. Furccllariea 50 Order 5. Coeloblastea 51 Order 6. Floridea 51 VI. Phylum Phaeophyta 53 Class 1. Heterokonta 55 Order 1. Ochromonadalea 57 Order 2. Silicoflagellata 61 Order 3. Vaucheriacea 63 Order 4. Choanoflagellata 67 Order 5. Hyphochytrialea 69 Class 2. Bacillariacea 69 Order 1. Disciformia 73 Order 2. Diatomea 74 Class 3. Oomycetes 76 Order 1. Saprolegnina 77 Order 2. Peronosporina 80 Order 3. Lagenidialea 81 Class 4. Melanophycea 82 Order 1 . Phaeozoosporea 86 Order 2. Sphacelarialea 86 Order 3. Dictyotea 86 Order 4. Sporochnoidea 87 V ly Chapter Page Orders. Cutlerialea 88 Order 6. -

Arcyria Cinerea (Bull.) Pers
Myxomycete diversity of the Altay Mountains (southwestern Siberia, Russia) 1* 2 YURI K. NOVOZHILOV , MARTIN SCHNITTLER , 3 4 ANASTASIA V. VLASENKO & KONSTANTIN A. FEFELOV *[email protected] 1,3V.L. Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences 197376 St. Petersburg, Russia, 2Institute of Botany and Landscape Ecology, Ernst-Moritz-Arndt University D-17487 Greifswald, Germany, 4Institute of Plant and Animal Ecology of the Russian Academy of Sciences Ural Division, 620144 Yekaterinburg, Russia Abstract ― A survey of 1488 records of myxomycetes found within a mountain taiga-dry steppe vegetation gradient has identified 161 species and 41 genera from the southeastern Altay mountains and adjacent territories of the high Ob’ river basin. Of these, 130 species were seen or collected in the field and 59 species were recorded from moist chamber cultures. Data analysis based on the species accumulation curve estimates that 75–83% of the total species richness has been recorded, among which 118 species are classified as rare (frequency < 0.5%) and 7 species as abundant (> 3% of all records). Among the 120 first species records for the Altay Mts. are 6 new records for Russia. The southeastern Altay taiga community assemblages appear highly similar to other taiga regions in Siberia but differ considerably from those documented from arid regions. The complete and comprehensive illustrated report is available at http://www.Mycotaxon.com/resources/weblists.html. Key words ― biodiversity, ecology, slime moulds Introduction Although we have a solid knowledge about the myxomycete diversity of coniferous boreal forests of the European part of Russia (Novozhilov 1980, 1999, Novozhilov & Fefelov 2001, Novozhilov & Lebedev 2006, Novozhilov & Schnittler 1997, Schnittler & Novozhilov 1996) the species associated with this vegetation type in Siberia are poorly studied. -

Myxomycetes in Bohemian Karst and Hřebeny Mts
C z e c h m y c o l . 53 (4), 2002 Myxomycetes in Bohemian Karst and Hřebeny Mts. R a d m il a D v o ř á k o v á Jihomoravské Muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo, Czech Republic E-mail: [email protected] Dvořáková R. (2002): Myxomycetes in Bohemian Karst and Hřebeny Mts. - Czech Mycol. 53: 319-349 Data on species composition and ecology of Myxomycetes are presented for three National Reserves in the Bohemian Karst and the northern part of Hřebeny Mountains. During a period of three years, all localities were investigated intensively. In addition to field collections, bark of living trees, twigs and dead leaves were cultivated in moist chambers. Specimens from the National Museum in Prague were revised. Ninety-five species of Myxomycetes belonging to 29 genera were registered with certainty, 17 of these new to the Czech Republic. Species descriptions are provided for newly recorded species including microhabitat preferences. Differences between species diversity in the Bohemian Karst and Hřebeny Mts. are discussed as well as the seasonal dynamics of Myxomycetes in Central European conditions. K ey words: Myxomycetes, Bohemian Karst, Hřebeny Mts., Species diversity, Moist chamber culture Dvořáková R. (2002): Hlenky (Myxomycetes) v Českém krasu a na Hřebenech. - Czech Mycol. 53: 319-349 V letech 1996-1999 probíhal průzkum myxomycetů (hlenek) v NPR Karlštejn, Koda a Ra- dotínské údolí a v severní části Hřebenů. Vedle sběru v terénu a revize herbářových položek v Národním Muzeu v Praze byla využita metoda kultivace hlenek ve vlhkých komůrkách. Je uveden přehled 95 zastoupených druhů hlenek patřících do 29 rodů spolu s popisem a podrobnějšími údaji k 17 druhům novým pro ČR. -

ARCYRIA STIPATA Fungi and Bacteria No
IMI Descriptions of ARCYRIA STIPATA Fungi and Bacteria No. 1913 A. Sporocarps, habit (bar = 1 mm). B. Colony with sporocarps on a living snail (bar = 5 mm). C. Capillitium and spores (bar = 20 µm). D. Spores (bar = 10 µm). [Photographs: A. Michaud] Arcyria stipata (Schwein.) Lister, A Monograph of the Mycetozoa: 189 (1894). [IndexFungorum 184737] Leangium stipatum Schwein., Transactions of the American Philosophical Society of Philadelphia New Series 4: 258 (1832). [IndexFungorum 186504] Hemiarcyria stipata (Schwein.) Rostaf., Śluzowce (Mycetozoa) Monografia Supplementum 1: 41 (1876). [IndexFungorum 182706] Hemitrichia stipata (Schwein.) T. Macbr., The North American Slime Moulds: 204 (1899). [IndexFungorum 179442] Diagnostic features. The almost pseudoaethalial habit, persistent peridium and copper colour make this species distinctive. Habit. On dead wood, and occasionally other substrata. Plasmodium yellow, then white, becoming pink as the sporangia ripen. Sporocarps sessile or short-stalked, erect or ± superimposed and then subsessile, very densely crowded and (in large colonies) appressed, often resembling a pseudoaethalium, shining coppery pink, or copper to reddish ochraceous in the fresh state, metallic, often with lavender or rose tints, browning with age, 0·8–3 mm high. Hypothallus shared, membranous, dark brown, confluent. Stalk very short, 0·1– 1·5 mm tall, often appearing to be absent, red-brown or dark brown, filled with round cells c. 13 µm diam. Sporangia ± cylindrical, erect or curved, 0·8–1 × 0·5–0·8 mm, with a ± deep calyculus which is smooth or decorated with very fine papillae sometimes arranged in lines. Peridium, in separate sporothecae, evanescent above and leaving a shallow cup, persistent in pseudoaethaliate forms and then splitting into lobes, persistent, shining, often iridescent, red with copper reflexions. -

Annotated Checklist of the Myxomycetes (Slime Molds) Observed at the Gordon Natural Area West Chester University, PA) - Version I
West Chester University Digital Commons @ West Chester University Gordon Natural Area Biodiversity Studies Documents Gordon Natural Area Biodiversity Studies 7-24-2020 Annotated Checklist of the Myxomycetes (Slime Molds) Observed at the Gordon Natural Area West Chester University, PA) - Version I Nur Ritter Paige Vermeulen Maribeth Beatty Arianna Rivellini Alexandra Hodowanec Follow this and additional works at: https://digitalcommons.wcupa.edu/gna_bds_series Part of the Biodiversity Commons Annotated Checklist of the Myxomycetes (Slime Molds) Observed at the Gordon Natural Area West Chester University, PA) - Version I Description This checklist was compiled from Gordon Natural Area (GNA) Staff fieldwork during 2017-2020, augmented by photos from students and visitors to the GNA. The checklist contains 34 species in 18 Genera and 11 Families. Common Names Common names marked with an asterisk are those that were 'assigned' to a species by GNA staff. 'Monthly Presence' Data were taken from four sources: 1) fieldwork in the GNA; 2) the mycological literature; 3) field trip data from the New Jersey Mycological Association, New York Mycological Society, and the Western Pennsylvania Mushroom Club (see References); and, 4) observations in iNaturalist for Pennsylvania and six 'nearby' states: Connecticut, Delaware, Maryland, New Jersey, New York, and Ohio; (Data last updated: 7/7/2020). Associated Plants' GNA data are from field observations from 2017 to present. 'Literature' data were primarily taken from the USDA National Fungus Collection's Fungus-Host database (https://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/fungushost/fungushost.cfm), supplemented by a small number of observations from the literature. Species in red are non- native to Pennsylvania. -
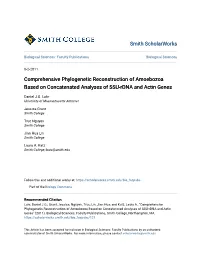
Comprehensive Phylogenetic Reconstruction of Amoebozoa Based on Concatenated Analyses of SSU-Rdna and Actin Genes
Smith ScholarWorks Biological Sciences: Faculty Publications Biological Sciences 8-2-2011 Comprehensive Phylogenetic Reconstruction of Amoebozoa Based on Concatenated Analyses of SSU-rDNA and Actin Genes Daniel J.G. Lahr University of Massachusetts Amherst Jessica Grant Smith College Truc Nguyen Smith College Jian Hua Lin Smith College Laura A. Katz Smith College, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.smith.edu/bio_facpubs Part of the Biology Commons Recommended Citation Lahr, Daniel J.G.; Grant, Jessica; Nguyen, Truc; Lin, Jian Hua; and Katz, Laura A., "Comprehensive Phylogenetic Reconstruction of Amoebozoa Based on Concatenated Analyses of SSU-rDNA and Actin Genes" (2011). Biological Sciences: Faculty Publications, Smith College, Northampton, MA. https://scholarworks.smith.edu/bio_facpubs/121 This Article has been accepted for inclusion in Biological Sciences: Faculty Publications by an authorized administrator of Smith ScholarWorks. For more information, please contact [email protected] Comprehensive Phylogenetic Reconstruction of Amoebozoa Based on Concatenated Analyses of SSU- rDNA and Actin Genes Daniel J. G. Lahr1,2, Jessica Grant2, Truc Nguyen2, Jian Hua Lin2, Laura A. Katz1,2* 1 Graduate Program in Organismic and Evolutionary Biology, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, United States of America, 2 Department of Biological Sciences, Smith College, Northampton, Massachusetts, United States of America Abstract Evolutionary relationships within Amoebozoa have been the subject -

First Records of Arcyria Marginoundulata Nann.-Bremek
ACTA MYCOLOGICA Dedicated to Professor Maria Ławrynowicz Vol. 48 (2): 279–285 on the occasion of the 45th anniversary of her scientific activity 2013 DOI: 10.5586/am.2013.030 First records of Arcyria marginoundulata Nann.-Bremek. & Y. Yamam. (Myxomycetes) in Poland ANNA RONIKIER1, PIOTR PERZ2 and PIOTR CHACHUŁA3 1Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, [email protected] 2Z. Nałkowskiej 12, PL-57-300 Kłodzko, [email protected] 3Pieniński Park Narodowy, Jagiellońska 107B, PL-34-450 Krościenko nad Dunajcem [email protected] Ronikier A., Perz P., Chachuła P.: First records of Arcyria marginoundulata Nann.-Bremek. & Y. Yamam. (Myxomycetes) in Poland. Acta Mycol. 48 (2): 279–285, 2013. A new to Poland species of a myxomycete, Arcyria marginoundulata, was found at two distant localities in the southern part of the country. Polish specimens are typical and have all important features characteristic of the species: minute, grey, stipitate sporocarps, calyculus concentrically plicate at margin, spiny capillitium and small spores covered with few irregularly distributed larger warts. The species was found growing on alder female catkins. It seems that this substrate is specific forA. marginoundulata in Europe. Key words: Arcyria globosa, Arcyriaceae, the Carpathians, Mycetozoa, Protozoa, the Sudetes INTRODUCTION The genus Arcyria belongs to the order Trichiales and family Arcyriaceae within the class Myxomycetes. It includes 50 species (Lado 2005-2013). Species of Arcyria are characterized by usually stalked sporocarps covered by fugacious peridium remain- ing at the base as calyculus, pale spores and elastic capillitium forming a network (e.g. Poulain et al. 2011a).