Konzert Dudamel B.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks 16 17
16 17 SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS Donnerstag 23.3.2017 Freitag 24.3.2017 Sonderkonzert Herkulessaal 20.00 – ca. 21.50 Uhr 16 / 17 HERBERT BLOMSTEDT Leitung MARK PADMORE – Tenor (Evangelist) (»Artist in Residence«) PETER HARVEY – Bariton (Christus) Solisten der Arien ANNA PROHASKA Sopran ELISABETH KULMAN Mezzosopran ANDREW STAPLES Tenor KREŠIMIR STRAŽANAC Bassbariton CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS Einstudierung: Michael Gläser Soliloquenten Priska Eser – Sopran (Magd) Q-Won Han – Tenor (Diener) Andreas Burkhart – Bass (Pilatus) Christof Hartkopf – Bass (Petrus) SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS Vittorio Ghielmi -– Viola da gamba Basso continuo Hanno Simons – Violoncello Evangelina Mascardi – Laute Lukas Maria Kuen – Orgel PROGRAMM Johann Sebastian Bach »Passio secundum Joannem« (»Johannes-Passion«) für Soli, Chor und Orchester in zwei Teilen BWV 245 Die Passion wird ohne Pause aufgeführt. KONZERTEINFÜHRUNG 18.45 Uhr Donnerstag, 23.3.2017: Moderation: Markus Thiel Gast: Dr. Norbert Roth, Pfarrer von St. Matthäus München Freitag, 24.3.2017: Moderation: Amélie Pauli LIVE-ÜBERTRAGUNG IN SURROUND im Radioprogramm BR-KLASSIK Freitag, 17.3.2017 ON DEMAND Das Konzert ist in Kürze auf br-klassik.de als Audio abrufbar. »Eine schreckliche Kraft« Von der Kirche in den Konzertsaal: Bachs Johannes-Passion Wolfgang Stähr Entstehungszeit 1724 mit Revisionen bei späteren Aufführungen Uraufführung 7. April 1724, Karfreitag, im Vespergottesdienst der Leipziger Nicolaikirche unter der Leitung des Komponisten Lebensdaten des Komponisten 21. März 1685 in Eisenach – 28. Juli 1750 in Leipzig Ist es eine Laune des Zufalls oder der Wille Gottes? Diese Frage gehört normalerweise nicht zur Kernkompetenz der Musikhistoriker, aber mitunter kommen sie doch ins Grübeln. Man stelle sich einmal vor, Mozart wäre so alt geworden wie Bach: Dann hätte er 1793 die angestrebte Position des Domkapellmeisters an der Wiener Stephanskirche antreten können. -

Handel Rinaldo Tuesday 13 March 2018 6.30Pm, Hall
Handel Rinaldo Tuesday 13 March 2018 6.30pm, Hall The English Concert Harry Bicket conductor/harpsichord Iestyn Davies Rinaldo Jane Archibald Armida Sasha Cooke Goffredo Joélle Harvey Almirena/Siren Luca Pisaroni Argante Jakub Józef Orli ´nski Eustazio Owen Willetts Araldo/Donna/Mago Richard Haughton Richard There will be two intervals of 20 minutes following Act 1 and Act 2 Part of Barbican Presents 2017–18 We appreciate that it’s not always possible to prevent coughing during a performance. But, for the sake of other audience members and the artists, if you feel the need to cough or sneeze, please stifle it with a handkerchief. Programme produced by Harriet Smith; printed by Trade Winds Colour Printers Ltd; advertising by Cabbell (tel 020 3603 7930) Please turn off watch alarms, phones, pagers etc during the performance. Taking photographs, capturing images or using recording devices during a performance is strictly prohibited. If anything limits your enjoyment please let us know The City of London during your visit. Additional feedback can be given Corporation is the founder and online, as well as via feedback forms or the pods principal funder of located around the foyers. the Barbican Centre Welcome Tonight we welcome back Harry Bicket as delighted by the extravagant magical and The English Concert for Rinaldo, the effects as by Handel’s endlessly inventive latest instalment in their Handel opera music. And no wonder – for Rinaldo brings series. Last season we were treated to a together love, vengeance, forgiveness, spine-tingling performance of Ariodante, battle scenes and a splendid sorceress with a stellar cast led by Alice Coote. -

NEWSLETTER of the American Handel Society
NEWSLETTER of The American Handel Society Volume XXI, Number 3 Winter 2006 AMERICAN HANDEL SOCIETY- PRELIMINARY SCHEDULE (Paper titles and other details of program to be announced) Thursday, April 19, 2006 Check-in at Nassau Inn, Ten Palmer Square, Princeton, NJ (Check in time 3:00 PM) 6:00 PM Welcome Dinner Reception, Woolworth Center for Musical Studies Covent Garden before 1808, watercolor by Thomas Hosmer Shepherd. 8:00 PM Concert: “Rule Britannia”: Richardson Auditorium in Alexander Hall SOME OVERLOOKED REFERENCES TO HANDEL Friday, April 20, 2006 In his book North Country Life in the Eighteenth Morning: Century: The North-East 1700-1750 (London: Oxford University Press, 1952), the historian Edward Hughes 8:45-9:15 AM: Breakfast, Lobby, Taplin Auditorium, quoted from the correspondence of the Ellison family of Hebburn Hall and the Cotesworth family of Gateshead Fine Hall Park1. These two families were based in Newcastle and related through the marriage of Henry Ellison (1699-1775) 9:15-12:00 AM:Paper Session 1, Taplin Auditorium, to Hannah Cotesworth in 1729. The Ellisons were also Fine Hall related to the Liddell family of Ravenscroft Castle near Durham through the marriage of Henry’s father Robert 12:00-1:30 AM: Lunch Break (restaurant list will be Ellison (1665-1726) to Elizabeth Liddell (d. 1750). Music provided) played an important role in all of these families, and since a number of the sons were trained at the Middle Temple and 12:15-1:15: Board Meeting, American Handel Society, other members of the families – including Elizabeth Liddell Prospect House Ellison in her widowhood – lived in London for various lengths of time, there are occasional references to musical Afternoon and Evening: activities in the capital. -
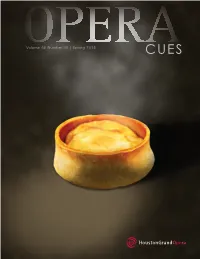
Spring 2015 CUES Internet at the Speed of Whoa
OPERAVolume 55 Number 05 | Spring 2015 CUES Internet at the speed of whoa. XFINITY® Internet delivers the fastest and most reliable in-home WiFi for all rooms, all devices, all the time. To learn more call 866-620-9714 or visit comcast.com Restrictions apply. Not available in all areas. Features and programming vary depending on area and level of service. WiFi claims based on April and October 2013 study by Allion Test Labs, Inc. Actual speeds vary and are not guaranteed. Reliably fast speed based on February 2013 FCC Broadband Report. Call for restrictions and complete details. ©2014 Comcast. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners. DIE WALKÜRE APRIL 18, 22, 25, 30 MAY 3 SWEENEY TODD APRIL 24, 26, 29 MAY 2, 8, 9 PATRICK SUMMERS PERRYN LEECH ARTISTIC & MUSIC DIRECTOR MANAGING DIRECTOR Margaret Alkek Williams Chair ADVERTISE IN OPERA CUES Opera Cues is published by Houston Grand Opera Association; all rights reserved. Opera Cues is produced by Houston Grand Opera’s Communications Department, Judith Kurnick, director. Director of Publications Laura Chandler Art Direction / Production Pattima Singhalaka Contributors Kim Anderson Paul Hopper Perryn Leech Elizabeth Lyons Patrick Summers For information on all Houston Grand Opera productions and events, or for a complimentary season brochure, please call the Customer Care Center at 713-228-OPERA (6737). Houston Grand Opera is a member of OPERA America, Inc., and the Theater District Association, Inc. Find HGO online: HGO.org facebook.com / houstongrandopera twitter.com / hougrandopera instagram.com/hougrandopera Readers of Houston Grand Opera’s Opera Cues magazine are the Mobile: HGO.org most desirable prospects for an advertiser’s message. -

Werden Sie Mitglied Become a Member
Umschlag_23.9. 02.10.2008 10:40 Uhr Seite 2 G. F. Händel, Grisaille-Malerei von Carl Jaeger (1870/71) Werden Sie Mitglied Become a member ... ... der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft e. V. oder des Freundeskreises des Händel-Hauses e. V. Sie unterstützen durch Ihre Mitgliedschaft die Arbeit der Vereine. Außerdem erhalten Sie das Vorbestellrecht für die Veranstaltungen der Händel-Festspiele. ... of the Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft e. V. (Handel Society) or the Freundeskreis des Händel-Hauses e. V. (Circle of Friends of Handel House). Your membership supports the work of these associations. Moreover, it gives you priority when booking for Handel Festival concerts. Info: Stiftung Händel-Haus, Große Nikolaistraße 5, 06108 Halle (Saale), [email protected], www.haendelhaus.de Umschlag_23.9. 02.10.2008 10:40 Uhr Seite 3 VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK Händel - Der Europäer 2009 Fr 20.02. 1 „Barockstar – Händels Reise ...“ Händel-Haus So 07.06. 30 Floridante OPER HALLE 2 Belshazzar OPER HALLE 31 Kastraten Löwengebäude (Aula der MLU) Sa 21.02. 3 „Viva il caro Sassone“ Händel-Haus Mo 08.06. 32 Florilegium Konzerthalle Ulrichskirche So 22.02. 4 Händel und Luther (Exkursion) Marktkirche zu Halle 33 Triumpf of time OPER HALLE 5 Händel und Luther (Konzert) Marktkirche zu Halle Di 09.06. 34 Ein Händel-Chorfest Dom zu Halle Sa 07.03. 6 Belshazzar OPER HALLE 35 Opern-Gala Franckesche Stiftungen Sa 14.03. 7 Warum in die Ferne schweifen...? Händel-Haus 36 Kastraten Löwengebäude (Aula der MLU) Mi 11.04. 8 Ariodante OPER HALLE Mi 10.06. 37 Reise zu F. M. Bartholdy Hallmarkt So 19.04. -

Stabat Mater
DVORÁK STABAT MATER for soloists, choir and piano Kleiter · Romberger · Korchak · Nazmi Chor des Bayerischen Rundfunks Julius Drake Howard Arman ANTONÍN DVORˇ ÁK 1841–1904 STABAT MATER Fassung von 1876 für Soli, Chor und Klavier, op. 58 Version of 1876 for soloists, choir and piano, op. 58 01 Stabat mater dolorosa (Soli und Chor) 17:39 02 Quis est homo, qui non fleret (Soli) 9:53 03 Eja, mater, fons amoris (Chor) 6:06 04 Fac, ut ardeat cor meum (Bass-Solo und Chor) 7:33 05 Fac, ut portem Christi mortem (Sopran-/Tenor-Solo) 5:14 06 Inflammatus et accensus (Alt-Solo) 5:56 07 Quando corpus morietur (Soli und Chor) 6:32 Total time 58:53 JULIA KLEITER Sopran / soprano GERHILD ROMBERGER Alt / alto DMITRY KORCHAK Tenor / tenor TAREQ NAZMI Bass / bass JULIUS DRAKE Klavier / piano CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS HOWARD ARMAN Dirigent / conductor ANTONÍN DVORˇ ÁK (1879) WAS ZU ENDE BLEIBT des Opernensembles sangen im Chor unter der Leitung von Josef Foerster, dem „tschechischen Bruckner“ (und Dvorˇáks vormaligem Lehrer an der Or- ANTONÍN DVORˇ ÁKS STABAT MATER gelschule). Ein anderer Zeitzeuge erinnerte sich: „Die Messen mit prunkvoller orchestraler Begleitung verstummten, statt ihrer führte Foerster, ein Anhänger Der Anfang klingt wie nach jahrelangem Schweigen. Zum ersten Mal seit der Reformbestrebungen in der Kirchenmusik, Messen mit schlichter Orgelbe- Ewigkeiten wird der Flügel aufgedeckt, die Klaviatur aufgeklappt, vorsichtig gleitung oder A-cappella-Werke auf. Zu besonderem Ruf gelangte die Adalbert- eine Taste angeschlagen, dann eine zweite, eine dritte, ob das Instrument noch kirche durch die stilgerechte Wiedergabe von Messen und anderen Kompositi- stimmt, ob die Töne noch ansprechen, die Oktaven werden ausprobiert, ein onen des großen Klassikers der Kirchenmusik, Palestrina.“ Akkord angedeutet, ob alles überhaupt noch einen Sinn ergibt. -

Music, Migration & Mobility
Music, Migration & Mobility The Legacy of Migrant Musicians from Nazi Europe in Britain Thursday, 3 December 2020 Co-hosted by the Austrian Cultural Forum Meeting Agenda 9.45 Zoom call opens, informal chats possible in breakout rooms 10.00 Opening words by ACF Director Waltraud Dennhardt-Herzog and RCM Director Colin Lawson Session 1—chaired by Colin Lawson (Royal College of Music) 10.15 Norbert Meyn (Royal College of Music)— Trees have roots, humans have legs: foregrounding migration and mobility in performances 10.30 Beth Snyder (Royal College of Music)— Negotiating Nationalisms: the foundation and early activities of the Anglo-Austrian Music Society 10.45 Q&A for Session 1 11.00 Short Break Session 2—chaired by Richard Wistreich (Royal College of Music) 11.15 Peter Adey (Royal Holloway, University of London)— ‘Where music flows like money’: mobility, migration and magnetism at Glyndebourne 11.30 Nils Grosch (Salzburg University)— ‘I don’t want to wait until it is too late again’: Push and pull factors for operatic concepts around Glyndebourne’s émigrés 11.45 Q&A for Session 2 1 12.00 Short Break Concert 12.15 With Ensemble Émigré and students from the Royal College of Music featuring works by Hans Gál, Egon Wellesz and Mátyás Seiber Norbert Meyn, tenor Catherine Hooper, soprano Lucy Colquhoun, piano Christopher Gould, piano Jack Campbell, piano 13.00 Lunch Break Session 3—chaired by Beth Snyder (Royal College of Music) 14.00 Florian Scheding (University of Bristol)— Performing migration: Mátyás Seiber’s Ulysses 14.30 Alison Garnham— Nationalism and internationalism in the post-war BBC Panel Discussion—chaired by Norbert Meyn (Royal College of Music) 15.00 With project team members as well as: Carolin Stahrenberg (Bruckner University Linz) Simone Gigliotti (Royal Holloway, University of London) Erik Levi (Royal Holloway, University of London) Michael Haas (ExilArte Center, University of Music and Performing Arts, Vienna) 16.00 Event concludes 2 Concert Programme Selections from Twenty-Four Preludes, vol. -
Pdf-Dokument
MUSIK - CDs CD.Sbo 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Arcadian duets / Georg Friedrich Händel. Natalie Dessay ; Gens, Veronique …[s.l.] : Erato Disques, 2018. – 2 CDs Interpr.: Dessay, Natalie ; Veronique Gens CD. Sbo 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Cembalosuiten (1720) Nr. 1 – 8 / Georg Friedrich Händel. Laurence Cummings.- [s.l.] : Somm, 2017. – 2 CDs Interpr.: Cummings, Laurence ; London Handel Orchestre CD. Sbo 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Cembalowerke /Georg Friedrich Händel. Philippe Grisvard ; William Babell ; Friedrich Wilhelm Zachow … [s.l.] : audax, 2017.- Interpr.: Grisvard, Philippe ; Babell, William ; Zachow, Friedrich Wilhelm CD. Sbs 2 / Haen Händel Händel, Georg Friedrich: Arien / Georg Friedrich Händel. Bernadette Greevy ; Joan Sutherland … [s.l.] : Decca, 2017.- 2 CDs Interpr.: Greevy, Bernadette ; Sutherland, Joan CD. Sbs 2 / Haen Händel Händel, Georg Friedrich: Silla / Georg Friedrich Händel. James Bowman ; Simon Baker… [s.l.] : Somm, 2017.- 2 CDs Interpr.: Bowman, James ; Baker, Simon CD. Sbs 2 /Haen Händel Händel, Georg Friedrich: Instrumentalmusiken aus Opern & Oratorien / Georg Friedrich Händel. London Handel Players [s.l.] : Somm, 2017.- 1 CD Interpr.: London Handel Players 1 CD.Sbq 3 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Aci, Galatea e Polifemo : Serenata. Napoli, 1708 / Handel. Roberta Invernizzi ... La Risonanza. Fabio Bonizzoni. - San Lorenzo de El Escorial : note 1 music, 2013. - 2 CDs + Beih. Interpr.: Bonizzoni, Fabio [Dir.] ; Invernizzi, Roberta ; La Risonanza CD.Sbs 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Alessandro : live recorded at Badisches Staatstheater Karlsruhe / G. F. Handel. Lawrence Zazzo ... Deutsche Händel-Solisten on period instruments. Michael Form. - [S.l.] : note 1 music, 2012. - 3 CDs + Beih. Interpr.: Form, Michael; Zazzo, Lawrence; Deutsche Händel-Solisten CD.Sbs 2 / Haen HÄNDEL Händel, Georg Friedrich: Alessandro / Handel. -

OWEN WILLETTS, Contratenor
CNDM | UNIVERSO BARROCO AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 11.03.18 | THE ENGLISH CONCERT OWEN WILLETTS, contratenor Los compromisos actuales y futuros de Owen Willetts incluyen: Oberon (Midsummer Night’s dream) en la Virginia Opera, Ottone (L' Incoronazione di Poppea) en la en la Pinchgut Opera y Theater Aachen, Narciso (Agrippina) en Oldenburgisches Staatstheater, Händel Festspiele Göttingen y Brisbane Baroque, Tolomeo (Giulio Cesare) en Theater Bonn, Tullio (Arminio) en Badisches Staatstheater Karlsruhe y Theater an der Wien, un tour con Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Eustazio (Rinaldo) y Giustino (rol principal) en Lautten Compagney Berlin, Il trionfo del tempo e del disinganno en Opernhaus Halle, el Mesías (Haendel) en Ulster Orchestra y el Stabat Mater (Pergolesi) con la Orchestra of the Age of Enlightenment. Owen cantó en el coro en la catedral de Lichfield y estudió en la Academia Real de Música, con Noelle Barker, Iain Leadingham y David Lowe. Recientemente Owen ha cantado Orlando (rol principal) en el Theater Heilbronn, Helicon (Caligula) en Staatsoper Hannover, Andronico (Tamerlano) en Buxton Festival, Farinelli and the King (rol principal) en Duke of York Theatre, Famigliari (The Coronation of Poppea) en Opera North, Summer (The Fairy Queen) y la Pasión según San Juan (Bach) en Nationale Reisopera, el rol principal de la ópera Giulio Cesare (Haendel) en Finnish National Opera, Orfeo (Orfeo ed Euridice) y Arsace (Partenope) en Boston Baroque (Martin Pearlman). También ha participado en el Proyecto Jerwood: Awakening Shadow una dramatización de Britten, Canticles en Glyndebourne, el Mesías de Haendel con la Portland Baroque Orchestra, Ottone (L' Incoronazione di Poppea) en la Royal Academy Opera, Reykjavik Summer Opera e Iford Arts Festival, Anfinomus/Humano Fragilitata (Il Ritorno d' Ulisse in Patria) con la Birmingham Opera Company. -

Der Händel-Festspiele
AUSGABE 2013 AUSGABE MAGAZIN DER HÄNDEL-FESTSPIELE Photo: Beetroot MACHT UND MUSIK | DAS THEMA DER FESTSPIELE FESTSPIEL-NEWS | DIE HÄNDEL-OPER ALESSANDRO AUF EINEN BLICK | KALENDARIUM MIT ALLEN FESTSPIELTERMINEN UND KÜNSTLERVERZEICHNIS DIE STIFTUNG HÄNDEL-HAUS DANKT IHREN FÖRDERERN UND SPONSOREN IHREN PARTNERN STADTMARKETING IHREN MEDIEN- UND KULTURPARTNERN Inhalt Händel, Komponist Händel als Staatskomponist? Die Händel-Preisträgerin 2013 Akustisches Klonen im Umfeld der Macht Die Jahresausstellung 2013 Seite 18 Seite 36 Seite 10 im Händel-Haus Seite 14 FESTSPIELTHEMA: MACHT UND MUSIK 1010 Händel, Komponist im Umfeld der Macht Das neue Erscheinungsbild der Händel-Festspiele 2014 Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann Seite 34 1414 Händel als Staatskomponist? Zur Jahresausstellung 2013 im Händel-Haus HÄNDEL-NEWS Dr. Lars Klingberg 36 Akustisches Klonen Neue Wege zum Schutze des Originals FESTSPIEL-NEWS Christiane Barth 1818 Magdalena Kožená 40 Neu: Studien der Stiftung Händel-Haus Die Händel-Preisträgerin 2013 Dr. Konstanze Musketa Patricia Reese 42 Musikalische Schatzkammer 2020 Die Händel-Oper Alessandro Die Sammlung früher Händel-Notendrucke Krieg der Töne der Stiftung Händel-Haus Patricia Reese Jens Wehmann 2222 Vorgestellt! Schloss und Patronatskirche Ostrau KOMPENDIUM Eine neue Spielstätte im Festspielprogramm Dr. Erik Dremel 4466 Festspielkalender Alle Veranstaltungen auf einen Blick 26 […nach Luther…] 26 56 Künstlerverzeichnis Dr. Erik Dremel 56 der Händel-Festspiele 2013 2828 Festspielsplitter 58 Veranstaltungsorte 34 Händel verzaubert 58 Rund um die Händel-Festspiele 34 Das neue Erscheinungsbild 59 60 Museumsshop im Händel-Haus der Händel-Festspiele 2014 60 Anja Telzer 62 Impressum Händel-Festspiele Magazin 2013 3 www.saalesparkasse.de Gut für die Musikfreunde des Barock und das Kulturleben in der Region. -

Magazin Konzert 2016 Zum Download
SALZBURGER FESTspIELE 2016 GIOVANNI ANTONINI · HOWARD ARMAN · DANIEL BARENBOIM · HERBERT BLOMSTEDT · IVOR BOLTON · LIONEL BRINGUIER · SYLVAIN CAMBRELING · CONSTANTINOS CARYDIS · RICCARDO CHAILLY · VLADISLAV CHERNUSHENKO · OTTAVIO DANTONE · PETER EÖTVÖS · ÁDÁM FISCHER · DANIELE GATTI · MICHAEL GHATTAS · VITTORIO GHIELMI · WOLFGANG GÖTZ · HK GRUBER · DANIEL HARDING · NIKOLAUS HARNONCOURT · MARISS JANSONS · PHILIPPE JORDAN · ADRIAN KELLY · VácLAV LUKS · NEVILLE MARRINER · ZUBIN MEHTA · CORNELIUS MEISTER · 64 KONZERT RICCARDO MUTI · YANNICK NÉZET-SÉGUIN · ROGER NORRINGTON · ANDRÉS OROZCO-ESTRADA · ANAHIT PAPAYAN · SIMON RATTLE · JORDI SAVALL · LORENZO VIOTTI · FRANZ WELSER-MÖST · CAMERATA SALZBURG · KAMMERKONZERTE · LIEDERABENDE · MOZART-MATINEEN MOZARTEUMORCHESTER SALZBURG · NESTLÉ AND SALZBURG FESTIVAL YOUNG CONDUCTORS AWARD · ORCHESTER ZU GAST · OUVERTURE SPIRITUELLE · SALZBURG 20.16 · SALZBURG CONTEMPORARY · SOLISTENKONZERTE · WIENER PHILHARMONIKER · YOUNG SINGERS PROJECT 65 SALZBURGER FESTspIELE 2016 VORWORT SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN Anlässlich der 200-jährigen Zugehörigkeit Salzburgs zu Österreich (Salzburg 20.16) befassen wir uns in der Ex oriente lux – aus dem Osten kommt das Licht. Ouverture spirituelle in einem weiteren Schwerpunkt Nach der musikalischen Beleuchtung vier großer musikalisch mit geistlichen Werken von Komponisten, Weltreligionen – Judentum, Buddhismus, Islam, die Salzburg besonders geprägt haben. Dazu gehören Hinduismus – in den letzten vier Festspielsommern neben den Hofkapellmeistern Heinrich Ignaz Franz richten -

Swr2 Programm Kw 36
SWR2 PROGRAMM - Seite 1 - KW 36 / 06. - 12.09.2021 Antonio Salieri: kalische Grenzen. Deshalb werden in Montag, 06. September Konzert C-Dur Hamburg neue Häuser auf flutsichere Dagmar Becker (Flöte) Sockel gestellt, in Rostock könnte der 0.03 ARD-Nachtkonzert Lajos Lencsés (Oboe) geliebte Hafen meterhoch eingedämmt Richard Strauss: Württembergisches Kammerorchester werden. In Rotterdam stehen bereits „Metamorphosen“ Heilbronn „lebende“ Deiche mit integrierten Kauf- Sächsische Staatskapelle Dresden Leitung: Jörg Faerber häusern. An Küsten, Häfen und in riesi- Leitung: Christian Thielemann gen Laboren erforschen Wissenschaft- Ralph Vaughan Williams: 5.00 Nachrichten, Wetter ler*innen, wie sich Wellenformen und „Flos Campi“ Gezeiten ändern, Küstenstädte auch in Herbert Kleiner (Viola) 5.03 ARD-Nachtkonzert Zukunft bewohnbar bleiben können. MDR Rundfunkchor Josef Mysliveček: MDR Sinfonieorchester „Il Demetrio“, Ouvertüre 8.58 SWR2 Programmtipps Leitung: Howard Arman L’Orfeo Barockorchester Sergej Rachmaninow: Leitung: Michi Gaigg 9.00 Nachrichten, Wetter „Corelli-Variationen“ op. 42 Franz Danzi: Alberto Ferro (Klavier) Allegretto aus dem 9.05 SWR2 Musikstunde Georg Philipp Telemann: Klavierkonzert Es-Dur op. 4 Franz Schubert entdecken (1/5) „Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten“ Nareh Arghamanyan (Klavier) Mit Wolfgang Sandberger TWV 15:2 Münchener Kammerorchester Magdalena Podkoscielna (Sopran) Leitung: Howard Griffiths Robert Schumann ist begeistert, als er Andreas Post (Tenor) Louis Spohr: die „große“ C-Dur-Sinfonie von Franz Matthias Vieweg, Ekkehard Abele (Bass) Finale aus dem Nonett F-Dur op. 31 Schubert entdeckt. Franz Liszt ist faszi- Telemannisches Collegium Michaelstein Academy of St. Martin in the Fields niert von den Liedern und entdeckt Leitung: Ludger Rémy Chamber Ensemble auch den Musikdramatiker. Er dirigiert Eugen d’Albert: Alexander Glasunow: die erste Aufführung von Schuberts „Aschenputtel“, Suite op.