Die Mährischen Brüder
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
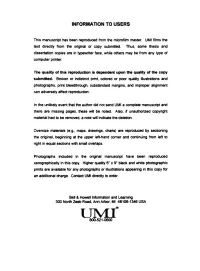
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect repmduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscn'pt and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing fmm left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manusuipt have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6' x 9' black and white photographic prints are available for any photographs or illustmtions appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. Bell 8 HowaH Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, MI 48106-1346 USA EARLY SEVENTEENTH CENTURY MENNONITE CONFESSIONS OF FAITH: THE DEVELOPMENT OF AN ANABAPTIST TRADITION by Karl Peter Koop A Thesis submitted to the Faculty of Theology of the University of St. Michae18s College and the Department of Theology of the Toronto School of Theology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Theology awarded by the University of St. -

A Study of Early Anabaptism As Minority Religion in German Fiction
Heresy or Ideal Society? A Study of Early Anabaptism as Minority Religion in German Fiction DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Ursula Berit Jany Graduate Program in Germanic Languages and Literatures The Ohio State University 2013 Dissertation Committee: Professor Barbara Becker-Cantarino, Advisor Professor Katra A. Byram Professor Anna Grotans Copyright by Ursula Berit Jany 2013 Abstract Anabaptism, a radical reform movement originating during the sixteenth-century European Reformation, sought to attain discipleship to Christ by a separation from the religious and worldly powers of early modern society. In my critical reading of the movement’s representations in German fiction dating from the seventeenth to the twentieth century, I explore how authors have fictionalized the religious minority, its commitment to particular theological and ethical aspects, its separation from society, and its experience of persecution. As part of my analysis, I trace the early historical development of the group and take inventory of its chief characteristics to observe which of these aspects are selected for portrayal in fictional texts. Within this research framework, my study investigates which social and religious principles drawn from historical accounts and sources influence the minority’s image as an ideal society, on the one hand, and its stigmatization as a heretical and seditious sect, on the other. As a result of this analysis, my study reveals authors’ underlying programmatic aims and ideological convictions cloaked by their literary articulations of conflict-laden encounters between society and the religious minority. -

Mennonitische Geschichtsblätter
Mennonitische Geschichtsblätter 1. bis 73. Jahrgang (1936 – 1940 und 1949 – 2016) Gesamtregister 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage erarbeitet von Helmut Foth Mennonitische Geschichtsblätter herausgegeben vom Mennonitischen Geschichtsverein e.V. Bolanden – Weierhof ISSN 0342-1171 Schriftleitung: Prof. Dr. Hans-Jürgen Goertz, Hamburg Priv.– Doz. Dr. Marion Kobelt – Groch, Timmendorfer Strand Ulrike Arnold, Eschwege Mennonitische Geschichtsblätter 1936 – 2016 Gesamtregister Gesamtregister Mennonitische Geschichtsblätter 1. – 73. Jahrgang (1936 – 1940 und 1949 – 2016) Inhalt: Vorwort zur zweiten Auflage ......................................................... 3 Vorwort ............................................................................................. 3 Praktische Hinweise ......................................................................... 5 Stichwortverzeichnis ....................................................................... 7 Titelseite von Jahrgang 1936 .......................................................... 10 Titelseite von Jahrgang 2016 .......................................................... 11 I. Autorinnen und Autoren .............................................................. 12 II. Sachregister ................................................................................. 47 III. Rezensionen ............................................................................... 195 IV. Festschriften ............................................................................... 225 V. Laudationes -

Healing Memories: Reconciling in Christ Report of the Lutheran-Mennonite International Study Commission the Mennonite World Conference
The Lutheran World FederationThe LutheranWorld The Lutheran World Federation The Mennonite World Conference Healing Reconciling Memories: in Christ Healing Memories: Reconciling in Christ Report of the Lutheran-Mennonite International Study Commission The Mennonite World Conference World Mennonite The The Lutheran World Federation 150, rte de Ferney CH-1211 Geneva 2 Switzerland ISBN 978-2-940459-00-1 OEA-Lutheran-Mennonites-2010-cov1 1 05/07/2010 17:21:53 PM Healing Memories: Reconciling in Christ Report of the Lutheran-Mennonite International Study Commission The Lutheran World Federation The Mennonite World Conference 2010 OEA-Lutheran-Mennonites-2010-EN.1 1 05/07/2010 17:57:29 PM Healing Memories: Reconciling in Christ Report of the Lutheran-Mennonite International Study Commission Published by: The Lutheran World Federation 150, route de Ferney, P.O. Box 2100 CH-1211 Geneva 2, Switzerland and Mennonite World Conference 8, rue du Fossé des Treize F-67000 Strasbourg, France Copyright © 2010 The Lutheran World Federation and The Mennonite World Conference Printed in Germany ISBN 978-2-940459-00-1 Publication of this book was made possible by a special gift from Prof. emeritus Dr Joachim Track, chairman of the Program Committee for Ecumenical Affairs of the Lutheran World Federation Council, 2003-10. OEA-Lutheran-Mennonites-2010-EN.2 2 05/07/2010 17:57:30 PM Contents 5 Preface 11 Part I Introduction 12 Origin and Mandate of the International Study Commission 13 Study Commission Members 13 The Commission and its Themes 19 Part 2 Telling -

Pentecostal Aspects of Early Sixteenth Century Anabaptism
PENTECOSTAL ASPECTS OF EARLY SIXTEENTH CENTURY ANABAPTISM By CHARLES HANNON BYRD II A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Theology and Religion School of Philosophy, Theology and Religion College of Arts and Law University of Birmingham September 2009 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract Early sixteenth century radical Anabaptism emanated in Switzerland during Huldrych Zwingli’s protest against the Roman Catholic Church. Much like Martin Luther, Zwingli founded his reform effort on the Bible being the final arbiter of the faith, sola scriptura, and the sufficiency of the shed blood of Christ plus nothing for eternal salvation, sola fide. Based on these principles both adopted the doctrine of the Priesthood of the Believer which recognized every believer’s Spirit empowered ability to read and interpret the Bible for themselves. These initial theological tenets resulted in the literal reading of the Bible and a very pragmatic Christian praxis including a Pauline pneumatology that recognized the efficacy of the manifestation of the charismata. Radical adherents of Zwingli rejected infant baptism as being totally unbiblical and insisted upon the rebaptism of adults, but only on a personal confession of faith, thus the term Anabaptist. -

An Examination of the Visions of Ursula Jost in the Context of Early Anabaptism and Late Medieval Christianity
An Examination of the Visions of Ursula Jost in the Context of Early Anabaptism and Late Medieval Christianity by Christina Moss A thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in History Waterloo, Ontario, Canada, 2013 © Christina Moss 2013 Author’s Declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of my thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that this thesis may be made electronically available to the public. ii Abstract In early 1530, the lay preacher and recent Anabaptist convert Melchior Hoffman published a series of seventy-seven visions by the Strasbourg butcher’s wife Ursula Jost. In its own day this series of visions, which is the longest extant sixteenth-century document written from the perspective of an Anabaptist woman, attracted the attention of Strasbourg’s authorities and became popular among Dutch Anabaptists who followed Hoffman. In the twentieth century the visions have been studied by Klaus Deppermann and Lois Barrett, who came to widely diverging conclusions on Ursula’s values and her place in the Anabaptist movement. Deppermann saw her as an angry, even bloodthirsty woman whose visions revealed “a murderous hatred of existing society” and inspired violent actions of the part of other Anabaptists, while Barrett argued that Ursula’s visions reflected “the Anabaptist-Mennonite ethic of establishing the reign of God nonviolently.” In light of the radically different conclusions reached by Deppermann and Barrett, this study conducts a fresh re-examination of the visions of Ursula Jost in order to determine what Ursula’s example reveals about sixteenth-century Anabaptism. -

Confessional Migration: Anabaptists – Mennonites, Hutterites, Baptists Etc
Confessional Migration: Anabaptists – Mennonites, Hutterites, Baptists etc. by Geoffrey Dipple Lacking a durable alliance with the state anywhere in Europe, Anabaptists constituted one of the most persecuted and most mobile religious populations of the Reformation and Confessional Ages. A single, clearly defined magisterial office was also absent from the movement, and the Anabaptists' migratory experience encouraged regional variations in the movement that built on its distinct starting points and traditions. At the same time, interactions between different Anabaptist groups undermined those regional differences. The result was the formation of distinct yet inter‐related traditions that survived the Confessional Age: Mennonites, Swiss Brethren, Amish, and Hutterites. TABLE OF CONTENTS 1. Introduction 2. Confessional Migrants 1. The Beginnings in Switzerland and South Germany 2. Moravia: The Promised Land 3. North German and Dutch Anabaptism 3. Migration and the Formation of Anabaptist Traditions 4. Communication Processes 5. Conclusion 6. Appendix 1. Sources 2. Literature 3. Notes Indices Citation Introduction In many ways, Anabaptists were the quintessential confessional migrants of early modern Europe. Driven by a combination of missionary zeal and persecution, they established communities across Europe, ultimately migrating to Russia and the Americas. Perceiving themselves to be the true church in a hostile world, they usually tried to isolate themselves from the surrounding society and culture. Nonetheless, both forced and voluntary migration put Anabaptists into situations in which they had to adapt their teachings and institutions to new conditions. However, determining what developments in Anabaptist history are the result of their migratory existence is complicated by the fact that we are not dealing with a homogeneous, clearly demarcated confessional group. -

"Another Way": the Pneumatology of Deleuzean Minoritarian Communal
University of Denver Digital Commons @ DU Electronic Theses and Dissertations Graduate Studies 1-1-2014 "Another Way": The Pneumatology of Deleuzean Minoritarian Communal Interpretation in Scripture, the 16th Century Radical Reformation, and Alternative 21st Century Anabaptist Community Jeremy Garber University of Denver Follow this and additional works at: https://digitalcommons.du.edu/etd Part of the Continental Philosophy Commons, Mass Communication Commons, and the Practical Theology Commons Recommended Citation Garber, Jeremy, ""Another Way": The Pneumatology of Deleuzean Minoritarian Communal Interpretation in Scripture, the 16th Century Radical Reformation, and Alternative 21st Century Anabaptist Community" (2014). Electronic Theses and Dissertations. 974. https://digitalcommons.du.edu/etd/974 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate Studies at Digital Commons @ DU. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of Digital Commons @ DU. For more information, please contact [email protected],[email protected]. “Another Way”: The Pneumatology of Deleuzean Minoritarian Communal Interpretation in Scripture, the 16th Century Radical Reformation, and Alternative 21st Century Anabaptist Community __________ A Dissertation Presented to the Faculty of the University of Denver and the Iliff School of Theology Joint PhD Program __________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy __________ by Jeremy Garber June 2014 Advisor: Dr. Jeffrey H. Mahan ©Copyright by Jeremy Garber 2014 All Rights Reserved Author: Jeremy Garber Title: “Another Way”: The Pneumatology of Deleuzean Minoritarian Communal Interpretation in Scripture, the 16th Century Radical Reformation, and Alternative 21st century Anabaptist Community Advisor: Dr. Jeffrey H. -

Layers of Meaning: Intertextuality in Early Anabaptist Song
Layers of Meaning: Intertextuality in Early Anabaptist Song A thesis submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF MUSIC in the Composition, Musicology, and Theory Division of the College-Conservatory of Music Music History by Scott R. Troyer B.A., Bluffton University, 2013 Committee Chair: Stephanie P. Schlagel, Ph.D. Abstract Anabaptism is one of the smaller, less well-known movements of the sixteenth-century Reformation. Very little musicological research regarding this separatist group has been done, partly due to their small size, lack of engagement in the contemporary religiopolitical landscape, and the near non-existence of musical notation within the movement’s musical repertoire. The largest extant collection from the first half-century of Anabaptism, Etliche Schöne Christliche Geseng/wie sie in der Gefengkniß zu Passaw im Schloß von den Schweitzer Brüdern durch Gottes gnad geticht und gesungen worden, was published anonymously in 1564 and expanded in 1583 with the additional title of “Ausbund, das ist.” The collection is comprised entirely of contrafacts. Scholars have identified the origins of most of the source tunes that Etliche Geseng references, though they have not frequently considered the relationships that exist between models and contrafacts aside from shared melodies. Expanding on Rebecca Wagner Oettinger’s categories of intertextual relationships as presented in her book Music as Propaganda in the German Reformation, one is able to gain insight into the musical lives and cultural awareness of the Etliche Geseng authors. Patterns identified through the study of intertextual relationships even have the potential to indicate the origins and perhaps even the subject matter of model songs that are no longer extant. -

Reformation Project Handbook Fishbowl Debate
HIST 1130: Europe and the World, 1200–1648 REFORMATION PROJECT HANDBOOK for FISHBOWL DEBATE & SOURCE ANALYSIS Fall 2016 Markman 1 Week 12 (Tues. 11/15 & Thurs. 11/17), we will be hosting a fishbowl debate in class. What is a fishbowl debate? A fishbowl debate is a form of debate or dialogue where a few chairs are arranged in an inner circle and the remaining chairs are arranged in a circle(s) outside the fishbowl. A few participants are selected to fill the fishbowl, while the rest sit on the chairs outside the fishbowl and observe. Participants of the inner circle discuss the topic, and then switch positions. The Scenario The year is 1640 and religious wars have been ravaging Europe for nearly a century. Ten schools of reform have agreed to hold a symposium and discuss their religious and political views to prevent further violence. Three representatives of each school will be in attendance. The symposium will be held on neutral ground in Los Angeles, California on Tuesday, November 15 and Thursday, November 17. The Participants The symposium will be attended by three representatives from each of the following Reformation schools: 1. Martin Luther – Lutheran 2. John Calvin – Calvinist 3. Ignatius of Loyola – Catholic Jesuits 4. Erasmus of Rotterdam – Catholic 5. Huldrych Zwingli – Zurich Protestant 6. Anabaptist 7. Church of England – Anglican 8. Thomas More – Catholic 9. Presbyterian 10. Oliver Cromwell - Puritan Instructions On Tuesday, November 1, you and two partners will be assigned a reformer and/or reformation school. Together, you will research the basic beliefs of that Reformer or Reformation movement. -

A HISTORY of the MÜNSTER ANABAPTISTS Other Work by Friedrich Reck-Malleczewen in English Translation Diary of a Man in Despair
A HISTORY OF THE MÜNSTER ANABAPTISTS Other Work by Friedrich Reck-Malleczewen in English Translation Diary of a Man in Despair Other Books by George B. von der Lippe Max Schmeling: An Autobiography (Edited and translated) The Figure of Martin Luther in Twentieth-Century German Literature: The Metamorphosis of a National Symbol A History of the Münster Anabaptists Inner Emigration and the Third Reich A Critical Edition of Friedrich Reck-Malleczewen’s Bockelson: A Tale of Mass Insanity Translated and Edited by George B. von der Lippe and Viktoria M. Reck-Malleczewen A HISTORY OF THE MÜNSTER ANABAPTISTS Copyright © George B. von der Lippe and Viktoria M. Reck-Malleczewen, 2008. Softcover reprint of the hardcover 1st edition 2008 978-0-230-60547-3 All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. First published in 2008 by PALGRAVE MACMILLAN™ 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010 and Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England RG21 6XS Companies and representatives throughout the world. PALGRAVE MACMILLAN is the global academic imprint of the Palgrave Macmillan division of St. Martin’s Press, LLC and of Palgrave Macmillan Ltd. Macmillan® is a registered trademark in the United States, United Kingdom and other countries. Palgrave is a registered trademark in the European Union and other countries. ISBN 978-1-349-37300-0 ISBN 978-0-230-61256-3 (eBook) DOI 10.1057/9780230612563 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A history of the Münster Anabaptists : inner emigration and the Third Reich / translated and edited by George B. -

The Radical Reformation the Radical Reformation
The Radical Reformation The Radical Reformation CH508 LESSON 21 of 24 Anabaptism and Monasticism Abraham Friesen, PhD Experience: Professor Emeritus of History, University of California, Santa Barbara This is lecture 21. The topic is Anabaptism and monasticism. In this last series of lectures, we shall seek to establish the larger context within which we might better understand the nature of sixteenth-century Anabaptism. Within Anabaptism itself, there are many allusions to what they considered their place within church history. Reformers often referred to them at Donatists or new monks, obviously also make connections to previous movements within the church. In this lecture, we wish to inquire into the relationship between Anabaptism and monasticism, not in terms of the direct influence of former monks on Anabaptist thought, as has sometimes been done, and many early Anabaptist leaders came from the monasteries, but rather we want to look at Anabaptism and monasticism as parallel movements within the larger scope of church history. Let us begin with a statement from Bernhard Rothmann’s Confessions Concerning the Two Sacraments. There he wrote, and I quote, Monasteries and convents grew out of infant baptism. The baptized infants, knowing nothing about Christ, found it easy to depart from him, whereupon He, Christ, left them. Thus the profession and ordinances of Christ were forgotten and so monks and nuns turned to a different set of professions and regulations. Once they set these up, they made it very difficult for others to join them. These people, who deemed themselves holy, that is, monks and nuns, themselves label this entrance into a monastery a second or a rebaptism by which the first is superseded.