2020-Eder.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

German Red Wines – Steve Zins 11/12/2014 Final Rev 5.0 Contents
German Red Wines – Steve Zins 11/12/2014 Final Rev 5.0 Contents • Introduction • German Wine - fun facts • German Geography • Area Classification • Wine Production • Trends • Permitted Reds • Wine Classification • Wine Tasting • References Introduction • Our first visit to Germany was in 2000 to see our daughter who was attending college in Berlin. We rented a car and made a big loop from Frankfurt -Koblenz / Rhine - Black forest / Castles – Munich – Berlin- Frankfurt. • After college she took a job with Honeywell, moved to Germany, got married, and eventually had our first grandchild. • When we visit we always try to visit some new vineyards. • I was surprised how many good red wines were available. So with the help of friends and family we procured and carried this collection over. German Wine - fun facts • 90% of German reds are consumed in Germany. • Very few wine retailers in America have any German red wines. • Most of the largest red producers are still too small to export to USA. • You can pay $$$ for a fine French red or drink German reds for the entire year. • As vineyard owners die they split the vineyards between siblings. Some vineyards get down to 3 rows. Siblings take turns picking the center row year to year. • High quality German Riesling does not come in a blue bottle! German Geography • Germany is 138,000 sq mi or 357,000 sq km • Germany is approximately the size of Montana ( 146,000 sq mi ) • Germany is divided with respect to wine production into the following: • 13 Regions • 39 Districts • 167 Collective vineyard -
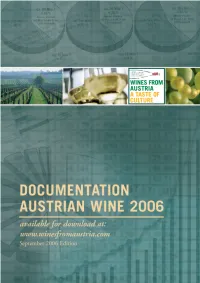
Documentation Austrian Wine 2006
DOCUMENTATION AUSTRIAN W INE 2006 Table of contents 1 Austria œ the wine country 1.1 Austria‘s wine-gr wing regi ns and wine-gr wing areas 1 1.2 Grape varieties in Austria 5 1.2.1 Breakd wn by share of area in percent 5 1.2.2 Grape varieties - Brief descripti n .1 1.2.. Devel pment f the area under cultivati n until 1111 .5 1.. Devel pment of the climate 1161-2002 .6 1.2 W ine-gr wers in Austria - A current overall view .1 1.5 The 2006 harvest 22 1.6 The 2005 vintage 25 1.3 Brief characterisati n of the vintages 2002 back t 1160 23 1.8 Assessment of the 2005-111. vintages 55 2 The Austrian wine industry 2.1 Ec n mic imp rtance of the wine industry in Austria 56 2.2 The harvest 2006 (Status Oct ber 20066 51 2.. 7arvests 1160-2005 61 2.2 8ualit9tswein (8uality wine6 in Austria 2005 65 2.5 Austria‘s wine supply 2005 68 2.6 Devel pment f grape and wine prices 31 2.3 General regulati ns f r wine pr ducti n 32 2.8 EU-Measures f r the Restructuring and C nversi n of Vineyards 32 2.1 The Austrian W ine B ards 80 2.10 The :alue f Origin 8. 2.11 DAC: the l gical key t Austrian wine 82 2.12 8uesti ns and Answers - a Guide 86 3 The Austrian market ..1 C nsumpti n of D mestic Wine and Sparkling W ine 81 ..1.1 C nsumpti n of D mestic Wine 81 ..1.2 D mestic C nsumpti n f Sparkling Wine 1110-2005 10 ..1. -

Tag Der Offenen Winzer-Tür
MÄRZ 2016 * NR. 1 FRÜHLING * JAHRGANG 2 MEIN DORF * DEIN DORF * TATTENDORF TATTENDORF Servus 11 Gepflegt: Helfende Hände beim Trockenrasen 06 Gewerkt: Arbeiten mit Holz für Laien-Tischler 07 Tag der offenen Winzer-Tür Gespielt: Super Stimmung Tattendorfs Winzer laden zum Besuch ein beim Neujahrskonzert AMTLICHE MITTEILUNG * AN EINEN HAUSHALT * BAR FREIGEMACHT * ERSCHEINUNGSORT 2523 TATTENDORF WORT DES BÜRGERMEISTERS MEIN DORF * DEIN DORF * TATTENDORF Liebe Tattendorferinnen und Tattendorfer! Breitbandtechnologie Dorferneuerungsprojekt für Tattendorf vor Abschluss Eine neue, zukunftsweisende Techno- Im Jahr 2012 wurde das derzeit lau- logie hält in unserer Gemeinde Einzug. fende Dorferneuerungsprojekt gestartet. Die Verrohrung für den Breitbandausbau Viele Projekte konnten – federführend Foto: © Christof.G.Pelz / www.GRAFIFANT.at konnte im Zuge einer Bautätigkeit der EVN unter meinem Vorgänger, gf. GR Die- mitverlegt werden. Dadurch kann im Be- ter Reinfrank(SPT) – umgesetzt werden. Gerne werden wir sie über das Ergebnis reich Schulstraße, Feldgasse, Augasse und Nachdem im Juni 2016 die Phase der Um- demnächst informieren. Danzingerstraße sowie Panhanssiedlung setzung endet, wurde der Maßnahmenka- den Anrainern ein Glasfaseranschluss an- talog nun evaluiert. Projekte wie Natur- E-Mobilität geboten werden. denkmal Trockenrasen, die geschichtliche Nachdem ich gemeinsam mit Vize-Bgm. Schon im Rahmen unserer Tätigkeit in Aufarbeitung, die Produktion der Tatten- Franz Knötzl (VP), Umweltgemeinderätin der Kleinregion, deren Hauptaugenmerk dorfer Ortschronik Teil 1 im Rahmen der Monika Dachauer (VP) und Ausschussvor- unter anderem auf den Breitbandausbau 900 Jahrfeier und zwei Ortsbildprojekte sitzender gf GR Martina Lechner (UHL) an gerichtet ist, konnte in vielen Verhand- am Raiffeisenplatz wurden durch die einigen Veranstaltungen im Landhaus St. lungen mit den Vertretern der NÖGIG und Dorferneuerung gefördert. -

Dokumentation Österreich Wein 2013
Dokumentation Österreich Wein 2013 Stand: März 2015 Inhaltsverzeichnis Teil A Aufbau Weinland Österreich 1 Teil B Österreichs Außenhandel 124 Teil C Entwicklung des Internationalen Weinmarktes 154 Dokumentation Österreich Wein 2014 1. Aufbau des Weinlandes Österreich In Österreich gibt es rund 45.700 Hektar ausgepflanzte Rebfläche (nicht unbedingt im Ertrag stehend), die sich zum größten Teil in den östlichen und südöstlichen Landesteilen befinden. Die Verteilung zwischen Weiß- und Rotwein fällt eindeutig zugunsten des Weißweins aus: 66 Prozent sind mit den 24 für Qualitätsweinerzeugung zugelassenen weißen Rebsorten bestockt. Der Rotweinanteil (15 Sorten) ist in den letzten Jahren auf 34 Prozent angewachsen. Die durchschnittliche Erntemenge beträgt 2,4 Millionen Hektoliter, (201 2,4 Millionen hl) der größte Teil davon wird im Inland konsumiert. 76 Prozent des österreichischen Weinkonsums sind heimische Weine, doch der Export stieg in den letzten Jahren stark an (siehe Kapitel 3.1 Weinjahr, Weinernte und Weinbestand 2013). 1.1 Qualitätswein aus Österreich Qualitätswein umfasst in Österreich etwa zwei Drittel der Gesamtproduktion. Er muss eine staatliche Prüfnummer auf dem Etikett, und bei in Österreich abgefüllten Flaschenweinen die rot-weiß-rote Banderole mit der Betriebsnummer als Erkennungszeichen auf der Kapsel (oder seltener als Papierbanderole auf der Flasche) tragen. Die Trauben für österreichischen Qualitätswein müssen aus einem Weinbaugebiet (im Unterschied zu einer Weinbauregion – Weinland, Bergland, Steirerland – bei Landwein) -
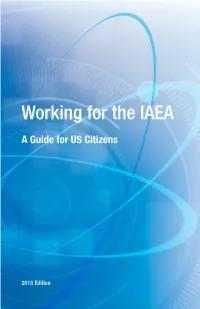
Working for the IAEA
Working for the IAEA A Guide for US Citizens 2018 Edition Working for the IAEA A Guide for US Citizens 2018 Edition From the Editors This Guidebook is intended to provide practical information for United States citizens embarking on or considering an assignment at the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna, Austria. Since its first appearance in 1989, the Guidebook has been revised frequently to reflect changes occurring at the IAEA, within the United States Support Program to IAEA Safeguards (USSP), and in Vienna. The 2018 Edition reflects these changes at the time of publication. Nevertheless, IAEA salaries, allowances, and other benefits change, as do telephone numbers, addresses, and websites. Currency exchange rates, prices, and store hours in Vienna inevitably fluctuate. We regret any inconvenience this may cause our readers. The 2018 Edition of the Guidebook was prepared by the International Safeguards Project Office (ISPO) under the auspices of the USSP and was published by Brookhaven National Laboratory (BNL). Jeanne Anderer, Ben Dabbs Editors November 2018 Working for the IAEA: A Guide for US Citizens 2018 Edition Prepared by the International Safeguards Project Office (ISPO) under the auspices of the United States Support Program to IAEA Safeguards (USSP) International Safeguards Project Office (ISPO) Brookhaven National Laboratory 30 Bell Avenue, Building 490C Upton, New York 11973‑5000, USA Telephone: (631) 344‑5902 Fax: (631) 344‑5266 Web: bnl.gov/ispo facebook.com/ISPObnl youtube.com/IAEAvideo Printed by Brookhaven -

Weinviertel (Unter Besonderer Berücksichtigung Ihrer Landschaftsökologischen Wertigkeit)“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Weinbauregion Westliches Weinviertel (unter besonderer Berücksichtigung ihrer landschaftsökologischen Wertigkeit)“ Verfasser Thomas Nichterl angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaft (Mag. rer. nat.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 453 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geographie Betreuerin / Betreuer: Ao.Univ.-Prof. Dr. Berthold Bauer Vorwort Die vorliegende Diplomarbeit ist unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen entstanden. Umso größer ist daher meine Freude, dass sie letztlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ich möchte daher jenen Personen persönlich danken, die maßgeblich zum Gelingen meines Vorhabens beigetragen haben: Mein besonderer Dank gilt Herrn Univ.-Prof. Dr. Berthold Bauer, der durch seine spontane Bereitschaft zur Übernahme der Betreuung der Diplomarbeit neuen Schwung in meine stagnierenden Recherchen brachte und es mir durch seine sehr konstruktive Einstellung ermöglichte, die Arbeit rasch zu beenden. Ebenso danken möchte ich dem Leiter der Studienprogrammleitung, unserem Herrn Institutsvorstand Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Wohlschlägl. Er hat meine Pläne zum baldigen Studienabschluss in den vergangenen Monaten tatkräftig unterstützt und mir bestmöglich den Weg durch das studienrechtliche Labyrinth gewiesen. Ein großes Dankeschön richte ich auch an Frau Renate Stumptner, die in ihrer Funktion in der Studienprogrammleitung von Anfang an ein offenes Ohr für meine Anliegen hatte und mir dabei stets freundlich mit Rat und Tat zur Seite stand. -

The International Wine Review January 2011
The International Wine Review January 2011 Report # 25: The Wines of Austria Introduction In this Issue Austrian Wine has arrived. Although Austria Introduction .................................................... Cover has been producing wine for centuries, its Acknowledgements ............................................... 2 wines are only now attracting the keen interest Terroir: Geography, Climate, Soils ......................... 3 of wine enthusiasts in international markets. The Regions and Appellations of Austria .................. 4 The reason is that Austrian wine producers are Niederösterreich ......................................... 4 today crafting high quality wines that reflect the Wien ......................................................... 6 unique terroir and indigenous grape varieties of Burgenland ................................................. 7 the country. Grüner Veltliner is the best known and by far the Steiermark .................................................. 7 most popular, but Riesling and other white wines and red wines A Brief History of Wine ......................................... 7 like Blaufränkish and Zweigelt have captured the fancy of wine Austrian Wine Labels ............................................ 8 lovers everywhere. These wines compete with the best in the The Grapes and Wines of Austria ........................... 9 world as international blind tastings in London and Singapore Grüner Veltliner ........................................... 9 have shown for Grüner Veltliner, Riesling, -

ARCHE NOAH Study
ARCHE NOAH’s motivations to conduct this research Even if ARCHE NOAH has been an advocate for agricultural biodiversity from its inception, the association was not specifically founded to protect the variety called “Noah”. ARCHE NOAH has been striving to preserve and develop the diversity of all cultivated plants for 25 years. We are committed to the conservation and sustainable use of biodiversity for present and future generations, in order to ensure more efficient adaptation to local and changing environmental conditions, while preserving traditional knowledge attached to genetic resources, more specifically those linked to agricultural practices. To that end, we believe it is not enough to keep genetic resources in gene banks or scientific institutions, freezing them off for future research. ARCHE NOAH strongly advocates that these resources be cultivated, and made available to and by farmers to safeguard not only the basis of agriculture, but also the richness of flavours that enhance our quality of life. Wine grape biodiversity is thus only a portion of our actions for crop diversity, but it rightly exemplifies unjust and unsound laws adopted against socially rooted and environmentally sound practices. In the case of Austria for instance, a due legalisation of so called “direct producer varieties” would ensure the continued existence of Uhudler . It would recognise and support its economic and cultural contribution to the Burgenland region, while releasing wine growers from uncertainty and illegality. Furthermore, having had direct experience in the consumption of Uhudler for obvious research purposes, we can vouch that neither anger excesses, hysteria, tendencies to hallucinations, nor mental and physical degeneration were observed at the time of writing. -

Friedrich Zweigelt Im Spiegel Zeitgenössischer Quellen1
Friedrich Zweigelt im Spiegel zeitgenössischer Quellen1 Von Dr. Daniel Deckers (Beitrag aus: „Wein in Österreich: Die Geschichte“) Man schrieb das Jahr 1937. Dr. Fritz Zweigelt, der Schriftleiter der Zeitschrift „Das Weinland“, ließ sich aus Anlass seiner 25-jährigen Tätigkeit an der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesversuchsstation für Wein-, Obst- und Gartenbau in Klosterneuburg bei Wien feiern. „Als Lehrer an der Klosterneuburger Schule begeistert er seine Hörer; die Einführung in die Natur gilt ihm mehr als bloße Wissensvermittlung. Daß auch die Musen an seiner Wiege Pate standen, darf nicht unerwähnt bleiben, denn was auf dem Gebiet der Malerei, der Dichtkunst und der Musik bescheidentlich verbirgt, geht beträchtlich über das Dilettantische hinaus“2, schrieb Zweigelts Weggefährte und Freund Albert Stummer. Doch nicht nur das. Unfreiwillig gab er einen Hinweis darauf, warum es kommen konnte, dass der Mann, dem doch „alle Herzen“ zuflögen, im Juli 1945 inhaftiert und wegen Hochverrats, Kriegshetzerei und Denunziation angeklagt wurde. Seine Lobeshymne stellte Stummer unter ein Zitat, das er Johann Wolfgang Goethes „Dichtung und Wahrheit“ abgelauscht hatte: „Ein rühriger Geist faßt überall Fuß.“ Friedrich Zweigelt wurde am 13. Januar 1888 in Hitzendorf, einem Dorf etwa 15 Kilometer von der steirischen Hauptstadt Graz entfernt, geboren.3 Sein Vater, Franz Xaver Zweigelt, stammte aus der in Nordböhmen gelegenen Stadt Schönlinde (Krásná Lipá), seine Mutter Antonia (geborene Kotyza), aus Fürstenfeld in der Oststeiermark.4 Friedrich, gut eineinhalb 1 Aufgefunden wurde während der Recherchen unter anderem die mit dem Jahr 1912 einsetzende Personalakte Friedrich Zweigelts, insoweit sie sich im österreichischen Ministerium für Landwirtschaft in Wien (ÖMinLW), heute Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, erhalten hat (im Folgenden zitiert als Personalakte ÖMinLW). -

ARCHE NOAH Verbotene Früchte 2018
Warum ARCHE NOAH diese Studie erarbeitet hat ARCHE NOAH engagiert sich seit 25 Jahren für den Schutz und die Entwicklung der Vielfalt aller Kulturpflanzen. Wir sind dem Erhalt und der nachhaltigen Nutzung der Vielfalt für gegenwärtige und zukünftige Generationen verpflichtet, um eine bessere Anpassung an sich verändernde lokale Gegebenheiten sicherzustellen und dabei das traditionelle Wissen um die genetischen Ressourcen, speziell in der Landwirtschaft, zu bewahren. Nach unserer Überzeugung genügt es dabei nicht, genetische Ressourcen in Genbanken oder wissenschaftlichen Institutionen zu lagern, wo sie zukünftigen Forschungsarbeiten vorbehalten bleiben. ARCHE NOAH tritt mit Nachdruck dafür ein, diese Ressourcen anzubauen und der Landwirtschaft zugänglich zu machen, nicht nur, um deren Grundlage zu erhalten, sondern auch um eine Geschmacksvielfalt zu bewahren, die unsere Lebensqualität bereichert. Unser Einsatz für die Weintraubenvielfalt ist also nur ein Teil unseres Engagements für die Kulturpflanzenvielfalt, er zeigt jedoch beispielhaft ungerechte und sachlich unhaltbare Gesetze auf, die gegen sozial verwurzelte und ökologisch nachhaltige Praktiken erlassen wurden. In Österreich würde beispielsweise ein längst fälliges Gesetz über so genannte „Direktträgersorten“ das Weiterbestehen des Uhudlers garantieren. Es würde seine wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung für das Burgenland anerkennen und befördern und die Weinbauern und Weinbäuerinnen aus Unsicherheit und Illegalität befreien. 2 EINLEITUNG ..................................................................................................................................... -

Read Ebook {PDF EPUB} Zweigleisig by France Carol COVID-19 Update
Read Ebook {PDF EPUB} Zweigleisig by France Carol COVID-19 Update. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des COVID-19 Virus in Deutschland ist das Restaurant geschlossen. COVID-19 Update. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des COVID-19 Virus in Deutschland ist das Restaurant geschlossen. EAST MEETS WEST. Typisch zweigleisig sind unsere East meets West Fusions-Gerichte, basierend auf europäischer Küche verbunden mit Aromen aus ganz Asien und anderen Teilen der Welt. Unser Küchenteam unter der Leitung von Lukas Jakobi kreiert hochwertige Gerichte, die ihr in relaxter Atmosphäre geniesst. Wir kochen. Ihr sucht aus. Stellt euer eigenes Menü zusammen. Unsere Menüs beginnen bei 3 Gängen. Kombiniert aus unseren Kategorien „Haupt – und Extragleis“, wie es euch gefällt. Einzige Regel für den genussvollen Abend, es dürfen nicht mehr „Extragleis-Gerichte“ als „Hauptgleis-Gerichte“ für ein Menü gewählt werden. Entsprechend unserer Philosophie, des geselligen ‚fine dine‘, servieren wir auch gerne die einzelnen Gänge in die Mitte des Tisches. Entscheidet selbst, ob Ihr das Essen im „Family Style“ teilen wollt oder jeder sein eigenes Gericht genießt. Unser Gesamtkonzept aus Speisen und Getränken, Interieur mit Wohlfühlfaktor und Menschen schafft den Rahmen für einen schönen Abend in lebendiger Atmosphäre. Zweigleisig by France Carol. Angaben nach § 5 TMG. Anschrift und Sitz der Gesellschaft: KLG Network GmbH | Niederkasseler Lohweg 18 | 40547 Düsseldorf | tel: +49 (0)211 – 51427010 | email: [email protected] Vertreten durch die Geschäftsführer: Sven Aschebrock, Dr. Rainer Gith Handelsregister: HRB 78564 Amtsgericht Düsseldorf. Umsatzsteuer ID: DE308961997. Inhaltlich Verantwortlich: Dr. Rainer Gith | KLG Network GmbH | Niederkasseler Lohweg 18 | 40547 Düsseldorf Copyright zweigleisig 2017 | All Rights Reserved | IMPRESSUM | DATENSCHUTZERKLÄRUNG. Carol Zweifel Carol Zweifel. -

Austrian Wine 2007
DOCUMENTATION AUSTRIAN WINE 2007 AUSTRIAN WINE December 2008 Edition available for download at: www.austrianwine.com Table of contents Documentation Austrian W ine 2007 Table of contents 1 Structure of the Austrian wine production 1 1.1 Austria œ The wine country 1 1.2 Grape varieties in Austria 1.2.1 Breakdown by share of area in percent 1.2.2 Grape varieties Brief description 53 1.2.3. Development of the area under cultivation until 1999 57 1.3 Climate change 3 1.4 Vintages 1.5 W ine-growers in Austria A current overall view 70 1. W ine-earnings 75 1.7 ,nventory 2007 77 1.8 Development of grape and wine prices 80 1.9 The Austrian W ine Boards 81 2 Marketing of Austrian W ine 85 2.1 .ualit/tswein of regional origin (DAC1 85 3 The Austrian M arket 88 3.1 Consumption 88 3.2 2arket Segments 91 3.2.1 The home consumption of Austrian wine Gf4 5oushold Panel 92 3.2.2 7ood retail trade 93 4 Austria‘s foreign trade in wine 105 4.1 ,nternational foreign trade in wine 2007 105 4.2 Austrian Imports and E9ports (7inancial :ear1 1989/90 œ 200 /07 107 4.3 ,mports and e9ports 0calendar :ear 2003 œ 20071 108 4.4 ,mports and e9ports 0Jan œ June 20071 110 4.5 Austrian wine e9ports sorted by product groups & major markets 200 2007 111 4. Austrian wine e9ports long term prognosis 11 5 The Austrian W ine aw 117 5.1 The W ine Law of 1999 117 5.2 The 2000 Amendment to the W ine Law 118 5.3 The 2002 Amendment to the W ine Law 119 5.4 W ine Law Amendment 2003 121 5.5 W ine Law Amendment 2004 123 5.