KAS-Auslandsinformationen 1/2001
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Making the Arab World Nasser, Qutb, and the Clash That Shaped the Middle East
© Copyright, Princeton University Press. No part of this book may be distributed, posted, or reproduced in any form by digital or mechanical means without prior written permission of the publisher. Introduction following the large-scale popular uprising that toppled President Hosni Mubarak in February 2011, Egypt witnessed a polar- ization between Islamist and secular nationalist forces. Ultimately, this contentious dynamic culminated in the military toppling of the country’s first democratically elected post-revolution president, Mohamed Morsi of the Islamist movement al-Ikhwan al-Muslimun, better known in English as the Muslim Brotherhood (Ikhwan will be used throughout this book). As soon as it took power, the new military-dominated administration led by Abdel Fattah al-Sisi undertook a campaign of repression, violently breaking up Ikhwan protests, killing a few thousand and arresting tens of thousands more. Remarkably, it did so with considerable support from nation- alist secularists and revolutionaries who had earlier protested in their millions against Morsi’s tenure and who had initially taken to the streets to denounce the tradition of regime-led oppression in their country. Even more striking was the extent to which the new military- dominated order and its supporters instantly sought to ground their legitimacy by invoking a historical precedent with great symbolic weight and situating themselves in relation to the legacy of Gamal 3 For general queries, contact [email protected] Gerges_Making the Arab World.indb 3 22/01/18 11:58 PM © Copyright, Princeton University Press. No part of this book may be distributed, posted, or reproduced in any form by digital or mechanical means without prior written permission of the publisher. -

Electoral Institutions in Non-Democratic Regimes: the Impact of the 1990 Electoral Reform on Patterns of Party Development in Mubarak’S Egypt
Electoral Institutions in Non-Democratic Regimes: The Impact of the 1990 Electoral Reform on Patterns of Party Development in Mubarak’s Egypt Submitted by Hendrik Jan Kratzschmar For the Degree of Doctor of Philosophy London School of Economics and Political Science University of London 2005 UMI Number: U615867 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615867 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 1° 9 5 £ Abstract This PhD researches the development of political parties in Egypt between 1981 and 2000 under the presidency of Husni Mubarak. The starting point of this investigation is the failure of Egypt’s parties to develop into politically-relevant organisations with strong constituency support in society. What we find instead are parties that - since the inception of multipartism in 1977 - remain characterised by their marginal role within the polity and politics of the state, that are little entrenched in society and that expose an underdeveloped and oftentimes fragmented internal structure. What is more, not only have these parties remained persistently weak, but since the early 1990s they experienced a further weakening of their position in the Egyptian polity. -
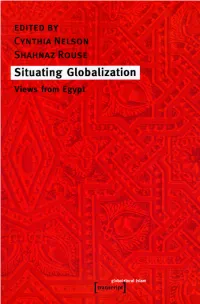
Situating Globalization
Situating Globalization. Views from Egypt 26.09.00 --- Projekt: transcript.nelson / Dokument: FAX ID 00c5267656838312|(S. 1 ) nelson.schmutztitel.p 267656838416 27.09.00 --- Projekt: transcript.nelson / Dokument: FAX ID 01b2267747145512|(S. 2 ) seite 2.p - Seite 2 267747145584 Cynthia Nelson Shahnaz Rouse (eds.) Situating Globalization Views from Egypt 26.09.00 --- Projekt: transcript.nelson / Dokument: FAX ID 00c5267656838312|(S. 3 ) nelson.title.p 267656838484 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Situating Globalization : Views from Egypt / Cynthia Nelson ; Shahnaz Rouse (eds.). – Bielefeld : transcript Verl., 2000 ISBN 3-933127-61-0 © 2000 transcript Verlag, Bielefeld Typeset by: digitron GmbH, Bielefeld Printed by: Digital Print, Witten ISBN 3-933127-61-0 02.01.01 --- Projekt: transcript.nelson / Dokument: FAX ID 01e2276111746544|(S. 4 ) nelson.impressum.p 276111746552 Contents Preface 7 Cynthia Nelson and Shahnaz Rouse Prologue 9 Cynthia Nelson and Shahnaz Rouse Globalization, Islam and the Indigenization of Knowledge 15 Philip Marfleet The Islamization of Knowledge between Particularism and Globalization: Malaysia and Egypt 53 Mona Abaza Gendering Globalization: Alternative Languages of Modernity 97 Cynthia Nelson and Shahnaz Rouse Struggling and Surviving: The Trajectory of Sheikh Moubarak Abdu Fadl. A Historical Figure of the Egyptian Left 159 Didier Monciaud 5 26.09.00 --- Projekt: transcript.nelson / Dokument: FAX ID -

Chapter Eleven the SUPPRESSION of the Muslim Brotherhood Had
Chapter Eleven THE SUPPRESSION of the Muslim Brotherhood had freed Egypt from terrorism, but had not removed the causes of social unrest. Return to normal life brought conditions in which reform might have at least delayed, if not prevented, the fall of the old regime. But this last chance was thrown away. 'The year 1949 was a year of depression and weari- ness, in which the only signs of life were the secret activities. Egypt was at a Low ebb, but destiny was knocking at the door. Farouk was in a difficult situation, for he realized that he could not continue to rule without the support of a popular party. In spite of his strong dislike of Nahas Pasha, and the certainty that an election would mean a crushing majority for the Wafd, Farouk resolved to go to the country. In July, Hussein Sirry succeeded Abdul Hadi, and formed a coalition government with the Wafd, www.anwarsadat.orgto prepare for the general election. The government was unable to reach agreement about the division of the country into electoral districts, and in December Sirry was forced to resign in order to form a neutral cabinet composed of independents. It was a sign of the times that the Wafd election campaign stressed the social question, promising economic reforms, a reduction in the cost of living, a curtailment of state expenditure and waste, and other promises which were never kept. The election took place in January, 1955, and more than two-thirds of the seats went to the Wafd. Nahas Pasha formed a cabinet composed entirely of Wafdists, and the classic duel between the King and the Wafd began again. -

La RDA En Egypte, 1969-1989 : La Construction D’Une Politique Étrangère
UNIVERSITÉ PARIS I PANTHÉON-SORBONNE ECOLE DOCTORALE : ED 113 IRICE (UMR 8138) Doctorat d’histoire et civilisations Discipline : Histoire contemporaine AMÉLIE REGNAULD La RDA en Egypte, 1969-1989 : la construction d’une politique étrangère De la « solidarité anti-impérialiste » aux « avantages réciproques » Thèse dirigée par Robert Frank Date de soutenance : le 10 juin 2015 JURY : M. Tewfik ACLIMANDOS, chargé de cours à l’Université du Caire et à l’Université française du Caire, chercheur associé au Collège de France (rapporteur) M. Robert FRANK, professeur émérite, Université Paris I Panthéon-Sorbonne M. Henry LAURENS, professeur, Collège de France (codirecteur) Mme Chantal METZGER, professeur émérite, Université de Lorraine (Nancy) (rapporteur) M. Pierre VERMEREN, professeur, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 2 Résumé Cette thèse s’inscrit dans le cadre du double renouvellement historiographique des études sur la politique étrangère des démocraties populaires et des recherches transnationales sur le bloc de l’Est. Elle montre comment la RDA construit en Egypte une politique extérieure souveraine, qui passe progressivement d’un impératif dominant, la « solidarité anti-impérialiste », à un autre, l’ « avantage réciproque ». La thèse analyse le processus de déplacement des objectifs politico-idéologiques aux priorités économiques de la RDA, de la mise en place de ses relations diplomatiques avec le Caire, en juillet 1969, aux prémices de sa disparition, en 1989. Après un prologue qui présente les structures et les fondements de l’activité est-allemande en Egypte, la thèse s’organise autour de trois grands axes. Le premier reconstitue le cadre chronologique et politique de la relation bilatérale et met en lumière le passage progressif de l’euphorie révolutionnaire au pragmatisme économique. -

Town Wins Case in Water Protest
The weather Ineide today Clear and cool toni^t; temperatures in the low 30s. Mostly sunny and cool Saturday with highs in the low 40s. A rea....... — 9 Family............. 10 National weather forecast map on Classified . .13-16 MHS World.......6 Page 13 Comics ... ■ ■ ■ Obituaries ........18 , - f lf i ' '' Dear Abby ■17 Sports...........11-12 .............. , ^ Editorial . .... 4 Mlt'OIr W rt^'C E N T S f 'Mr .(] ■ ! Town wins case T- in water protest Judge Paul Falsey has ruled in supply did not meet any given stan Reynolds said today, "My favor of the Town of Manchester in a dard of purity. neighbors and I claim moral victory case where five residents sought "If there were impurities in the by focusing attention on a severe damages from the town because of water, the evidence indicates that problem." problems with their water supply. the most likely source was a broken He asked all citizens to support The residents, who live in the sewer line on private property, and proposed improvements, including southwest section of Manchester, this was not shown to be the fault of short-range water improvements sought damages from the town the defendant (the town)," Falsey that will be recommended to the because of a 12-day period in August wrote in his two-page decision. Board of Directors. when they had to boil their water "Nor was any expert testimony because of a high bacteria count presented as to the effect of He also said that Judge Falsey's found in the town water supply. whatever impurities there might decision does say that there is a The residents testified about health be," he said. -

Introduction 1. RG 469, USOM/Egypt/C Subj Files, 1955–56, Box 6, Brooks Mcclure to W
Notes Introduction 1. RG 469, USOM/Egypt/C Subj Files, 1955–56, Box 6, Brooks McClure to W. H. Weathersby, “Obliteration of Point Four Insignia by Egypt,” 16 April 1956. 2. RG 469, USOM/Egypt/C Subj Files, Box 9, Charles Jackson to Adm. Harold Stevens, “ICA Emblems on GM Locomotives,” 29 August 1956. 3. For example, see Gail E. Meyer, Egypt and the United States: The Formative Years (Cranbury, NJ: Associated University Presses, 1980); William J. Burns, Economic Aid and American Policy Toward Egypt, 1955–1981 (Albany: State University of New York Press, 1985); Peter L. Hahn, The United States, Great Britain and Egypt, 1945–1956: Strategy and Diplomacy in the Early Cold War (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991); Geoffrey Aronson, From Sideshow to Center Stage: U.S. Policy toward Egypt, 1946–56 (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1986); and Muhammad Abd el-Wahab Sayed-Ahmed, Nasser and American Foreign Policy, 1952–56 (London: LAAM, 1989). 4. For example, Ray Takeyh, The Origins of the Eisenhower Doctrine: The US, Britain and Nasser’s Egypt, 1953–1957 (New York: St. Martin’s Press, 2000). 5. Burns’s work explicitly studies how effective American aid was in shaping Egyptian behavior. 6. The obvious exceptions to this are cases in which the U.S. government was seeking to mislead the government of another country. Since the creation of the CIA, however, such actions have generally fallen to that agency and have thus far remained classified. 7. See Abdel Latif al-Baghdadi, Memoirs, pt. 1 (Cairo: al-Maktab al-Misri al- Hadith, 1977, Ar.), Anwar al-Sadat, My Son, This is Your Uncle Gamal: Memoirs of Anwar Sadat (Cairo: Dar al-Hilal, 1958, Ar.); Rashed Barawy, Economic Development in the United Arab Republic (Cairo: Anglo-Egyptian Bookshop, 1970); and Abdul Ra’uf Ahmad Amr, The History of Egyptian- American Relations, 1939–1957 (Cairo: al-Haya al-Misriya al-Ama lil-Kitab, 1991, Ar.). -

The International History of the Yemen Civil War, 1962-1968
The International History of the Yemen Civil War, 1962-1968 The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Orkaby, Asher Aviad. 2014. The International History of the Yemen Civil War, 1962-1968. Doctoral dissertation, Harvard University. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12269828 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The International History of the Yemen Civil War, 1962-1968 A dissertation presented by Asher Aviad Orkaby to The Committee on Middle Eastern Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History and Middle Eastern Studies Harvard University Cambridge, Massachusetts April 2014 © 2014 Asher Aviad Orkaby All rights reserved. III Dissertation Advisor: Roger Owen Author: Asher Aviad Orkaby The International History of the Yemen Civil War, 1962-68 Abstract The deposition of Imam Muhammad al-Badr in September 1962 was the culmination of a Yemeni nationalist movement that began in the 1940s with numerous failed attempts to overthrow the traditional religious legal order. Prior to 1962, both the USSR and Egypt had been cultivating alliances with al-Badr in an effort to secure their strategic interests in South Arabia. In the days following the 1962 coup d'état, Abdullah Sallal and his cohort of Yemeni officers established a republic and concealed the fate of al- Badr who had survived an assault on his Sana’a palace and whose supporters had already begun organizing a tribal coalition against the republic. -

Fo#371/108317
1 2 cms PUBLIC RECORD OFFICE ins Please note that this copy is supplied subject to the Public Record Office's terms and conditions and that your use of it may be subject to copyright restrictions. Further information is given in the enclosed Terms and Conditions of supply of Public Records' leaflet J AFRICAN DEPARTMENT FROM I\JL*> fr&iiJCJirt^ 1 No. Dated V Received in Registry — M **i J /f 3 .• REFERENCES MINUTES (Print) 77-*- (How disposed of) -P>W#Jt.' " y (Action (Index) completed) -7 <\ 39984 1 2 cms PUBLIC RECORD OFFICE ins I 1 i 2 Ref.: /£0 3~7/j ' /0<f3/y 2-OSV 9 Piea;se note that this copy is supplied subject to the Public Record Office's terms and conditions and that your JSe of it may be subject to copyright restrictions. Further information is given in the enclosed Terms and Conditions of supply of Public Records' leaflet SAVING TELEGRAM.. En Glair. By Bag*• PROM CAIRO T_0 H)REIGN OFFICE. Sir Ralph Skrine Stevenson. No.119 Saving. ,-— /o , May if, 1954. _ -•• "" ""--1"™"™ ADDRESSED to Foreign Office tele gram No.119 Saving of May k, 193ETHEPEATED for information Saving to:- B.M.E.O. Fayid No. 193(3) Paris No. 158(3 Washington No.lUO(S UNCLASSIFIED. My telegram No. 116 Savin Trial of Hussain and Mghmoud Abul J'ath. The Revolution Tribunal to-day sentenced Hussain Abul Path to 15 years imprisonment, with suspension of sentence, and Mahmoud Abul Fath (in absentia) to 10 years imprisonment and the confiscation for the benefit of the nation of £E.358,438. -

Revolt in Egypt
hazem kandil Interview REVOLT IN EGYPT a. the movement After a reign of thirty years, Mubarak was overthrown by a popular movement in less than three weeks. How did the uprising originate? ver the last few years, a rebellion had been brewing under the surface. There was a general sense that the status quo could not be sustained. Movies, novels, songs were perme- ated by the theme of revolt: it was everywhere in people’s Oimagination. Two developments were responsible for making ordinary, apolitical Egyptians feel they could no longer carry on with their normal lives. The first was the dissolution of the social contract governing state– society relations since Nasser’s coup in the fifties. The contract involved a tacit exchange: the regime offered free education, employment in an expanding public sector, affordable healthcare, cheap housing and other forms of social protection, in return for obedience. You could have—or at any rate hope for—these benefits, so long as domestic or foreign poli- cies were not questioned and political power was not contested. In other words, people understood that they were trading their political rights for social welfare. From the eighties onwards, this contract was eroded, but it was not until the new millennium that it was fully abrogated. By this time the regime felt that it had eliminated organized resistance so thoroughly that it no longer needed to pay the traditional social bribes to guarantee political acquiescence. Viewing a population that appeared utterly passive, fragmented and demoralized, the regime believed it was time for plunder, on a grand scale. -

European Union Foreign Affairs Journal
European Union Foreign Affairs Journal eQuarterly for European Foreign, Foreign Trade, Development, Security Policy, EU-Third Country Relations and Regional Integration (EUFAJ) N° 01– 2017 ISSN 2190-6122 Contents Editorial ........................................................................................................................................................ 5 EU Good Offices in Revolutionary Egypt (2012-2013) James Moran and Gabriel Munuera Viñals ......................................................................................................... 6 The Muslim Brotherhood in Egypt - Fountain of Islamist Violence Cynthia Farahat .......................................................................................................................................... 16 Private Military and Security Companies: Industry-Led Self-Regulatory Initiatives versus State-Led Containment Strategies Raymond Saner ................................................................................................................................................... 29 European Fund for Sustainable Development (EFSD) Marta Latek ........................................................................................................................................................ 56 Is Europe ready for the Belarus crisis? Arkady Moshes and Ryhor Nizhnikau ................................................................................................................. 66 When Russia considers an Armenian undesirable - Report on a deportation -

Gamal Abdel Nasser's Ephemeral Political Ideology
• • • • • • •• Arraid of Commitment: • Gamal Abdel Nasser's Ephemeral Political Ideology — a New • Definition of Nasserism • • • By Bo Friddell • •• • • • • Submitted to Professors Alex Kitroeff and Lisa Jane Graham • In partial fulfillment of the requirements of •• History 400: Senior Thesis Seminar • 22 April 2012 • • • •• • • •• 1 • • • Abstract • • Gamal Abdel Nasser played an integral role in Middle East politics in the 1950s and • 1960s. He led a military coup against the incumbent King, and then successfully converted his • political capital into a national revolution. The transition of power occurred without major • complications because of the socio-political conditions in Egypt at the time and because of Nasser's particular style of rule. Without a steadying, autocratic leader, Egypt likely would have • fallen under the direction of a foreign power. Nasser used decisive action to stabilize Egypt's O internal politics and prevent foreign agents from agitating Egypt's domestic stability. From this • stability, he projected power at the regional level and remained independent from the major • foreign powers that attempted to control Egypt. Egypt's geopolitical importance guaranteed its • relevance in international politics. Foreign powers competed for the chance to control Egypt — a • nation ideally situated to project power throughout the Middle East and North Africa. However, . each contending superpower grew frustrated with Nasser because his rule relied on personal • judgment, making Egypt's policies unpredictable and inconsistent. Nasser realized the value of his freedom to act and utilized this ability to retain Egyptian sovereignty. Scholars attempted to • define Nasser's political ideology, but his policies were so ephemeral that they needed to create a • new ideology — Nasserism — just to describe the man's political tendencies.