Wilhelm Heckmann
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Oktober Bis Februar 2018/19
Fritz Bauer Institut Geschichte und Wirkung des Holocaust Oktober bis Februar 2018/19 1 Aktuelle Publikationen Jahresbericht 2017 des Fritz Bauer Instituts Forschung · Lehre · Publikationen · Veranstaltungen Frankfurt am Main: Eigenverlag, 2018 180 S., ISSN: 2569-7838 Liebe Freundinnen und Freunde des Fritz Bauer Instituts, im Jahr von Fritz Bauers 50. Todes- tag, den wir am 1. Juli mit einer Ge- Bettina Leder, Christoph Schneider, Katharina Stengel denkveranstaltung Ausgeplündert und verwaltet in der Paulskirche Geschichten vom legalisierten Raub begangen haben, an Juden in Hessen können wir nun auch Berlin: Hentrich & Hentrich, 2018 456 S., 315 Abb., Hardcover, € 29,90 die Kleinen Schrif- EAN: 978-3-95565-261-6 ten Fritz Bauers, in Schriftenreihe des Fritz Bauer Instituts, einer Edition ge- Band 36 sammelt, vorlegen. Wir sind froh, dieses wichtige Projekt, das von der Gerda Henkel Stiftung gefördert wurde, nach mehreren Jahren der Forschung zu Ende geführt zu haben. Am 6. Februar 2019 David Johst (Hrsg.) im Auftrag des Fritz Bauer Instituts wird die Edition der Öffentlichkeit präsentiert. Darüber hinaus Fritz Bauer haben wir ein Symposium im Programm, das wir in Koope- Sein Leben, sein Denken, sein Wirken ration mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Tondokumente mit Originaltönen von Kunst ausrichten. Anlass ist die Aufnahme der Dokumen- Fritz Bauer, kommentiert und eingeleitet von Burghart Klaußner. te und Tonbänder im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess Berlin: Der Audio Verlag, 2017, 4 CDs, in das Weltdokumentenerbe der UNESCO. Im Zentrum des 306 Min., umfangreiches Booklet, € 19,99 Symposiums werden die Zeugen in diesem Prozess stehen. EAN: 978-3-86231-994-7 In einem Workshop nehmen wir die Novemberpogrome, die 2 Sybille Steinbacher, Foto: Helmut Fricke 1 Montag, 8. -
Im Frauenlager Von Auschwitz-Birkenau Stellte Die Lagerleiterin Maria Mandl Im Oktober 1942 Auf Inoffiziellem Wege Ein „Mädch
1 DAS ORCHESTER VON BLOCK 12 EINLEITUNG Im Frauenlager von Auschwitz-Birkenau stellte die Lagerleiterin Maria Mandl im Oktober 1942 auf inoffiziellem Wege ein „Mädchenorchester“ zusammen, das zwischen 1943 und 1944 unter der Leitung der Geigerin Alma Rosé stand. Die Musikerinnen lebten und probten in einer separaten Baracke, dem Block 12 (später im Block 7). Mitglieder der Lagerkapelle von Kaunas (Kauen). Das 1942 gegründete Orchester bestand aus 35 Musikern und fünf Sängern und gab im Ghetto etwa 80 Konzerte. Diese fanden in der dortigen Polizeistation statt. Im selben Gebäude hatte vor der deutschen Besatzung eine Jeschiwa ihren Platz. Die funktionale Rolle der Nazi-Lager beim Völkermord an den Juden, wie auch an den Sinti und Roma, gibt dem Phänomen der Musik an diesen Orten eine besondere Bedeutung. Dadurch, dass sie – teilweise – die organisierte Vernichtung ganzer Völker „untermalte“, kommt ihr in diesem Kontext eine Symbolik zu, die noch bestärkt wird durch die Bedeutung, die die Nazis ihr zu Propagandazwecken im Ghettolager Theresienstadt zumaßen. Die verschiedene Musik, die Alma Rosé (1906-1944): Erfolgreiche Geigerin (1); an der Spitze ihres sowohl in den Vernichtungs- wie auch in den übrigen Orchesters, der „Wiener Walzermädeln“ in den 30er Jahren (2); als Dirigentin des Mädchenorchesters von Auschwitz-Birkenau. Die Kapelle begleitet die Rückkehr Konzentrationslagern erklang, war aber nicht ausschließlich eines Arbeitskommandos. Zeichnung von Mieczyslaw Koscielniak (3). mit dem Genozid an den europäischen Juden verbunden. Diese Ausstellung erklärt, welche Rolle die Musik in den deutschen Dass es in den Nazi-Lagern Musik gegeben hat und diese sogar KZs spielte und in welchen Formen sie auftrat. einen besonderen Stellen-wert hatte, ist heute weitgehend bekannt, wurde jedoch erst in den 1980er-Jahren von Musikalische Aktivitäten gab es im Übrigen nicht nur Expertenseite bestätigt – so schien die Kunst doch völlig in den nationalsozialistischen Lagern, sondern in den unvereinbar mit dem Kontext, in dem sie entstand. -
Puis Plus Tard Dans Le Block 7
1 L’ORCHESTRE DU BLOCK 12 INTRODUCTION C’est dans le Block 12 - puis plus tard dans le Block 7 - du camp des femmes d’Auschwitz-Birkenau que vécut et répéta l’orchestre de femmes constitué de façon non-officielle en octobre 1942 par la chef de camp SS (Lagerführerin) Maria Mandl, et placé entre 1943 et 1944 sous la direction de la violoniste Alma Rosé. Musiciens de l’orchestre du ghetto de Kovno (Kaunas). Créé en 1942 et composé de 35 instrumentistes ainsi que de cinq chanteurs, l’orchestre donna un total de 80 concerts dans le ghetto. Ces derniers avaient lieu dans la station de police au sein du bâtiment qui auparavant hébergeait la yeshiva. La dimension particulière que confère au système concentrationnaire nazi son rôle dans la Shoah, et dans le Porajmos des Roms et des Sintis, ajoute une dimension nouvelle au phénomène. Parce qu’elle accompagne la mort programmée de peuples entiers, la musique prend dans ce contexte une place symbolique que vient renforcer l’accent mis sur son rôle dans le camp-ghetto de Theresienstadt par la propagande nazie. Sa présence dans les camps nazis n’est cependant pas liée uniquement au génocide commis contre les Juifs d’Europe. On la retrouve ainsi dans les camps d’extermination Trois états d’Alma Rosé (1906-1944) : comme violoniste à succès; à la tête de son orchestre , les Wiener Walzermädeln, dans les années trente; dirigeant comme dans les autres camps de concentration. l’orchestre du camp des femmes d’Auschwitz-Birkenau lors du retour d’un La présente exposition y précisera son rôle et les kommando de travail (dessin de Mieczysław Koscielniak). -

Musik Und Mord - Ein Berufsmusiker in Mauthausen“ : Zusammenfassung Vortrag Von Klaus Stanjek / Potsdam
Symposion „KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen im KZ Mauthausen“ Linz / Mai 2007 „Musik und Mord - ein Berufsmusiker in Mauthausen“ : Zusammenfassung Vortrag von Klaus Stanjek / Potsdam Mein Bericht handelt vom Berufsmusiker WILHELM HECKMANN. Mein eigener Onkel. Wir nannten ihn „Willi“. Er starb 1995 in meiner Heimatstadt Wuppertal (BRD). 1.) Das Familiengeheimnis Mein Bericht beginnt an seinem 90. Geburtstag, Juni 1987. Zu diesem Anlass gab es in meinem Elternhaus eine Familienfeier. Beiläufig erwähnte eine von Willis Nichten, „dass Willi wohl ein Überlebenskünstler sei; schließlich hätte er ja auch die Zeit im“ Lager“ überstanden.“ „Welches Lager?“ fragte ich? „Und was und warum“? Obwohl ich mit diesem Mann im gleichen Haus aufgewachsen war, war dieses Thema bis zu meinem 39. Lebensjahr vollständig tabuisiert und ausgeblendet. Seit dieser Zeit habe ich mich (mit Unterbrechungen) damit beschäftigt, Einzelheiten und Zusammenhänge über Willi`s KZ-Zeit zusammenzutragen. Dabei musste ich feststellen, dass auch ich selbst die familiär konditionierte Verdrängung in meiner eigenen Seele überwinden musste und muss. Mein heutiger Bericht ist die erste öffentliche Rekonstruktion der KZ-Gefangenschaft meines Onkels Wilhelm Heckmann. 2.) Sein Bericht und das Wissen unserer Familie Direkte Nachfragen bei meinem Onkel selbst und bei unseren Verwandten führten zu sehr unvollständigen Ergebnissen. Bis 1936 war er als Berufsmusiker in vielen Städten ganz Deutschlands zu Auftritten unterwegs. Im Jahr 1936 wurde er von der Polizei wegen homosexueller Episoden verhaftet und von der Justiz verurteilt, aber auf Grund einer Amnestie aus der Untersuchungshaft wieder freigelassen. Im August 1937 nahm die Gestapo ihn erneut gefangen und überführte in als Schutzhäftling (nach § 175) ins KZ Dachau. Am 27.9.1939 wurde er mit vielen anderen Dachauer Häftlingen ins KZ Mauthausen überführt und arbeitete dort zunächst im Steinbruch des Hauptlagers. -

Washington, Tuesday, January 23, 1951
VOLUME 16 NUMBER 15 Washington, Tuesday, January 23, 1951 TITLE 6— AGRICULTURAL CREDIT as herein set forth. The average value CONTENTS and the investment limit heretofore es Chapter III-—Farmers Home-Adminis tablished for said county, which appear Agriculture Department Pa&e tration, Department of Agriculture in the tabulations of average values and investment limits under § 311.30, Chap See also Commodity Credit Corpo Subchapter B— Farm Ownership Loans ter HI, Title 6 of the Code of Federal ration; Farmers Home Adminis tration; Federal Crop Insur P art 311— B asic R e g u lat io n s Regulations (13 F. R. 9381), are hereby ance Corporation; Forest Serv superseded by the average value and S ubpart B— L o a n L im it a t io n s ice. the investment limit set forth below for AVERAGE VALUES OF FARMS AND INVESTMENT said county. Notices ; LIMITS; PENNSYLVANIA N ew Jersey Disaster areas-having need for agricultural credit, designa For the purposes of title I of the Average Investment tion__________________________- 590 County Bankhead-Jones Farm Tenant Act, as value limit amended, average values of efficient fam Rules and regulations: W ar food orders; agriculture- ily-type farm-management units and Ocean__ _____ . $16,500 $12,000 investment limits for the counties identi import order------------------------ 579 fied below are determined to be as herein Alien Property, Office of set forth. The average values and in (Sec. 41, 60 Stat. 1066; 7 U. S. C., 1015. In terprets or applies secs. 3, 44, 60 Stat. 1074, Notices: vestment limits heretofore established 1069; 7 U. -
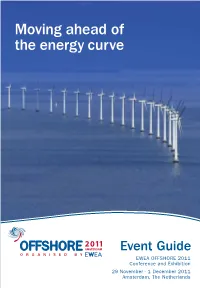
Download the Complete Event Guide
Moving ahead of the energy curve Event Guide EWEA OFFSHORE 2011 Conference and Exhibition 29 November - 1 December 2011 Amsterdam, The Netherlands EWEA Events: The Winning Formula 19 – 21 NOVEMBER Book your stand today for the upcoming EWEA events. Visit EWEA stand: No 9130, Hall 9 EWEA Events: organised for the industry by the industry. The exciting growth of the wind industry has industry’s needs and contribute to its further been accompanied by an increasing number development. of related events. Whenever you consider education, networking or company visibility, be Benefi t from the highest standard confer- sure to make the right choices. ences, international exhibitions and incompa- rable networking opportunities, all under one EWEA has 20 years of experience in organis- roof while supporting the association’s work. ing events that are customised to meet the 180x240-special ex.indd 1 13/10/11 11:48 TABLE OF CONTENTS ■ WELCOME .......................................... 2 – 4 ■ THANK YOU ..................................... 55 – 66 Welcome message ..................................... 2 Supporting organisations .......................... 56 Conference chair foreword ........................... 3 Committees ............................................ 58 Secretariat ............................................. 61 ■ CONFERENCE .................................... 5 – 42 Sponsors ............................................... 63 Conference programme ............................... 6 Partners ............................................... -

The Wny Upstander
THE WNY UPSTANDER The Holocaust Resource Center of Buffalo Spring 2016 Yom HaShoah 2016 Sunday May 1st Temple Beth Zion (805 Delaware Ave.) 1:00 P.M. Survivors Speakers Stephan Lewy (l) and Herman Stone (r) tell their stories to teachers Stereotypes: From Nazi Germany to Your Classroom Over 100 teachers from WNY attended the 2nd Annual Conference for Educators entitled: Stereotypes: from Nazi Germany to Your Classroom held March 7th at Erie 1 BOCES. Dr. Larry Jones, professor of History at Canisius College and Dr. Seven Spencer, professor of Psychology at University of Waterloo, Ontario, Canada addressed the teachers. Dr. Jones spoke about how the Nazi Regime used stereotypes to facilitate the Holocaust and Dr. Spen- ser spoke on how stereotypes can influence others in subtle but impactful ways. A highlight of the day were breakout sessions with seven Holocaust Survivors who shared their personal stories and confirmed the critical importance of what each of the teachers was contributing to society. (L-R) Reed Taylor, Henry Bawnik and Michael Mietlicki Keeping the Dream Alive By Maura Graham, City Honors Student Student Brings Survivor to Class by Reed Taylor, HRCOB founding member We learn and read about the Holocaust in school, but for some individuals it is hard to grasp the magnitude and significance of this time period. It is a totally different and Reversing the usual HRCOB process of sending a profound experience to hear a real Holocaust Survivor speak about their own experi- Speakers’ Bureau survivor to an area school, an ences. It humanizes and connects the Holocaust to people who otherwise would not enterprising student in Heather Wulf’s Honors English 11 class at Kenmore East High School have a personal exposure to the subject. -

Künstlerinnen Und Wissenschafterinnen Als Häftlinge Im KZ-Mauthausen
KünstlerInnen und WissenschafterInnen als Häftlinge im KZ-Mauthausen Artists and Scientists as Inmates at the Mauthausen Concentration Camp Internationales Symposium 4. Mai 2007 Linz Tagungsunterlagen und Beiträge Redaktion: Andreas Baumgartner | Isabella Girstmair Translators: Paul Catty, Petia Petrova, Annabell Marinell, Ulla Ratheiser, Markus Fleckinger und Kitti Szabo www.mkoe.at KünstlerInnen und WissenschafterInnen als Häftlinge im KZ-Mauthausen | Internationales Symposium Linz 4. Mai 2007 Artists and Scientists as Inmates in the Mauthausen Concentration Camp Programm: Ab 8:30h Anmeldung und Einlass 09:00h Michael John Begrüßung | Introduction Programmkomitee | Program Committee Universität Linz 1. Das Spannungsverhältnis von Vorsitz | Chairperson: Wissenschaft und Kunst und dem NS- Michael John Regime The relation between science and the arts and the NS-Regime 09:15 Andreas Baumgartner The freedom of the arts and Programmkomitee | Program Committee sciences vs. the National- Universität Wien Socialist threats Die Freiheit von Kunst und Wissenschaft im Spannungsfeld der nationalsozialistischen Bedrohungspolitik 2. Die Vernichtung von Intelligenz Vorsitz | Chairperson: The extermination of intelligentsia Isabella Girstmair 09:30h Stanislaw Leszczynski Die geplante Vernichtung der Warschau polnischen Intelligenz The planned extermination of the Polish intelligentsia 10:00h Szabolcs Szita Verlust der ungarischen Kultur- Budapest und Wissenschaft während der Festungsarbeiten 1944/45 und der Mauthausener Todesmärsche The loss of Hungarian -

Lüdenscheider Gedenkbuch Für Die Opfer Von Verfolgung Und Krieg Der Nationalsozialisten 1933-1945
Lüdenscheider Gedenkbuch für die Opfer von Verfolgung und Krieg der Nationalsozialisten 1933-1945 Gräberfeld der Kriegsopfer auf dem neuen evangelischen Friedhof 1. Auflage: Lüdenscheid, den 8. Mai 2005 2. überarbeitete und ergänzte Auflage: Lüdenscheid, den 1. Sptember 2007 Herausgeber: Bündnis für Toleranz und Zivilcourage - gegen Gealt und Fremdenfeindlichkeit, Friedensgruppe Lüdenscheid Autoren: Heiner Bruns, Hans-Werner Hoppe, Dieter Saal, Matthias Wagner 2. Auflage zusätzlich: Gerhard Großberndt, Dieter Hohaus Mit freundlicher Unterstützung des Stadtarchivs Lüdenscheids und Heinrich Wilhelm Thoma für Fotoarbeiten Satz / Layout: Janis Benscheidt „Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen.“ (Deuteronomium (5. Mose), 30;19 - Einheitsübersetzung) Reichsjustizminister Dr. Otto Georg Thierack über eine Besprechung mit dem Chef der SS und der Gestapo Heinrich Himmler am 18. September 1942: „…2. Auslieferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug an den Reichsführer SS zur Vernichtung durch Arbeit. Es werden restlos ausgeliefert die Sicherungsverwahrten, Juden, Zigeuner, Russen und Ukrainer, Polen über 3 Jahre Strafe, Tschechen oder Deutsche über 8 Jahre Strafe nach Entscheidung des Reichsjustizministers…” (Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher Bd. XXVI, S. 201 f) Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 1. Opfer der Zwangssterilisation und Euthanasie 1.1 Einleitung 9 1.2 Lebensbild: Fritz Schulte 10 1.3 Die 55 Opfer der Euthanasie aus Lüdenscheid 12 1.4 Lied: Euthanasie 13 2. Jüdische Lüdenscheider 2.1 Einleitung 14 2.2 Familie Koopmann: Vier Schicksale von 114 jüdischen Lüdenscheidern 15 2.3 Walter Süskind 16 2.4 Die jüdischen Opfer aus Lüdenscheid 17 2.5 Lied: Kristallnacht in Lüdenscheid 18 3. -
La Musique Dans Le Systeme Concentrationnaire Nazi
LA MUSIQUE DANS LE SYSTEME CONCENTRATIONNAIRE NAZI Manuel pédagogique pour les enseignants Amaury du Closel 1 2 LA MUSIQUE DANS LE SYSTEME CONCENTRATIONNAIRE NAZI Manuel pédagogique pour les enseignants présenté par Amaury du Closel Préface de Frédéric Siard Documentation : Bastian Geiken Les vues exprimées dans cet ouvrage sont de la responsabilité des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la ligne officielle du Conseil de l’Europe. 3 Le présent manuel pédagogique reprend les panneaux d’une exposition documentaire réalisée par le Forum Voix Etouffées-CEMUT dans le cadre du colloque organisé au Conseil de l’Europe à Strasbourg les 7 et 8 novembre 2013 en partenariat avec le programme Mémoire de l’Holocauste du Conseil de l’Europe. Ce colloque portait sur le thème «Musique et camps de concentration». Ces fiches sont accompagnées d’un CD présentant des œuvres écrites pendant l’Holocauste, notamment dans le ghetto de Theresienstadt. Leurs compositeurs furent pour la plupart assassinés à Auschwitz en octobre 1944. Seul Szymon Laks survécut. Nous remercions les interprètes de ces œuvres et leurs éditeurs de nous avoir autorisés à utiliser leurs enregistrements. Viktor Ullmann : Quatuor à cordes op.48 n°3 (1943) 1. Allegro moderato 2. Presto 3. Largo 4. Allegro vivace e ritmico (Rondo-Finale) Quatuor Manfred : Marie Béreau et Luigi Vecchioni, violons, Vinciane Béranger, alto, Christian Wolff, violoncelle Viktor Ullmann : Lieder 5. Herbst, pour voix et trio à cordes (1943) 6. Lieder der Tröstung, pour voix et quatuor à cordes (1942) Hans Krása : Tri písne pour baryton, clarinette, alto et violoncelle (1943) 7. Quatrain 8. Sensation 9. -

HAUPTPARTNERINNEN Vorhang Auf Für Grosses Kino!
HAUPTPARTNERINNEN Vorhang auf für grosses Kino! Wir sind mit dabei und engagieren uns auch in diesem Jahr als Hauptpartnerin für das Pink Apple Filmfestival in Zürich. Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/pinkapple 18. schwullesbisches PINK Filmfestival Zürich 29. 4. – 7. 5. 15 APPLE Frauenfeld 8. – 10. 5. 15 29. April 2015, 20.15 Uhr ERÖFFNUNG ZÜRICH ARTHOUSE LE PARIS 30. April – 7. Mai 2015 ZÜRICH ARTHOUSE MOVIE KINO STÜSSIHOF SALLE PIGALLE 8. – 10. Mai 2015 FRAUENFELD CINEMA LUNA INHALT GRUSSWORTE 4 EDITORIAL 6 ERÖFFNUNG 8 SPECIALS 11 IM FOKUS 15 DOKUMENTARFILME A — Z 43 SPIELFILME A — Z 63 KURZFILME A — Z 107 ADRESSEN 126 TICKETS 127 IMPRESSUM 128 DANK 129 PROGRAMMÜBERSICHT 132 MIT LEIDENSCHAFT FÜR UNSEREN FILM – MIT LEIDENSCHAFT FÜR UNSERE COMMUNITY Fast seit der Gründung von Pink Apple zählt sich Network zu dessen Part- nern. Mit der besonderen Ausrichtung nicht nur auf Politisches und Wirt- schaftliches, sondern auch auf Kulturelles steht Network als Verein schwu- ler Führungskräfte in Europa einzigartig da. Film erreicht mehr Menschen als andere Arten von Kultur, und gerade Kultur wirkt da, wo Politik und Wirtschaft nicht mehr weiterwissen oder -können. Besonders der schwullesbische Film hat eine wichtige Rolle als Vermittler gespielt, hat unsere Situation bekannt und verständlich gemacht und vielen Luzius Sprüngli Menschen nähergebracht. Dies hat sich ganz besonders in den Anfängen Network von Pink Apple in Frauenfeld gezeigt. Aber gerade auch für uns selbst als Gemeinschaft war die – buchstäbliche – «Projektionsfläche» Film von grosser Bedeutung bei der Bildung von Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. In der 18. Ausgabe macht das Pink-Apple-Team dieses Jahr ein weiteres Mal ein Festival, um das uns viele grössere Metropolen Europas beneiden.