Der Technischen Fachhochschule Berlin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Date: 14 December 2012 Origin: European DPC: 12 / 30257558 DC
Draft for Public Comment Form 36 DPC: 12 / 30257558 DC BSI Group Headquarters Date: 14 December 2012 389 Chiswick High Road London W4 4AL Origin: European Tel: +44 (0)20 8996 9000 Fax: +44 (0)20 8996 7400 www.bsigroup.com Latest date for receipt of comments: 31 March 2013 Project No. 2011/03420 Responsible committee: TDW/4 Technical Product Realization Interested committees: TDW/4/10 Title: Draft BS ISO 10628-1 Diagrams for the chemical and petrochemical industry Part 1: Specification of diagrams Please notify the secretary if you are aware of any keywords that might assist in classifying or identifying the standard or if the content of this standard i) has any issues related to 3rd party IPR, patent or copyright ii) affects other national standard(s) iii) requires additional national guidance or information WARNING: THIS IS A DRAFT AND MUST NOT BE REGARDED OR USED AS A BRITISH STANDARD. THIS DRAFT IS NOT CURRENT BEYOND 31 March 2013 This draft is issued to allow comments from interested parties; all comments will be given consideration prior to publication. No acknowledgement will normally be sent. See overleaf for information on the submission of comments. No copying is allowed, in any form, without prior written permission from BSI except as permitted under the Copyright, Designs and Patent Act 1988 or for circulation within a nominating organization for briefing purposes. Electronic circulation is limited to dissemination by e-mail within such an organization by committee members. Further copies of this draft may be purchased from BSI Shop http://shop.bsigroup.com or from BSI Customer Services, Tel: +44(0) 20 8996 9001 or email [email protected]. -

Design, Development and Introduction of Smart P&I Diagrams for Wärtsilä
Design, Development and Introduction of Smart P&I Diagrams for Wärtsilä 31 Engine Robin Linman Bachelor´s thesis Degree Programme in Mechanical and Production Engineering Vaasa 2019 BACHELOR’S THESIS Author: Robin Linman Degree Programme: Mechanical and Production Engineering, Vaasa Specialization: Mechanical Engineering Supervisor(s): Franco Cavressi (Wärtsilä) and Kenneth Ehrström (Novia) Title: Design, Development and Introduction of Smart P&I-Diagrams for Wärtsilä 31 Engine _________________________________________________________________________ Date April 1, 2019 Number of pages 43 Appendices 7 _________________________________________________________________________ Abstract This thesis has been made for Design team W31 which is a part of Wärtsilä Finland. Design team W31 is primarily working with creating new designs and updating drawings and instructional documents for the Wärtsilä 31 engine. The purpose of this thesis was to create a template in Microsoft Visio that will make it easy for engineers to create Piping and instrumentation diagrams. Microsoft Visio is a drawing program for creating different types of diagrams. A template is a document that works as a foundation for a new drawing and can contain special features and a predefined layout. A Piping and Instrumentation diagram is a detailed flow diagram that describes how piping, equipment and instrumentation are placed and work together in a process. The result of this thesis is a customized template in Microsoft Visio. The template was tested and implemented by drawing -
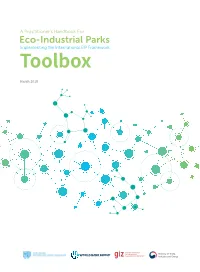
English Version of These Regulations Is Available in the Following Website
ToolboxMarch 2019 A Practitioner's Handbook For Eco-Industrial Parks Implementing the International EIP Framework Toolbox A Practitioner’s Handbook For Eco-Industrial Parks: Toolbox ©2019 The World Bank Group 1818 H Street NW Washington, DC 20433 Telephone: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org All rights reserved. This volume is a product of the staff of the World Bank Group. The World Bank Group refers to the member institutions of the World Bank Group: The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development); International Finance Corporation (IFC – the largest global development institution focused on the private sector in emerging markets); and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), which are separate and distinct legal entities each organized under its respective Articles of Agreement. We encourage use for educational and non-commercial purposes. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of the Directors or Executive Directors of the respective institutions of the World Bank Group or the governments they represent. The World Bank Group does not guarantee the accuracy of the data included in this work. Rights and Permissions The material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law. The World Bank Group encourages dissemination of its work and will normally grant permission to reproduce portions of the work promptly. For permission to photocopy or reprint any part of this work, please send a request with complete information to the Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telephone: 978-750- 8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com. -

International Standard Iso 10628-1:2014(E)
This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-917796 INTERNATIONAL ISO STANDARD 10628-1 First edition 2014-09-15 Diagrams for the chemical and petrochemical industry — Part 1: Specification of diagrams Schémas de procédé pour l’industrie chimique et pétrochimique — Partie 1: Spécification des schémas de procédé Reference number ISO 10628-1:2014(E) © ISO 2014 This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-917796 ISO 10628-1:2014(E) COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT © ISO 2014 All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form orthe by requester. any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of ISOTel. copyright+ 41 22 749 office 01 11 CaseFax + postale 41 22 749 56 •09 CH-1211 47 Geneva 20 Web www.iso.org E-mail [email protected] Published in Switzerland ii © ISO 2014 – All rights reserved This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-917796 ISO 10628-1:2014(E) Contents Page Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................iv 1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................ -

Proses Güvenliği Yönetim Sistemi
Proses Güvenliği Yönetim Sistemi Abdullah Anar Proses Güvenliği Komisyonu KMO Gündem Proses Güvenliği Nedir? PG & İSG Farkı Büyük Proses Kazaları Yasal Altyapı Standartlar Sektör yayınları Elementer Yapı Proses Güvenliği Nedir? Tehlikeli madde ve enerjiyi, tasarım sürecinde belirlenen üretme, iletme ve depolama aracında ve tasarım sürecinde belirlenen koşullarda (basınç, sıcaklık, akış, yoğunluk, akım değeri vb.) tutmaya ve olası sapmaları önlenmeye odaklanan, mühendislik ve yönetim prensiplerinin bileşimi, olarak tanımlanabilir. (PSM Framework Guidance Document SAC Doc 186/14/E, 2014, EIGA) Daha kısa tanım ise; bir kab içine veya iletim hattına alınan veya proses esnasında oluşturulan tehlikeli kimyasalın, iletim ve depolaması tasarım değerlerinden sapmayacak ve istenmeyen noktalardan boşalmayacak. Ya da istenen miktarın üzerinde boşalmayacak ! Bunun sağlanması için yapılan Önleyici (Proaktif) ve Sınırlandırıcı (Reaktif) hazırlık çalışmaları. PG & İSG Farkı İş güvenliği sadece insanın ruhsal ve bedensel hasar alması ile ilgilenir, proses güvenliği prosesin durmasını, büyük ekipman hasarlarını ve ham madde veya mamul madde kaybını da minimize etmeyi hedefler. O nedenle amaç, prosesi oluşturan tüm donanımın sistem bütünlüğünün bozulmasını engellemektir. Felakete yol açabilecek olan proses kazalarını engellemek, aynı zamanda tesise komşu diğer işletmeler ve sivil yerleşim yerlerini de korumak anlamına gelecektir. PG & İSG Farkı İş güvenliğinde kaza olasılığı yüksek ancak beklenen kötü sonuç veya etki düşüktür. Proses güvenliğinde olasılık -

Catálogo De Normas Bolivianas 2011
CATÁLOGO DE NORMAS BOLIVIANAS 2011 0 CATALOGO DE NORMAS BOLIVIANAS 2011 PRESENTACIÓN CATÁLOGO Presentamos el Catálogo Anual de Normas Bolivianas, que recopila la relación de documentos normativos vigentes y cuyo propósito, es el de brindar al usuario un sistema de consulta eficaz y oportuno de todas las normas técnicas bolivianas NB aprobadas. Este documento es considerado como una herramienta de información imprescindible para la localización de las normas NB; posibilitando de esta manera a nuestros usuarios, la disposición de un medio sencillo de acceso al extenso mundo de la normalización. Las normas técnicas bolivianas - NB, son el resultado de un gran esfuerzo de más de 4 000 técnicos, quienes, en representación del gobierno, de los sectores privados de la producción, la distribución y el consumo y del sector científico en sus diferentes ramas, en forma activa y decidida, participan a través de 19 sectores económicos que cubren prácticamente todos los campos de la ciencia y la tecnología de nuestro país, en la elaboración de normas a nivel nacional; todo esto, con el propósito de establecer un orden de una actividad específica para beneficio de los consumidores y productores. Es por todos sabido que disponer de una información actualizada, resulta básico para las empresas, por ello IBNORCA, ha dedicado un especial esfuerzo en este año, para mejorar y adaptar a las nuevas posibilidades tecnológicas, sus productos y servicios de información. Con la convicción de que la satisfacción de nuestros clientes es nuestro primer objetivo, estaremos encantados de atender cualquier sugerencia que nos transmitan los usuarios de nuestros servicios. Dirección Nacional de Normalización DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 1 CATALOGO DE NORMAS BOLIVIANAS 2011 ÍNDICE Pág. -
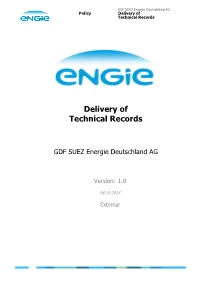
Delivery of Technical Records
GDF SUEZ Energie Deutschland AG Policy Delivery of Technical Records Delivery of Technical Records GDF SUEZ Energie Deutschland AG Version: 1.0 06.10.2014 External GDF SUEZ Energie Deutschland AG Policy Delivery of Technical Record Versions and change history Version Date Author Status & Change V0.0 19.07.2013 Uta Thiel Approve for using MMM V1.0 06.10.2014 Uta Thiel Actualization and adaption point 3.1.4. file format Document release Author Ressort Approved Approved Name Uta Thiel Kathrin Pauls Daniel Mercer Wim Broos Document BIM & Data Asset & Project Position manager Management Management CFPP Ressort Generation Generation Generation Generation Date 06.10.2014 24.11.2014 Signature Version: 1.0 External Page 2 von 22 GDF SUEZ Energie Deutschland AG Policy Delivery of Technical Record Table of contents 0 Introduction ................................................................................................................. 10 Expanded scope! ..................................................................................................................... 10 1 Framework conditions ................................................................................................... 10 1.1 Legal framework ........................................................................................................... 10 2 Technical provisions ...................................................................................................... 10 2.1 Document identifiers .................................................................................................... -

Standardiseringsprosjekter Og Nye Standarder
Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 1302:2002/prA2 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Angivelse av overflatebeskaffenhet for teknisk produktdokumentasjon Vedlegg 2: Angivelse av materielle forholds krav (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation - Amendment 2: Indication of material ratio requirements (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Språk: en Kommentarfrist: 15.12.2010 EN ISO 14660-2:1999/prA1 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Geometriske elementer - Del 2: Ekstrahert median-linje til en sylinder eller konus, ekstrahert medianflate og lokal dimensjon til et ekstrahert element (ISO 14660-2:1999/DAM 1:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part 2: Extracted median line of a cylinder and a cone, extracted median surface, local size of an extracted feature (ISO 14660-2:1999/DAM 1:2010) Språk: en Kommentarfrist: 05.01.2011 prEN 303-5 Central-Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology requirements, testing and marking Språk: en Kommentarfrist: 29.12.2010 prEN 764-2 Trykkpåkjent utstyr - Del 2: Størrelser, symboler og enheter Pressure equipment - Part 2: -

Language-Driven Engineering: from General Purpose to Purpose-Specific Languages
Language-Driven Engineering: From General Purpose to Purpose-Specific Languages Bernhard Steffen1, Frederik Gossen1,2, Stefan Naujokat1, and Tiziana Margaria2 1 Chair for Programming Systems, TU Dortmund University, Germany {steffen|stefan.naujokat}@cs.tu-dortmund.de 2 Lero - The Irish Software Research Centre, University of Limerick, Ireland {frederik.gossen|tiziana.margaria}@lero.ie Abstract. In this paper, we present the paradigm of Language-Driven Engineering (LDE), which is characterized by its unique support for division of labour on the basis of Domain-Specific Languages (DSLs) targeting different stakeholders. LDE allows the involved stakeholders, including the application experts, to participate in the system develop- ment and evolution process using dedicated DSLs, while at the same time establishing new levels of reuse that are enabled by powerful model transformations and code generation. Technically, the interplay between the involved DSLs is realized in a service-oriented fashion. This eases a product line approach and system evolution by allowing to introduce and exchange entire DSLs within corresponding Mindset-Supporting In- tegrated Development Environments (mIDEs). The impact of this ap- proach is illustrated along the development and evolution of a profile- based email distribution system. Here we do not want to emphasize the precise choice of DSLs, but rather the flexible DSL-based modulariza- tion of the development process, which allows one to freely introduce and exchange DSLs as needed to optimally capture the mindsets of the involved stakeholders. Keywords: Service Orientation, Domain-Specific Languages, Mindset, DSLs as a Service, Software Development Environments, Software Evolution, Product Lines, Code Generation, Decision Diagrams 1 Introduction \Programming language research is short of its ultimate goal|provide software developers tools for formulating solutions in the languages of problem domains.": This quote appeared in CACM [31] shortly before our final version deadline. -
ISO Update Supplement to Isofocus
ISO Update Supplement to ISOfocus May 2018 International Standards in process ISO/CD 4652 Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of specific surface area An International Standard is the result of an agreement between by nitrogen adsorption methods — Single- the member bodies of ISO. A first important step towards an Interna- point procedures tional Standard takes the form of a committee draft (CD) - this is cir- TC 59 Buildings and civil engineering works culated for study within an ISO technical committee. When consensus ISO/CD 20887 Design for Disassembly and Adaptability of has been reached within the technical committee, the document is Buildings sent to the Central Secretariat for processing as a draft International Standard (DIS). The DIS requires approval by at least 75 % of the TC 60 Gears member bodies casting a vote. A confirmation vote is subsequently ISO/CD 6336-1 Calculation of load capacity of spur and helical carried out on a final draft International Standard (FDIS), the approval gears — Part 1: Basic principles, introduction criteria remaining the same. and general influence factors ISO/CD 6336-2 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 2: Calculation of surface durabil- ity (pitting) ISO/CD 6336-3 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 3: Calculation of tooth bending strength ISO/CD 6336-6 Calculation of load capacity of spur and heli- CD registered cal gears — Part 6: Calculation of service life under variable load TC 61 Plastics Period from 01 April to 30 April 2018 ISO/CD 22821 Carbon-fibre-reinforced composites — De- These documents are currently under consideration in the technical termination of fibre weight content — By committee. -

International Standard Iso 10628-1:2014(E)
This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-917796 INTERNATIONAL ISO STANDARD 10628-1 First edition 2014-09-15 Diagrams for the chemical and petrochemical industry — Part 1: Specification of diagrams Schémas de procédé pour l’industrie chimique et pétrochimique — Partie 1: Spécification des schémas de procédé Reference number ISO 10628-1:2014(E) © ISO 2014 This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-917796 ISO 10628-1:2014(E) COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT © ISO 2014 All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form orthe by requester. any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of ISOTel. copyright+ 41 22 749 office 01 11 CaseFax + postale 41 22 749 56 •09 CH-1211 47 Geneva 20 Web www.iso.org E-mail [email protected] Published in Switzerland ii © ISO 2014 – All rights reserved This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-917796 ISO 10628-1:2014(E) Contents Page Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................iv 1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................ -

International Standard Iso 10628-1:2014(E)
Copyrighted materiallicensedtoUniversityofTorontobyThomsonScientific,Inc.(www.techstreet.com).Thiscopydownloadedon2015-04-1615:13:29-0500authorizeduserloganahlstrom.Nofurtherreproductionordistributionispermitted. INTERNATIONAL ISO STANDARD 10628-1 First edition 2014-09-15 Diagrams for the chemical and petrochemical industry — Part 1: Specification of diagrams Schémas de procédé pour l’industrie chimique et pétrochimique — Partie 1: Spécification des schémas de procédé Reference number ISO 10628-1:2014(E) © ISO 2014 Copyrighted materiallicensedtoUniversityofTorontobyThomsonScientific,Inc.(www.techstreet.com).Thiscopydownloadedon2015-04-1615:13:29-0500authorizeduserloganahlstrom.Nofurtherreproductionordistributionispermitted. ISO 10628-1:2014(E) COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT © ISO 2014 All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form orthe by requester. any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of ISOTel. copyright+ 41 22 749 office 01 11 CaseFax + postale 41 22 749 56 •09 CH-1211 47 Geneva 20 Web www.iso.org E-mail [email protected] Published in Switzerland ii © ISO 2014 – All rights reserved Copyrighted materiallicensedtoUniversityofTorontobyThomsonScientific,Inc.(www.techstreet.com).Thiscopydownloadedon2015-04-1615:13:29-0500authorizeduserloganahlstrom.Nofurtherreproductionordistributionispermitted.