TYCHE Beiträge Zur Alten Geschichte Papyrologie Und
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Considerations Regarding the Emergence, Evolution and Development of Daco-Roman Law and the Law of the Romanian Countries Until the 19Th Century
Journal of Law and Administrative Sciences No.13/2020 CONSIDERATIONS REGARDING THE EMERGENCE, EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF DACO-ROMAN LAW AND THE LAW OF THE ROMANIAN COUNTRIES UNTIL THE 19TH CENTURY Associate Professor Mihail NIEMESCH, PhD. ”Titu Maiorescu” University, Romania [email protected] Abstract Romanian law is part of the family of Romano-Germanic law, right from the beginning of its appearance, motivated by a first circumstance according to which the Daco-Roman populations, after the conquest of Dacia by the Roman Empire, applied in parallel both the local legal customs and general principles of Roman law. During the Roman conquest, an important dimension of public administration in Dacia, a Roman province, was concerned with the legal norms of Roman and local law. Roman law appears in this province in the form of civil law and gentile law, the law applied in Roman Dacia having a statutory character, in the sense that each category of persons had a well-defined legal status. In the Wallachia, Moldova and Muntenia, a new stage of codification of legal norms appears, the sources of inspiration being especially the French, Italian, Swiss legislations, etc. Keywords: Roman Law, The law of the land, Ordinary law Introduction We can definitely speak of a Romanian law, in the classical sense of the notion, once with the formation of the Romanian Principalities. Equally valid is the fact that until the historical moment of great significance for the Romanian nation, the Union of 1859, there were three "Romanian Countries", mostly populated by Romanians and where Romanian traditions and customary rules influenced the evolution and development of these state formations. -

Histoire Rou:\%Ìains Et De La Romanité Orientale Par N
HISTOIRE ROU:\%ÌAINS ET DE LA ROMANITÉ ORIENTALE PAR N. IORGA PUBLIÉE SOUS LES AUSPICES DE SA MAJESTE LE ROI CHARLES II PAR L'ACADÉMIE ROUMAINE VOL.I,PARTIE II _ LE SCEAU DE ROME BUCAREST x 9 3 7 PARTIE II LE SCEAU DE ROME LIVRE I LES CONQUERANTS CHAPITRE I PREMIER ACTE DE LA ROMANISATION Une nouvelle période dans l'histoire de ce monde, riche en mélanges, qui s'érige peu h peu en grandes synthèses dont se détachera une solide nation millénaire, s'ouvre par l'apparition de ceux qui rendent ainsi la visite, pendant quel- que temps si menafante, de Pyrrhus. La Macédoine n'eftait pas tombée, mais Rome était entrée dans le rae de celle-ci, qui n'était que celui d' Alexandre-le-Grand. Nous avons vu comment la pénétration de Rome dans les Balcans a commencé par les deux guerres d'Illyrie (229-228 et 219 avant J. Chr.), dont nous avons parléplushaut, en rapport avec les races aborigènes dans la Péninsule du Sud-Est Européen. Jusqu'au II-e siècle, Narona, Lissus, Salona, certaines iles avaient, sous le rapport romain, le méme caractère que, plus tard, h l'époque de la domination véni- tienne, ces localités eurent sous le rapport italien 1 Les guerres de Macédoine ont fait connaitre ensuite aux Romains tous les coins des vallées de l'Ouest de la Péninsule Balcanique, pendant la première moitié du II-e siècle. Bientôt, comme autrefois Athénes faisait venir ses servi- teurs de la Thrace 2, comme aujourd'hui les Vénitiens du Frioul ou les Roumains de Bucarest les font venir du pays des Szekler en Transylvanie ou ceux de Jassy de la Bucovine 'Voy. -
![Itor !W..] Oman 1 Lo R](https://docslib.b-cdn.net/cover/6251/itor-w-oman-1-lo-r-2586251.webp)
Itor !W..] Oman 1 Lo R
ITOR !W..]OMAN 1 LO R Impäratul Traian. Bazo-relief de pe Columna lui Traian. ' oo r .. .. 1.i.....6 ' c '''' r , °-.4' ' e, . ; , A 4 ,.,., .., .:o V X, 4t f, ii;Ske o") 'e - ,.,- =Fr o 1 Decebal se sinucide pe mormantul lard sale. Bazo-rellef de pe Columna ILA Traian. TONIA thUIIL'I EuH h A. b. XENOFOL PROFESOR LA UNIVERSITATEA DIN IAI, MEMBRU AOADEMIEI ROMANE. MEMBRU TITULAR AL INSTITUTULUI DIN FRANTIA EDITIA III-a, ingrijità de I. VLADESCU DOCTOR IN LITERE ASISTENT LA UNIVERSiTATEA DIN DUCUREVI IYu surd vremile sub càrma omulul, ci bietul om sub vreml". ti/RON COSTIN. VOLUMUL I DACIA ANTE-ROMANA SI DACIA ROMANA 513 innainte de Hr. 270 durdi Hr. BI TCUREz;l'I EL) [TURA ((CARTEA ROMÄNEA SC Ä» II STOW PIP Lttilb:10e ,_ _ XENOPOL VOL.I PREFATA LA EDITIA III-a Poate pärea indreizneald incercarea de aliza asupra-mi ingrijirea unei noui editii a Istoriei Romdpilor din Dacia Tra- iancl" a lui Xenopol. Este o muncei de ditiva ani, de multä reibdare idein- delungatä familiaritate cu materialul. Ceiteva cuvinte despre aceea ce am socolit cei trebuie fäcut. Autorul 112C6 din 1913 reveizuse toate volumele, in numeir de 14, cari duc povestirea trecutului nostru Oa la 1866, utili- zeind toate scrierile qi documentele publicate dela 1893 incoace"1. Revederea aceasta a tost socotitei ca o initiare fulgerätoare care inspirti respectur (N. Iorga) 2. Prime le 5 volume, peintila 1600, au apärut ubingrijirea sa Mai din 1913-1914 in -editura C. Sfetea". Restul n'a mai putut fi continual, din cauza boalei autorului qi apoi a eveni- mentelor, aduse de marele rtisboiu. -
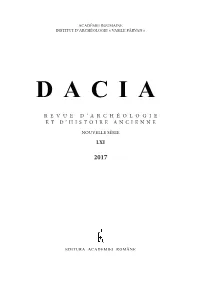
R E V U E D ' a R C H É O L O G I E Et D'histoire Ancienne
ACADÉMIEACADEMIE ROUMAINE INSTITUTINSTITUT D’ARCHÉOLOGIE D’ARCHEOLOG IE« VASILE « V. PARVAN PÂRVAN » » DACIA REVUEREVUE D’ARCHD’ARCHÉOLOGIEE OLOGIE ETET D’HISTOIRED’HISTOIRE ANCIENANCIENNENE NOUVELLENOUVELLE SÉRIE LXILX 20172016 EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE RÉDACTION Rédacteur en chef : EUGEN NICOLAE Rédacteur en chef adjoint : LIANA OŢA Collège de rédaction : MARIA ALEXANDRESCU VIANU (Bucureşti), ALEXANDRU AVRAM (Le Mans), DOUGLASS W. BAILEY (San Francisco), MIHAI BĂRBULESCU (Cluj-Napoca), PIERRE DUPONT (Lyon), SVEND HANSEN (Berlin), ANTHONY HARDING (Exeter), RADU HARHOIU (Bucureşti), ATTILA LÁSZLÓ (Iaşi), SILVIA MARINESCU-BÎLCU (Bucureşti), MONICA MĂRGINEANU-CÂRSTOIU (Bucureşti), VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA (Iaşi), JEAN-PAUL MOREL (Aix-en-Provence), CONSTANTIN C. PETOLESCU (Bucureşti), IOAN PISO (Cluj-Napoca), CLAUDE RAPIN (Paris), WOLFRAM SCHIER (Berlin), VICTOR SPINEI (Iaşi), GOCHA TSETSKHLADZE (Llandrindod Wells) Comité de rédaction : IRINA ACHIM, CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU, IULIAN BÎRZESCU, ADINA BORONEANŢ, DANIELA MARCU-ISTRATE, ANDREI MĂGUREANU, ALEXANDRU NICULESCU, ADRIANA PANAITE, ANCA-DIANA POPESCU, DANIEL SPÂNU, AUREL VÎLCU Secrétaire de rédaction : RALUCA KOGĂLNICEANU Rédaction éditoriale : MONICA STANCIU Informatique éditoriale : OFELIA COŞMAN Toute commande sera adressée à : EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România ; Tél. 4021-318 8146, 4021-318 8106, Fax 4021-318 2444, E-mail : [email protected] ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P. O. Box 77–19, sector 3, Bucureşti, România ; Tél./Fax -

Thracian Sica and Dacian Falx
UNIVERSITATEA BABEŞ – BOLYAI CLUJ-NAPOCA INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIA ARTEI CLUJ-NAPOCA DACIA FELIX. STUDIA MICHAELI BĂRBULESCU OBLATA Editori Sorin Nemeti Florin Fodorean Eduard Nemeth Sorin Cociş Irina Nemeti Mariana Pîslaru © autorii textelor UNIVERSITATEA BABEŞ – BOLYAI CLUJ-NAPOCA INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIA ARTEI CLUJ-NAPOCA DACIA FELIX STUDIA MICHAELI BĂRBULESCU OBLATA CLUJ-NAPOCA 2007 THRACIAN SICA AND DACIAN FALX. THE HISTORY OF A ‘NATIONAL’ WEAPON AUREL RUSTOIU Valerius Maximus, writing about the Asian campaign of P. Licinius Crassus Dives Mucianus against Eumenes III Aristonicos, in the context of the battle of Leucae in 130 BC, mentions the capturing of the Roman consul by the Thracian mercenaries fighting for the Attalid pretender, between Elaea and Myrina. ‘In order to avoid a dishonoured imprisonment, Crassus rushed against his own death and stabbed a Barbarian’s eye with a rod used for horse driving. The enemy, crazed by pain, stabbed the Roman general with his sica and through such revenge, spared him from losing his honour’1. Nearly two centuries later, according to Fronto, the emperor Trajan used for his Parthian campaign ‘experienced soldiers who were not afraid by the enemy’s arrows after facing the horrific wounds made by the curved swords (falces) of the Dacians’2. The cited fragments are underlining two historical reference points for the evolution of a weapon, which will become in the ancient conscience, a symbol of the warlike character of the Thracian populations in northern Balkans and in the end, of the Dacians. The question is whether the mentioned terms are referring to the same weapon, or the ancient authors had known two different weapons coming from this region. -

Integrating Magna Dacia. a N Arrative Reappraisal Of
INTEGRATING MAGNA DACIA. A NARRATIVE REAPPRAISAL OF JORDANES OTÁVIO LUIZ VIEIRA PINTO SUBMITTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY THE UNIVERSITY OF LEEDS SCHOOL OF HISTORY SEPTEMBER 2016 ii iii The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. The right of Otávio Luiz Vieira Pinto to be identified as Author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. © 2016 The University of Leeds and Otávio Luiz Vieira Pinto iv Al contrario, rispondo, chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d'esperienze, d'informazioni, di letture, d'immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Italo Calvino, Lezioni Americane. […] his own proper person was a riddle to unfold; a wondrous work in one volume; but whose mysteries not even himself could read, though his own live heart beat against them; and these mysteries were therefore destined in the end to moulder away with the living parchment whereon they were inscribed, and so be unsolved to the last. Herman Melville, Moby Dick. v ACKNOWLEDGMENTS When I crossed the Atlantic to start my doctoral research, I had no real dimension of how much certain people in my life would be fundamental to the completion of this thesis – and to go through, with head held high, the 4-year long process that it entailed. -

Istoria Ne Spune Că Pe La Mijlocul Mileniului
The Getae - Sons of the Earth Let us try to search the tracks, forgotten by time, of the words Getia and Getae, as others wrote them for the first time more than 5.200 years ago, as here, in the ancestral land, hate and ass kissing serve as all proof or logic of common sense in our history that's been falsified and disparaged by all sorts of deadbeats and traitors of Kin and Country. But, for starters, let us clarify whence stems the word get, with its variants getu, gets, Geta and Getia. There is in Eme.gi known as Sumerian: ge: to tie the hair in a topknot, noble, land, wise, to make justice, faithful + ti: kinship, pride, wife, to endure, to be numerous and for the tu variant: radiance, to lead, to support, to delight, true, to marry, the four cardinal points. And for the word ta: father, person, to shine, character, to advise, integrity. From this sequence of meanings we can detach by ourselves some that will be of great import in our work of rummaging through the memory of time, little as the malicious and falsifiers have left for us, traces and shadows of the fabulous history and mythology of our Carpathian ancestors. In ancient times, this word did not define the national identity of the Carpathian people, it becoming an ethnonym perhaps at the beginning of the 2nd millennium B.C., as the meanings I will ascribe henceforth will show more a defining trait of Folk Descended from Gods, rather than simply the people’s name. -

România Rurală
RomâniaRural Ro Rumarnail a ă NNATIONALAReţeauaTIONAL NaţioR RURALURAnLa D DEVELOPMENTlăEdVeELDOePzvMoltareENT N NETWORK RuETrWa OlăRK NIssueumăr u17l 3 AYneuarl II, SFepbtreumabrryi2e02105 14 Dr. Eng. Viorica Boboc, Senior Adviser for the Ministry of Agriculture and Rural Development, Directorate General for Food Industry: Agricultural education in high-schools and vocational schools must be adapted to the needs of the market Bianca Toma, Romanian Centre for European Policies: The way in which agricultural education can change the Romanian villages Farm education programme at World Vision Romania Save a piece of Romania, save IA, the Romanian Traditional Blouse! RĂDĂCINI DE ŢARĂ EUROPEANĂ Rural Romania – No. 17 REGIONAL OFFICES Supporting Unit of the National Rural Development Network BRĂILA 282, Independenţei Blvd., 1st floor, postal code 810124, [email protected] Tel.: 0339 732 009, Facsimile: 0339 732 016 CRAIOVA 19, Libertăţii St., postal code 200421, Faculty of Agriculture and Horticulture, room L-311, 2 nd floor, [email protected] Tel.: 0251 460 377, Facsimile: 0251 423 651 ZALĂU 49, Kossuth Lajos St., postal code 450010, [email protected] Tel.: 0360 404 056, Facsimile: 0360 404 158 TÂRGU MUREȘ 60, Mihai Eminescu St., postal code 540331, [email protected] Tel.: 0365 430 349, Facsimile: 0365 430 351 IAŞI Ciric Entertainment Area – Ciric Entertainment Complex, postal code 700064, [email protected] Tel.: 0332 881 281, Facsimile: 0332 881 282 TIMIŞOARA 53, Take Ionescu Blvd., 2nd floor, office 26, postal code 300074, [email protected] Tel.: 0356 460 982, Facsimile: 0356 460 983 TÂRGOVIŞTE 7A, Vărzaru Armaşu St., postal code 130169, [email protected] Tel.: 0345 100 605, Facsimile: 0345 100 025 BUCUREŞTI 39-41, Nicolae Filipescu St., 6th floor, 2nd District, postal code 020961, [email protected] Tel.: 0316 900 214, Facsimile: 0316 900 215 The text of this publication is for informative purpose only and does not entail legal responsibility. -

International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXIII No 2 2017 the UNWRITTEN HISTORY in OUR TEXTBOOKS Elen
International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXIII No 2 2017 THE UNWRITTEN HISTORY IN OUR TEXTBOOKS Elena-Tereza DANCIU University of Craiova, Craiova, Romania [email protected] Abstract: In his book “The Dacians”, Hadrian Daicoviciu showed that “only a few pages have been preserved of the great book of this people’s ancient history; dozens of pages, undoubtedly among the most interesting, were lost forever and many, perhaps even more interesting, were never written by ancient authors”. There is a text that keeps coming to my mind very often, especially lately, because I have noticed that there is a tendency to remove or skip several pages of our history. The mission of a historian is to try to find out the historical truth with as many pages as possible. We should not overlook, we should not mitigate anything from our past. The lost or unwritten pages of history hinder this mission, it is true, but what should we do about the pages that were written and, deliberately, are not included in the history books? Keywords: history, ancient, pages, textbooks, historical truth 1. The history of the Geto-Dacians - a Isidore of Seville wrote about Spain “where paradox of the foreign and Romanian the glorious fecundity of the Getic genius medieval historiography flourished”. Alfonso X el Sabio, King of 1.1. Are the Geto-Dacians the ancestors Spain, wrote in his book Cronica General of the Scandinavian peoples? about Dacia or Gothia, about Zamolxis who I will never understand why we “was greatly wise in philosophy”, about intentionally fragment historical truth. -

Geschichte Von Rekasch, Sondern Als Geschichte Des Rekascher Raumes Zu Verstehen
Einleitung Schon lange vor der Gründung des Ortes Rekasch haben nachweislich Menschen in dieser Gegend gelebt. Über Jahrhunderte und Jahrtausende kamen und gingen Kulturen, Völker und Stämme, wurde die Gegend erobert und wieder verloren, war sie wiederholt Teil von größeren oder kleineren Reichen, von Staaten, die aufstiegen und wieder verschwanden, ja, bedingt durch die Grenzlage des Banats war die Dynamik der geschichtlichen Bewegungen hier sogar besonders ausgeprägt. All die Bevölkerungsgruppen, die im unregelmäßigen Rhythmus der ethnischen und politischen Verschiebungen für längere oder kürzere Zeit im Umland von Rekasch heimisch waren, haben hier unter anderem Siedlungen errichtet (und teilweise ihre Spuren hinterlassen) – vom nomadischen Zeltlager über das Gehöft, den Weiler oder das Dorf des Bauern bis hin möglicherweise gar zum Fürstensitz. Diese so verschiedenartigen Siedlungen, die nacheinander an jeweils anderen Standorten gegründet wurden und letztlich wieder aufgegeben werden mussten, bestanden teils nur wenige Jahre oder Jahrzehnte, teils jedoch mehrere Jahrhunderte lang. Mitunter gab es zudem auch Zeiten, in denen die Gegend wohl völlig verlassen und unbesiedelt war. Mit dem heutigen Rekasch allerdings sind diese Siedlungen, deren Namen unbekannt blieben, keineswegs identifizierbar, sie können bestenfalls als dessen Vorgänger gelten. Eine Verbindung zum modernen Rekasch besteht lediglich insofern, als es sich um den gleichen Raum, die gleiche Gegend handelt und in diesem Sinne schließlich ist das Folgende nicht als Geschichte von Rekasch, sondern als Geschichte des rekascher Raumes zu verstehen. Der große rumänische Historiker Nicolae Iorga hat – mit Bezug auf die Geschichte der Völker orthodoxen Glaubens und byzantinischer Kulturprägung in der Zeit nach dem Untergang des byzantinischen Reiches – von „Byzanz nach Byzanz“ gesprochen. -
International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol
International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXIII No 2 2017 THE DACIANS, THE WOLF WARRIORS Mădălina STRECHIE University of Craiova, Craiova, Romania [email protected] Abstract: The Dacians, a very important Indo-European people of the ancient world, were, like all Indo-European peoples, highly trained in the art of war. The legends of the ancient world placed the worship of Ares/Mars, the god of war, in the world of the Thracians, the Dacians being the most important of the Thracians, by the creation of a state and by their remarkable civilization, where war generated rank. The Dacian leaders, military aristocrats, Tarabostes are similar to the Bharathi of the Aryans, therefore the accounts of Herodotus, the father of history, who called the Thracians (including the Dacians, the northern Thracians), “the most important of the Indo-Europeans, after the race of the Indians” (i.e. the Persians and the Aryans, their relatives), also have a military meaning. The totemic symbol of the wolf was much present in Europe, especially with Indo-European peoples, like the Spartans, the aristocrats of war, but mostly with the Romans, the gendarmes of the ancient world. But the Dacians honoured this majestic animal above all, not only as a symbol of the state, but also, apparently, as their eponym. As warriors, the Dacians lay under the sign of the wolf, their battle flag, and acted like real wolves against their enemies, whether they were Celts, during the reign of Burebista, or Romans, during the reign of Decebalus. The Dacians made history in the military art, being perfectly integrated, after the Roman conquest, in the largest and best trained army of the ancient world, the Roman army. -
The Sun Worship with the Romanians
THE SUN WORSHIP WITH THE ROMANIANS DOINA IONESCU, CRISTIANA DUMITRACHE Astronomical Institute of Romanian Academy Str. Cutitul de Argint 5, 40557 Bucharest, Romania Email: [email protected], [email protected] Abstract. We summarize the main aspects of the solar cult with the Romanian people and the populations that lived on their territory. We highlight the origin of the solar cult and its evidence with the ancestors of the Romanians, the Dacians, as well as its manifestations in present popular art and other aspects of Romanians life. Key words: astronomy history, Sun. 1. INTRODUCTION The Sun, our day star, has always impressed people all over the world, who included it in their cultures. The Sun gives warmth, light, life and therefore it is associated with a powerful symbolism in all forms of culture. There are many stud- ies concerning the worshipping of the Sun in different cultures such as the ancient Egyptian, Aztec, Asian, Greek, as well as in the European countries. We note here the book of Bhatnagar and Livingston (2005), that presents a nice review of solar worship all over the world. One can speak about the existence of a solar cult on the territory of Romania beginning with ancient times, more precisely with the Neolithic. This cult was taken over by the Romanians ancestors, called the Getae-Dacians, and it has continued to exist until nowadays. First, let us say a word about the ancient inhabitants of Romania. The hearth of present day Romania was initially inhabited by the Getae, a branch of the Thra- cians, a people of Indo-European origin who were archaeologically attested on the territory between the Balkan Mountains (South), The Forest Mountains (North), the Black Sea shore (East) and beyond the river Siret (West).