Lauffen Am Neckar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Landeszentrale Für Politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6Th Fully Revised Edition, Stuttgart 2008
BADEN-WÜRTTEMBERG A Portrait of the German Southwest 6th fully revised edition 2008 Publishing details Reinhold Weber and Iris Häuser (editors): Baden-Württemberg – A Portrait of the German Southwest, published by the Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6th fully revised edition, Stuttgart 2008. Stafflenbergstraße 38 Co-authors: 70184 Stuttgart Hans-Georg Wehling www.lpb-bw.de Dorothea Urban Please send orders to: Konrad Pflug Fax: +49 (0)711 / 164099-77 Oliver Turecek [email protected] Editorial deadline: 1 July, 2008 Design: Studio für Mediendesign, Rottenburg am Neckar, Many thanks to: www.8421medien.de Printed by: PFITZER Druck und Medien e. K., Renningen, www.pfitzer.de Landesvermessungsamt Title photo: Manfred Grohe, Kirchentellinsfurt Baden-Württemberg Translation: proverb oHG, Stuttgart, www.proverb.de EDITORIAL Baden-Württemberg is an international state – The publication is intended for a broad pub- in many respects: it has mutual political, lic: schoolchildren, trainees and students, em- economic and cultural ties to various regions ployed persons, people involved in society and around the world. Millions of guests visit our politics, visitors and guests to our state – in state every year – schoolchildren, students, short, for anyone interested in Baden-Würt- businessmen, scientists, journalists and numer- temberg looking for concise, reliable informa- ous tourists. A key job of the State Agency for tion on the southwest of Germany. Civic Education (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, LpB) is to inform Our thanks go out to everyone who has made people about the history of as well as the poli- a special contribution to ensuring that this tics and society in Baden-Württemberg. -

Pflegestützpunkte
Pflegestützpunkte Plötzlich kann alles anders sein: Schlaganfall - Unfall - schwere Erkrankung - im Rhein-Neckar-Kreis Fortschreitender Unterstützungsbedarf und Wohnortnahe und vieles mehr können das Leben verändern. neutrale Beratungsstellen Was tun im Pflegefall? Für alle Fragen in diesem Zusammenhang STANDORTE Leistungen der Pflegestützpunkte bieten die Pflegestützpunkte Beratung und VERNETZUNG.. Unterstützung an. Pflegestützpunkte sind Anlaufstellen zu Fragen BERATUNG rund um das Thema Pflege, Alter und Versorgung. Alles rund um Alter und Pflege Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Für eine umfassende Beratung beraten Sie unter Wahrung des Datenschutzes unabhängig, kostenfrei und umfassend. Bei Be- empfehlen wir darf wird die notwendige Hilfe organisiert und eine Terminvereinbarung! umfangreiche Hilfenetzwerke aktiv koordiniert. Viele Fragen entstehen bereits bevor Hilfe be- nötigt wird oder wenn sich Pflegebedürftigkeit Nach Absprache können auch Termine außer- anbahnt, bzw. sich die Pflegesituation verschlim- halb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Weinheim mert: Ilvesheim Bei Bedarf sind auch Hausbesuche möglich. Ladenburg Welche Hilfen gibt es? Wie komme ich an diese Hilfen? Plankstadt Eberbach Was kosten die Angebote? Schwetzingen Wie wird die Pflege finanziert? Träger der Pflegestützpunkte: Neckargemünd Wo beantrage ich welche Leistungen? Wer hilft bei der Antragstellung? Hockenheim Oft genügt eine einfache Auskunft. Manchmal ist Helmstadt- Walldorf Bargen aber eine ausführliche Beratung oder auch die viel- Wiesloch -

Bekanntmachung Des Kreiswahlleiters Für Die Wahlkreise Nr
Amtliche Bekanntmachung des Landkreises Heilbronn Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die Wahlkreise Nr. 19 Eppingen und Nr. 20 Neckarsulm über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg am 14. März 2021 Der Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise Nr. 19 Eppingen und Nr. 20 Neckarsulm hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Januar 2021 folgende Wahlvorschläge für die Landtagswahl am 14. März 2021 zugelassen: Wahlkreis Nr. 19 Eppingen 1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) Bewerber: Köhler, Erwin geboren 1995 in Heilbronn, Kunst- und Kulturmanager, Kiesstraße 39, 74348 Lauffen am Neckar Ersatzbewerberin: Jürgens, Regina geboren 1967 in Kirchhausen, Pfarramtssekretärin, Herewinstraße 41, 74193 Schwaigern 2. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Bewerber: Dr. Preusch, Michael geboren 1975 in Heilbronn, Arzt, Leiergasse 32, 75031 Eppingen Ersatzbewerber: Schiroky, Thomas geboren 1973 in Marbach am Neckar, ltd. Bankangestellter, Im Mühlrain 19, 74360 Ilsfeld 3. Alternative für Deutschland (AfD) Bewerber: Dr. Podeswa, Rainer geboren 1957 in Gelsenkirchen, Landtagsabgeordneter, Physiker, Im Ring 25, 74360 Ilsfeld Ersatzbewerber: Klecker, Dennis geboren 1990 in Heilbronn, Werkfeuerwehrmann, Talstraße 12, 74360 Ilsfeld 4. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Bewerber: Schäfer, Jens geboren 1987 in Sinsheim, Dipl.-Immobiliensachverständiger (DIA), Geisertstraße 6, 75031 Eppingen Ersatzbewerber: Kulka, Jan geboren 2000 in Heilbronn, Student der Rechtswissenschaften, Heuchelbergring 10, 74906 Bad Rappenau 5. Freie Demokratische Partei (FDP) Bewerber: Heitlinger, Georg geboren 1970 in Bruchsal, Landwirt, Im Zitterich 8, 75031 Eppingen Ersatzbewerberin: Pfizenmayer, Franziska geboren 1994 in Bad Friedrichshall, Bankkauffrau, Hölderlinstraße 5, 71717 Beilstein 2 6. DIE LINKE (DIE LINKE) Bewerberin: Weber, Emma geboren 1993 in Heilbronn, Studentin, Bachstraße 8, 74226 Nordheim Ersatzbewerber: Bluhm, Heiko geboren 1969 in Karlsruhe, Lehrer, Gradmannstraße 42, 74348 Lauffen am Neckar 7. -
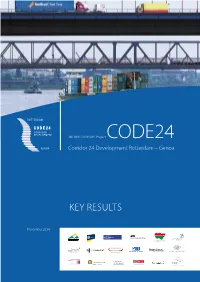
CODE24 Key Results
INTERREG IVB NWE Project CODE24 Corridor 24 Development Rotterdam – Genoa KEY RESULTS November 2014 Regionalverband Ruhr 2 CODE24 KE Y RE SULTS 3 CODE24 KE Y RE SULTS Introduction Corridor Info System CIS CODE24 is a bottom-up strategic initiative in the Planning has to be carried out collaboratively by all sta- The central purpose of the CIS tool is to give the partners of Interreg project CODE24 framework of the INTERREG IVB NWE program of the keholders involved: responsible authorities (national/ strategic information about the Corridor‘s development. CIS was constructed as an in- EU. The interconnection of economic development, regional/local), transport sector and the users. For the teractive Web GIS-based instrument for information exchange. The information about spatial, transport and ecological planning along the international processing of activities in these spaces, the Corridor is, as in most complex planning processes, affected by incompleteness TEN-T core network corridor Rhine-Alpine contributes as well as the implementation of the corresponding and uncertainty. The many endogenous and exogenous variables and dynamics that to address urgent conflicts of capacity and quality of tasks, the relevant platforms for cooperation need to influence the planning and the results processed by the CODE24 partnership can be life along the corridor. After 5 years of intensive work, be created. easily prepared and presented by CIS. Overviews of many planning-relevant themes the CODE24 project partners present a common strat- are easily and quickly available for the interested parties. Information can be entered egy for the development of the Rhine-Alpine Corridor. The CODE24 project was divided in four thematic work into the system, improved and corrected by the participants. -

AVR Kommunal Bereitet Normal- Betrieb in Der Corona-Krise Vor
der Gemeinde Schönbrunn mit ihren Ortsteilen Allemühl Schönbrunn Schwanheim Haag Moosbrunn Herausgeber: Bürgermeisteramt, Herdestraße 2, 69436 Schönbrunn, www.gemeinde-schoenbrunn.de Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Frey, Schönbrunn, Tel. (0 62 72) 93 0030, Fax (0 62 72) 93 0070 Verlag: WerbeDruck Schneider, Industriestr. 20, 74909 Meckesheim, Tel. (0 62 26) 99 39-0, Fax 99 39-19, [email protected] 42. Jahrgang 30. April 2020 Nummer 18 AVR Kommunal bereitet Normal- betrieb in der Corona-Krise vor Ab Montag, den 04.05.2020, haben die AVR Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg sowie die Deponie Wiesloch für alle Einwohnerinnen und Einwoh- ner sowie gewerbliche Anlieferer des Rhein-Neckar-Kreises wieder geöffnet. Das Bild zeigt die Anlage in Sinsheim. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten usw. können Sie im Innenteil nachlesen. Seite 2 Amtsblatt Schönbrunn Nummer 18 • 30. April 2020 Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Schönbrunn Sprechzeiten Rathaus Schönbrunn Wassermeister D 2: 01 73/3 28 35 37 Netze BW, Störungs- 0800/3629-477 Montag–Freitag 8.00–12.00 Uhr oder Wassermeister Stv. meldestelle Strom (kostenfrei) Mittwochnachmittag 13.30–17.30 Uhr nach Dienstschluss: AVR Abfalltelefon 0 72 61/9 310 Bürgermeister Frey 0 62 71/9 47 63 90 Fernsprechnummern der GiftInformation Gemeinde Schönbrunn Forstrevierleiter Berberich Ludwigshafen 06 21/50 34 31 Zentrale 0 62 72/93 000 (Gemeinde und Privatwald) 0 62 72/22 89 EMail: [email protected] Feuerwehrhaus Defibrillatoren-Standorte Telefax 93 0070 Schönbrunn 0 62 72/9 49 90 01 Ortsteil Allemühl Bürgermeister Frey 93 0030 Anmeldung für 0 62 72/93 00 11 Feuerwehrhaus Schönbrunner Str. -

Begründung 2. Offenlage JAN2018
Allgemeinen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg (11. Änderung) Begründung Aufgestellt : Sinsheim, Januar/November 2008 ergänzt : 30.11.2015 / 19.07.2016 / 09.09.2016 / 06.11.2017 – Gl/Ru Allgemeine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg (11. Änderung) - Begründung Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg Allgemeine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (11. Änderung) Begründung Fassung für die erneute Anhörung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB Bearbeiter: Dietmar Glup Sonja Rustemeier-Allespach Tanja Schievenhövel Martin Fundus Sternemann und Glup ▪ Freie Architekten und Stadtplaner ▪ Zwingergasse 10 ▪ 74889 Sinsheim 2 Allgemeine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg (11. Änderung) - Begründung Inhaltsverzeichnis Seite Verfahrensvermerke 6-7 A Einführung A1. Anlass und Umfang der Allgemeinen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 8-9 A2. Rechtsgrundlagen 9 A3. Entwicklung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg und redaktionelle Anmerkungen 10-11 A4. Allgemeine Angaben zum Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg 12 A4.1 Allgemeine Daten 13-14 A4.2 Verkehrsinfrastruktur 14 B Planungsvorgaben B1. Einstufung des Verbandsgebietes nach den Zielen des Landesentwicklungsplanes Baden-Württemberg 15 B2. Vorgabe des „Einheitlicher Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar“ 15-17 C Bedarf an Bauflächen C1. Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfes -

Improved Method for Mobile Characterisation of Δ13ch4 Source
13 Improved method for mobile characterisation of δ CH4 source signatures and its application in Germany Antje Hoheisel1, Christiane Yeman1,2, Florian Dinger1,3, Henrik Eckhardt1, and Martina Schmidt1 1Institute of Environmental Physics, Heidelberg University, Heidelberg, Germany 2Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Zurich, Zurich, Switzerland (now) 3Max-Planck Institute for Chemistry, Mainz, Germany Correspondence: Antje Hoheisel ([email protected]) 13 Abstract. The carbon isotopic signature (δ CH4) of several methane sources in Germany (around Heidelberg and in North Rhine-Westphalia) were characterised. Mobile measurements of the plume of CH4 sources are carried out using a cavity ring- down spectrometer (CRDS). To achieve precise results a CRDS analyser, which measures methane (CH4), carbon dioxide 13 12 (CO2) and their C to C ratios, was characterised especially with regard to cross sensitivities of composition differences of 13 5 the gas matrix in air samples or calibration tanks. The two most important gases which affect δ CH4 are water vapour (H2O) and ethane (C2H6). To avoid the cross sensitivity with H2O, the air is dried with a nafion dryer during mobile measurements. C2H6 is typically abundant in natural gases and thus in methane plumes or samples originating from natural gas. A C2H6 13 correction and calibration are essential to obtain accurate δ CH4 results, which can deviate up to 3‰ depending on whether a C2H6 correction is applied. 10 The isotopic signature is determined with the Miller-Tans approach and the York fitting method. During 21 field campaigns 13 the mean δ CH4 signatures of three dairy farms (−63.9±0.9‰), a biogas plant (−62.4±1.2‰), a landfill (−58.7±3.3‰), a wastewater treatment plant (−52.5±1.4‰), an active deep coal mine (−56:0 ± 2:3‰) and two natural gas storage and gas compressor stations (−46.1±0.8‰) were recorded. -

2019 Abfallkompass.Pdf
Wir für Sie. r e i p a p t l A % 0 0 1 s u a r e i p a p g n i l c y c e R f u a t k c u r d e G | 0 2 AVR Kommunal AöR 0 2 r a Dietmar-Hopp-Str. 8 u n a J 74889 Sinsheim : d n a t Das Abfall-ABC www.avr-kommunal.de S 2 3 Tipps zur Abfallvermeidung Was? Wohin damit? A A Einkaufskorb oder Leinentasche ersetzen die Plastiktüte. Abbeizmittel Schadstoffsammlung Mehrweg statt Einweg! Abflussreiniger Schadstoffsammlung Äste (bis 20 cm Durchmesser, Grünschnittsammlung, Anlieferung bei den AVR Anlagen Viel drum, wenig drin! Miniportionsverpackungen vermeiden. bis 1,5 m Länge) Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg Keine Wegwerfartikel kaufen! Äste (> 20 cm Durchmesser, zerkleinern, danach Grünschnittsammlung, Anlieferung > 1,5 m Länge) den AVR Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirsch- berg Bevorzugen Sie z. B: Geräte und Möbel mit langer Lebensdauer und Reparatur- Akkus Rücknahme durch den Handel freundlichkeit. Akku-Ladegerät Elektrogerätesammlung, Anlieferung bei den AVR Anlagen „Geht’s auch lose?“ Nicht nur Wochenmärkte bieten frische, unverpackte Ware an. Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg Aktenordner Restmüll Benutzen Sie bei technischen Geräten möglichst Netzteile und aufladbare Altkleider Alttextiliensammlung der AVR, Anlieferung bei den AVR Batterien. Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg sowie AVR-/DRK-Container in den Städten und Gemeinden des Große Feste – kleine Reste! Abfälle vermeiden mit Mehrweggeschirr. Rhein-Neckar-Kreises Altöl ( Motoren- und Getriebeöl) Verkaufsstellen, AVR Anlage Wiesloch Achten Sie beim Einkauf auf Recyclingprodukte. Altöldosen leer Schadstoffsammlung Altpapier Grüne Tonne plus, Anlieferung bei den AVR Anlagen Sins- Nutzen Sie den Tausch- und Verschenkmarkt der AVR. -

Normalbetrieb in Sicht Pressemitteilung
P ressemitteilung …………………………………………………………………………………………………………..... 24.04.2020 Normalbetrieb in Sicht AVR Kommunal bereitet Normalbetrieb in der Corona-Krise vor Ab Montag, den 04.05.2020, haben die AVR Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg sowie die Deponie Wiesloch für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie gewerbliche Anlieferer des Rhein-Neckar-Kreises wieder geöffnet. Bis auf weiteres gel- ten dabei folgende Öffnungszeiten: AVR Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch, Hirschberg: Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr AVR Anlagen Sinsheim und Wiesloch: Samstag von 15 bis 19 Uhr AVR Anlage Hirschberg: Samstag 09. Mai., 16. Mai und 06. Juni von 8 bis 12 Uhr Samstag 23. Mai, 30. Mai und 13. Juni von 15 bis 19 Uhr AVR Anlage Ketsch: Samstag 23. Mai, 30. Mai und 13. Juni von 15 bis 19 Uhr Deponie Wiesloch: Mittwoch von 08:00 bis 12:00 / 12:30 bis 16:00 Uhr Donnerstag von 08:00 bis 12:00 / 12:30 bis 16:00 Uhr „Wir haben in den vergangenen Tagen verschiedene Szenarien für eine Wiedereröffnung der AVR Anlagen besprochen. Wir sind froh, dass wir ab dem 04. Mai die Anlagen unter be- stimmten Vorgaben wieder öffnen können“, freut sich Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal AöR. „Dabei steht nach wie vor die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitar- beiter sowie der Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle.“ …………………………………………………………………………………………………………..... Hintergrund der neuen Öffnungszeiten ist die Einhaltung der gebotenen Abstandsregelungen auf den Anlagen wie auch die Sicherstellung der Müllabfuhr: Mit den erweiterten Öffnungszeiten werden sich die AVR Sammelfahrzeuge beim Entladen nicht mit dem Kundenverkehr überschneiden. Die AVR Kommunal AöR empfiehlt ihren Kundinnen und Kunden, die Abfallanlagen nicht gleich in den ersten Tagen der Wiedereröffnung aufzusuchen, da mit erhöhtem Andrang zu rechnen ist, und weist gleichzeitig darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, da nur eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen eingelassen wird. -

Wandern · Radfahren Wasserspaß · Ausflugsziele
Radfahren Neckargemünd Neckarsteinach Frankfurt a.M. Die Romantischen Vier bieten vieles, was Hirschhorn das Radlerherz begehrt. Sanfte Fotos: Bernolph von Gemmingen Mannheim Eberbach Tipp Wege entlang des Neckars auf ei- Heidelberg Die Romantischen Vier Eine Kombination aus Wandern auf Sinsheim Heilbronn dem Neckarsteig und Radfahren auf nem der schönsten Radwanderwege dem Neckartalradweg. Mit der S-Bahn Deutschlands, dem 4 Sterne klassifi- Umgebung Stuttgart fahren Sie in jede Richtung wieder zu rück zum Ausgangspunkt oder weiter- zierten Neckartalradweg – ideal für Wandern zu Ihrem nächsten Ziel. Familien und nahezu ohne Steigungen. Neckar Die Romantischen Vier Anspruchsvolle bis sportlich ambitionierte Mög- liegen mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar, dem Zahlreiche Wanderwege laden den Naturfreund ein: Wasserspaß lichkeiten in der wunderschönen und abwechs- Naturpark Neckartal-Odenwald und dem Geo-Naturpark • auf Fernwanderwege wie den Neckarsteig, einen an- lungsreichen Mittelgebirgslandschaft des Odenwaldes. Bergstraße-Odenwald. Zahlreiche attraktive Ausflugsziele spruchsvollen zertifizierten Qualitätswanderweg, der auf Herrliche Rast- und Aussichtspunkte und die Möglichkeit Ob Sie gemächlich auf den Fahr- sind in weniger als einer Stunde Fahrt zu erreichen: 126 km Heidelberg mit Bad Wimpfen verbindet und durch gastschiffen die beeindruckende – nach getaner sportlicher Aktivität – zwischen allen Amorbach: Fürstlich-Leiningensches Palais Amorbach, die Romantischen Vier verläuft Landschaft und die das Neckartal Städten der Romantischen Vier mit Pfarrkirche St. Gangolf Eberbach • zu gemütlichen Tagestouren entlang des der S-Bahn zum Ausgangspunkt säumenden Burgen bewundern Kultur-Tourismus-Stadtinformation Buchen-Eberstadt: Tropfsteinhöhle Neckars auf gut ausgebauten Wegen mit zurückzukehren. oder ob Sie sportliche Kanutouren Leopoldsplatz 1 (Im Rathaus) · 69412 Eberbach herrlichen Aussichten auf dem Wasser unternehmen – hier Burg Guttenberg (April bis Oktober): Burgmuseum und © Stadt Eberbach/Andreas Held Tel. -

S 5/51 S 51 Heidelberg - Meckesheim - Aglasterhausen
S 5 Heidelberg - Meckesheim - Sinsheim - Eppingen S 5/51 S 51 Heidelberg - Meckesheim - Aglasterhausen Linie unterliegt nicht vollständig dem VRN-Tarif. Bitte beachten Sie den Wabenplan. Montag - Freitag Zuggattung RB RE RE RB RE Zugnummer 18401 18403 18309 18405 18407 18377 18409 18313 18413 4831 18317 18381 18415 18417 19321 18323 4833 19421 18327 19425 G 1 Mannheim, Hauptbahnhof ab 4.57 5.44 6.30 7.01 7.07 7.36 8.07 8.36 8.39 9.07 9.39 G 1 Heidelberg, Hbf an 5.14 6.01 6.42 7.12 7.23 7.48 8.23 8.48 8.53 9.23 9.53 Hinweise S51 S51 S5 S51 S51 HN S51 S5 S5 S51 S51 S5 S5 S51 S5 S51 Heidelberg, Hauptbahnhof ab 5.38 6.12 6.43 6.43 7.14 7.32 8.04 8.04 8.34 8.49 9.04 9.34 10.04 - West/Südstadt 5.40 6.14 7.16 7.34 8.06 8.06 8.36 9.06 9.36 10.06 - Altstadt 5.44 6.17 6.48 6.48 7.19 7.38 8.09 8.09 8.39 9.09 9.39 10.09 Schlierbach-Ziegelhausen 5.47 6.21 7.41 - Orthopädische Klinik 5.49 6.23 Neckargemünd an 5.52 6.26 7.25 7.45 8.45 9.15 9.45 10.15 Neckargemünd ab 5.53 6.26 7.26 7.46 8.46 9.16 9.46 10.16 Bammental 5.57 6.30 7.30 7.50 8.19 8.19 8.50 9.20 9.50 10.20 Reilsheim 5.58 6.32 7.31 7.51 8.21 8.21 8.51 9.21 9.51 10.21 Mauer 6.01 6.35 7.34 7.54 8.23 8.23 8.54 9.24 9.54 10.24 Meckesheim an 6.04 6.39 7.00 7.00 7.37 7.57 8.26 8.26 8.57 9.05 9.27 9.57 10.27 Meckesheim ab 4.57 5.32 6.05 6.14 6.32 6.42 7.02 7.05 7.38 7.59 8.02 8.27 8.29 8.59 9.06 9.30 9.59 10.30 Eschelbronn 5.01 5.36 6.09 6.36 7.06 8.06 8.31 9.34 10.34 Neidenstein 5.03 5.38 6.12 6.38 7.08 8.08 8.33 9.36 10.36 Waibstadt 4.42 5.08 5.43 6.16 6.46 7.13 8.13 8.39 9.41 10.41 Neckarbischofsheim, -

INVESTMENT GUIDE Baden-Württemberg INVESTMENT GUIDE INVESTMENT Baden-Württemberg N
INVESTMENT GUIDE Baden-Württemberg INVESTMENT GUIDE Baden-Württemberg N W 48° 32‘ 15.9“ N 09° 02‘ 28.21“ E E S FACTS AND FIGURES 35.674 km2 land area 10% of Germany 11 million inhabitants 13% of the population of Germany Largest cities: Stuttgart / Karlsruhe Mannheim Freiburg / Heidelberg Ulm / Heilbronn Pforzheim / Reutlingen EUR 511 billion Gross Domestic Product 15% of Germany’s GDP EUR 46,279 per inhabitant EUR 203 billion export volume EUR 28 billion for research and development within Baden-Württemberg Figures valid for: 2017 / 2018 Source: State office of statistics Baden-Württemberg 04 Investment guide Baden-Württemberg Selected global players from Baden-Württemberg Sector: Mechanical engineering Company headquarters: Heidelberg Sector: Sale of assembly and fastening materials Sector: Software Company headquarters: Künzelsau Company headquarters: Walldorf Mannheim Heidelberg Sector: Mechanical engineering Company headquarters: Waiblingen Sector: Automotive Company headquarters: Stuttgart-Zuffenhausen Heilbronn Sector: Cleaning technology Karlsruhe Company headquarters: Winnenden Pforzheim Sector: Mechanical engineering Company headquarters: Ditzingen Stuttgart Sector: Automation technology Company headquarters: Esslingen am Neckar Reutlingen Ulm Sector: Technology and services Company headquarters: Stuttgart Sector: Textiles Company headquarters: Metzingen Sector: Automotive Freiburg Company headquarters: Stuttgart Sector: Automotive supplier Company headquarters: Friedrichshafen Investment guide Baden-Württemberg 05 Selected international