Buch Gredl.11.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pulmonata, Helicidae) and the Systematic Position of Cylindrus Obtusus Based on Nuclear and Mitochondrial DNA Marker Sequences
© 2013 The Authors Accepted on 16 September 2013 Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research Published by Blackwell Verlag GmbH J Zoolog Syst Evol Res doi: 10.1111/jzs.12044 Short Communication 1Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), University of Oslo, Oslo, Norway; 2Central Research Laboratories, Natural History Museum, Vienna, Austria; 33rd Zoological Department, Natural History Museum, Vienna, Austria; 4Department of Integrative Zoology, University of Vienna, Vienna, Austria; 5Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary New data on the phylogeny of Ariantinae (Pulmonata, Helicidae) and the systematic position of Cylindrus obtusus based on nuclear and mitochondrial DNA marker sequences 1 2,4 2,3 3 2 5 LUIS CADAHIA ,JOSEF HARL ,MICHAEL DUDA ,HELMUT SATTMANN ,LUISE KRUCKENHAUSER ,ZOLTAN FEHER , 2,3,4 2,4 LAURA ZOPP and ELISABETH HARING Abstract The phylogenetic relationships among genera of the subfamily Ariantinae (Pulmonata, Helicidae), especially the sister-group relationship of Cylindrus obtusus, were investigated with three mitochondrial (12S rRNA, 16S rRNA, Cytochrome c oxidase subunit I) and two nuclear marker genes (Histone H4 and H3). Within Ariantinae, C. obtusus stands out because of its aberrant cylindrical shell shape. Here, we present phylogenetic trees based on these five marker sequences and discuss the position of C. obtusus and phylogeographical scenarios in comparison with previously published results. Our results provide strong support for the sister-group relationship between Cylindrus and Arianta confirming previous studies and imply that the split between the two genera is quite old. The tree reveals a phylogeographical pattern of Ariantinae with a well-supported clade comprising the Balkan taxa which is the sister group to a clade with individuals from Alpine localities. -

Liste Rouge Mollusques (Gastéropodes Et Bivalves)
2012 > L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces > Liste rouge Mollusques (gastéropodes et bivalves) Espèces menacées en Suisse, état 2010 > L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces > Liste rouge Mollusques (gastéropodes et bivalves) Espèces menacées en Suisse, état 2010 Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par le Centre suisse de cartographie de la faune CSCF Berne, 2012 Valeur juridique de cette publication Impressum Liste rouge de l’OFEV au sens de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance Editeurs du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage Office fédéral de l’environnement (OFEV) (OPN; RS 451.1), www.admin.ch/ch/f/rs/45.html L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). La présente publication est une aide à l’exécution de l’OFEV en tant Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF), Neuchâtel. qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées Auteurs provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application Mollusques terrestres: Jörg Rüetschi, Peter Müller et François Claude uniforme de la législation. Elle aide les autorités d’exécution Mollusques aquatiques: Pascal Stucki et Heinrich Vicentini notamment à évaluer si un biotope doit être considéré comme digne avec la collaboration de Simon Capt et Yves Gonseth (CSCF) de protection (art. 14, al. 3, let. d, OPN). Accompagnement à l’OFEV Francis Cordillot, division Espèces, écosystèmes, paysages Référence bibliographique Rüetschi J., Stucki P., Müller P., Vicentini H., Claude F. -

Molluscs of the Dürrenstein Wilderness Area
Molluscs of the Dürrenstein Wilderness Area S a b i n e F ISCHER & M i c h a e l D UDA Abstract: Research in the Dürrenstein Wilderness Area (DWA) in the southwest of Lower Austria is mainly concerned with the inventory of flora, fauna and habitats, interdisciplinary monitoring and studies on ecological disturbances and process dynamics. During a four-year qualitative study of non-marine molluscs, 96 sites within the DWA and nearby nature reserves were sampled in cooperation with the “Alpine Land Snails Working Group” located at the Natural History Museum of Vienna. Altogether, 84 taxa were recorded (72 land snails, 12 water snails and mussels) including four endemics and seven species listed in the Austrian Red List of Molluscs. A reference collection (empty shells) of molluscs, which is stored at the DWA administration, was created. This project was the first systematic survey of mollusc fauna in the DWA. Further sampling might provide additional information in the future, particularly for Hydrobiidae in springs and caves, where detailed analyses (e.g. anatomical and genetic) are needed. Key words: Wilderness Dürrenstein, Primeval forest, Benign neglect, Non-intervention management, Mollusca, Snails, Alpine endemics. Introduction manifold species living in the wilderness area – many of them “refugees”, whose natural habitats have almost In concordance with the IUCN guidelines, research is disappeared in today’s over-cultivated landscape. mandatory for category I wilderness areas. However, it may not disturb the natural habitats and communities of the nature reserve. Research in the Dürrenstein The Dürrenstein Wilderness Area Wilderness Area (DWA) focuses on providing invento- (DWA) ries of flora and fauna, on interdisciplinary monitoring The Dürrenstein Wilderness Area (DWA) was as well as on ecological disturbances and process dynamics. -

Rote Liste Weichtiere (Schnecken Und Muscheln)
2012 > Umwelt-Vollzug > Rote Listen / Artenmanagement > Rote Liste Weichtiere (Schnecken und Muscheln) Gefährdete Arten der Schweiz, Stand 2010 > Umwelt-Vollzug > Rote Listen / Artenmanagement > Rote Liste Weichtiere (Schnecken und Muscheln) Gefährdete Arten der Schweiz, Stand 2010 Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt BAFU und vom Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna SZKF/CSCF Bern, 2012 Rechtlicher Stellenwert dieser Publikation Impressum Rote Liste des BAFU im Sinne von Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung Herausgeber vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV; Bundesamt für Umwelt (BAFU) des Eidg. Departements für Umwelt, SR 451.1) www.admin.ch/ch/d/sr/45.html Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Bern. Schweizerisches Zentrum für die Kartografie der Fauna (SZKF/CSCF), Diese Publikation ist eine Vollzugshilfe des BAFU als Aufsichtsbehörde Neuenburg. und richtet sich primär an die Vollzugsbehörden. Sie konkretisiert unbestimmte Rechtsbegriffe von Gesetzen und Verordnungen und soll Autoren eine einheitliche Vollzugspraxis fördern. Sie dient den Vollzugs- Landschnecken: Jörg Rüetschi, Peter Müller und François Claude behörden insbesondere dazu, zu beurteilen, ob Biotope als schützens- Wassermollusken: Pascal Stucki und Heinrich Vicentini wert zu bezeichnen sind (Art. 14 Abs. 3 Bst. d NHV). in Zusammenarbeit mit Simon Capt und Yves Gonseth (CSCF) Begleitung BAFU Francis Cordillot, Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Zitierung Rüetschi J., Stucki P., Müller P., Vicentini H., Claude F. 2012: Rote Liste -

Die Molluskenfauna Tirols
© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at Die Molluskenfauna Tirols Von Hermann Riezler © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at Einleitung Der vorliegende Aufsatz ist der dritte Teil meiner anläßlich der Lehrbefähigung für Hauptschulen vorgelegten Hausarbeit „Die Molluskenfauna Tirols". Warum ich gerade diesen Teil der Öffentlichkeit über- gebe sei im Folgenden kurz begründet. Alles, was von den verschiedenen Forschern und Samm- lern auf diesem Gebiete in Tirol gearbeitet wurde, veröffent- lichten sie in zahlreichen größeren und kleineren Aufsätzen, die heute, man kann ohne Übertreibung sagen, in alle Winde zerstreut sind. Es besteht große Gefahr, daß diese Aufzeich- nungen in Verlust und Vergessenheit geraten. Um nur ein Beispiel zu bringen sind Gredlers Arbeiten und Sammel- berichte etc. weder im Museum, noch in der Universitäts- bibliothek, noch im Franziskanergymnasium in Hall voll- ständig, ja selbst die drei Bibliotheken zusammengenommen haben diese Arbeiten nicht vollzählig. Indem ich nun meine Arbeit über das ganze ehemalige Tirol ausdehne und die vielen Notizen und Aufzeichnungen bei dieser berücksich- tige, hoffe ich, einmal der oben angedeuteten Gefahr vor- gebeugt, und zweitens gleichzeitig dem Übelstande, daß über diesen Zweig der Zoologie keine Sammelarbeit be- steht, abgeholfen zu haben. Gleichzeitig kann ich feststellen, daß ich von allen Persönlichkeiten und von allen Stellen, die ich bei der Ab- fassung dieser Arbeit um Rat und Hilfe anging, immer weitgehendste Unterstützung gefunden habe. Es würde © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at zu weitführen, wollte ich alle hier namentlich anführen. Ich danke allen aufs innigste. Ganz besonderen Dank schulde ich aber Fräulein Luise Biasioli, das mir die Samm- lung ihres verstorbenen Vaters gerne und jederzeit zur Ver- fügung stellte, den Herren Universitätsprofessor Dr. -

Stylommatophora: Clausiliidae), II – Neue Molluskenfunde Aus Der Vorhöhle Der Lurgrotte Bei Peggau (Steiermark; Kat.-Nr
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Linzer biologische Beiträge Jahr/Year: 2001 Band/Volume: 0033_2 Autor(en)/Author(s): Fellner (Frank) Christa Artikel/Article: Studien an Clausilia dubia DRAPARNAUD 1805 (Stylommatophora: Clausiliidae), II – Neue Molluskenfunde aus der Vorhöhle der Lurgrotte bei Peggau (Steiermark; Kat.-Nr. 2836/1). 797-818 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Linzer biol. Beitr. 33/2 797-818 30.11.2001 Studien an Clausilia dubia DRAPARNAUD 1805 (Stylommatophora: Clausiliidae), II - Neue Molluskenfunde aus der Vorhöhle der Lurgrotte bei Peggau (Steiermark; Kat.-Nr. 2836/1) C. FRANK Abstract: About Clausilia dubia DRAPARNAUD 1805 (Stylommatophora: Clausiliidae), II - New findings of mollusca from the entrance part of the dripstone cave Lurgrotte near Peggau (Styria; Cat. No. 2836/1) The samples of profile 2 contained a whole of 22 species and subspecies of mollusca. The thanatocoenoses obtained from the different stratigraphical units are probably of young pleistocene age. They were analysed from palaeoecological point of view. Furthermore, a special regard is paid to the morphology of Clausilia dubia and to the zoogeographical distribution of their recent subspecies: The findings suggest an earlier seperation of C. dubia floningiana WESTERLUND from the ancestral C. dubia-stem, apparently not caused by the last glaciation. Key words: Clausilia dubia - Gastropoda - late pleistocene sediments - alpine glaciation - palaeoecological considerations - periglacial environments - Lurgrotte (Peggau, Styria) Einleitung Herr Dr. F.A. Fladerer überließ mir die Molluskenreste aus den Sedimentproben von Profil 2, westlicher Seitenarm der Vorhöhle der Lurgrotte bei Peggau (Kat.-Nr. 2836/1; Karte). -

Ne 12˚00' 12˚10' 12˚20' 12˚30' 12˚40' 12˚50' 13˚00' 13˚10
N E 12˚00’ 12˚10’ 12˚20’ 12˚30’ 12˚40’ 12˚50’ 13˚00’ 13˚10’ 13˚20’ 13˚30’ 13˚40’ 13˚50’ 47˚42’ 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 47˚48’ 8138 8139 8140 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 47˚54’ 8038 8039 8040 8041 8042 8043 8044 8045 8046 8047 8048 8049 48˚00’ 7938 7939 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 48˚06’ 7838 7839 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 48˚12’ 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 48˚18’ 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 48˚24’ 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 48˚30’ 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 48˚36’ 7338 7339 7340 7341 7342 7343 7344 7345 7346 7347 7348 7349 48˚42’ 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 48˚48’ 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 48˚54’ 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 49˚00’ 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 49˚06’ 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 49˚12’ 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 49˚18’ 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 49˚24’ 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 49˚30’ 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449 49˚36’ 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 49˚42’ 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 49˚48’ 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6148 6149 -
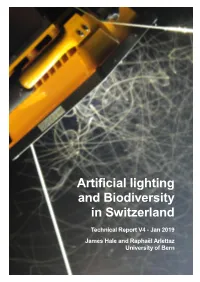
Artificial Lighting and Biodiversity in Switzerland
Artificial lighting and Biodiversity in Switzerland Technical Report V4 - Jan 2019 James Hale and Raphaël Arlettaz University of Bern 1 Table of Contents 1 Introduction .....................................................................................................................4 1.1 Background to this report .........................................................................................4 1.2 Key findings from this study: .....................................................................................4 1.3 Key recommendations: .............................................................................................5 1.4 Ecological actions overview ......................................................................................7 2 Data availability on Swiss artificial lighting .......................................................................9 2.1 Summary ..................................................................................................................9 2.2 Introduction and background ..................................................................................10 2.3 Review and analysis of Swiss lighting data.............................................................10 2.3.1 VIIRS DNB (satellite mounted sensor).............................................................10 2.3.2 ISS images ......................................................................................................12 2.3.3 Street lamp inventories ....................................................................................18 -

8. Rezente Arten
741 8. Rezente Arten Den Abschluss dieser Studie bildet eine Übersicht der Cochlostoma (Turritus) Westerlund 1883 rezent in Österreich registrierten Molluskenarten. Dabei Cochlostoma (T.) waldemari (A. J. Wagner 1897) wurden die folgenden Autoren (in alphabetischer Reihung) Cochlostoma (T.) tergestinum (Westerlund 1878) berücksichtigt: Cochlostoma (T.) anomphale Boeckel 1939 Adler (1993), Bank et al. (2001), Beckmann (1999), Cochlostoma (T.) nanum (Westerlund 1879) Edlinger u. Daubal (2000), Falkner (1998b), Falkner et Cochlostoma (T.) gracile croaticum (L. Pfeiffer 1870), syn.: al. (2001), Gloer (2002b), Gloer u. Meier-Brook (2003), Cochlostoma (T.) gracile stussineri (A. J. Wagner 1897) Jackiewicz (1998), Kittel (1998b), Nesemann u. Holler (1998), Nordsieck, H. (1993a, 2000, 2002, 2003), Patzner Aciculidae u. Szedlarik (1996), Reischütz, P. (1998b, 1999a, 2000a, Acicula Hartmann 1821 2002a, b), Reischütz, A. u. P. (2000, 2001), Riedel (1998), Acicula lineata lineata (Draparnaud 1805) Schultz, H. u. O. (2001), Slapnik (2001), Stummer, A. Acicula lineolata banki Boeters, Gittenberger u. Subai (1984). 1989 In Anlehnung an Reischütz (1998b: 31) werden folgen- Platyla Moquin-Tandon 1856 de Symbole zur Kennzeichnung verwendet: Platyla polita (W. Hartmann 1840) [ ] – eingeschleppte Arten (Freiland) Platyla gracilis (Clessin 1877) [[ ]] – eingeschleppte Arten (dauerhafter nur in Glashäusern, Thermalwässern u. dgl.) Renea G. Nevill 1880 (?) – in Österreich nicht gesichertes Vorkommen Renea veneta (Pirona 1865) { } Artberechtigung zu überprüfen Ampullariidae Gastropoda Pomacea Perry 1810 Orthogastropoda [[Pomacea bridgesi (Reeve 1856)]] Neritaemorphi Neritopsina Viviparidae Neritidae Viviparus Montfort 1810 Theodoxus Montfort 1810 Viviparus contectus (Millet 1813) Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer 1828) Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) [Theodoxus fluviatilis (Linnaeus 1758)] [(?) Viviparus viviparus (Linnaeus 1758)] Theodoxus danubialis danubialis (C. Pfeiffer 1828) Theodoxus d. stragulatus (C. Pfeiffer 1828) Neotaenioglossa Theodoxus prevostianus (C. -

Lista Rossa Molluschi (Gasteropodi E Bivalvi)
2012 > Pratica ambientale > Liste Rosse / Gestione delle specie > Lista Rossa Molluschi (Gasteropodi e Bivalvi) Specie minacciate in Svizzera, stato 2010 > Pratica ambientale > Liste Rosse / Gestione delle specie > Lista Rossa Molluschi (Gasteropodi e Bivalvi) Specie minacciate in Svizzera, stato 2010 A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM e del Centro Svizzero di Cartografia della Fauna CSCF Berna, 2012 Valenza giuridica della presente pubblicazione Nota editoriale Lista Rossa dell’UFAM secondo l’articolo 14 capoverso 3 Editori dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) paesaggio (OPN ; RS 451.1) www.admin.ch/ch/i/rs/45.html L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), Berna. La presente pubblicazione, elaborata dall’UFAM in veste di autorità di Centro Svizzero di Cartografia della Fauna (CSCF), Neuchâtel. vigilanza, è un testo d’aiuto all’esecuzione destinato in primo luogo alle autorità esecutive. Nel testo viene data concretezza a concetti Autori giuridici indeterminati, inclusi in leggi e ordinanze, nell’intento di Gasteropodi terrestri: Jörg Rüetschi, Peter Müller e François Claude promuoverne un’esecuzione uniforme. Essa costituisce un aiuto per le Molluschi acquatici: Pascal Stucki e Heinrich Vicentini, autorità esecutive, in particolare nella designazione dei biotopi degni in collaborazione con Simon Capt e Yves Gonseth (CSCF) di protezione (art. 14 cpv. 3, lett. d OP. N) Accompagnamento UFAM Francis Cordillot, divisione Specie, ecosistemi, paesaggi Indicazione bibliografica Rüetschi J., Stucki P., Müller P., Vicentini H., Claude F. 2012: Lista Rossa Molluschi (Gasteropodi e Bivalvi). Specie minacciate della Svizzera, stato 2010. -

Studien an Clausilia Dubia DRAPARNAUD 1805 (Stylommatophora: Clausiliidae)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wissenschaftliche Mitteilungen Niederösterreichisches Landesmuseum Jahr/Year: 1997 Band/Volume: 10 Autor(en)/Author(s): Fellner (Frank) Christa Artikel/Article: Studien an Clausilia dubia DRAPARNAUD 1805 (Stylommatophora: Clausiliidae). (N.F. 417) 163-189 ©Amt der Niederösterreichischen Landesregierung,, download unter www.biologiezentrum.at Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum 10 163 - 189 Wien 1997 Studien an Clausilia dubia DRAPARNAUD 1805 (Stylommatophora: Clausiliidae) CHRISTA FRANK Schlüsselwörter: Clausilia dubia, Pleistozän, subspezifische Gliederung Keywords: Clausilia dubia, Pleistocene, subspecific differentation Zusammenfassung Das pleistozäne Clausilia dwb/a-Material aus Höhlenfundstellen und Freiland- vorkommen Österreichs wird zum Anlaß genommen, die Frage nach der gegen- wärtigen reichen subspezifischen Gliederung dieser Art erneut aufzugreifen. Für die Aufgliederung der Linien dubia dubia und dubia speciosa muß der letzte Käl- tehöhepunkt der Würmvereisung auslösend gewesen sein. Die Vorläufer von Clausilia dubia dubia und Clausilia dubia speciosa zeigen morphologische Paral- lelen zu den Formen ostösterreichischer Lößfaunen, aus denen auch Clausilia dubia obsoleta hervorgegangen sein muß. Wenn die Beziehungen der beiden ersteren zueinander auch sehr eng sind, sollten doch alle drei Linien als eine Ein- heit angesehen werden. Summary The abundant pleistocene material of Clausilia dubia from different cave and loess localities in Austria made it possible to study its present subspecific dif- ferentiation. Presumably the last pleniglacial period of the alpine Wurmian glacia- tion induced the development of the two lines Clausilia dubia dubia and Clau- silia dubia speciosa. The ancestor forms of Clausilia dubia dubia and Clausilia dubia speciosa show morphological similarities to these dubia specimens which occur in a lot of loess localities in Eastern Austria. -
Gastropoda Pulmonata): Morphology, Taxonomy, and a Catalogue of Taxa
Ruthenica, 2013, vol. 23, No. 2: 127-162. © Ruthenica, 2013 Published online October 15, 2013. http: www.ruthenica.com Family Helicidae excluding Helicinae (Gastropoda Pulmonata): morphology, taxonomy, and a catalogue of taxa A. A. SCHILEYKO A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution of Russian Academy of Sciences, Leninski prosp. 33, Moscow 119071, RUSSIA. E-mail: [email protected] urn:lsid:zoobank.org:pub:E2650308-70B2-48E2-B1CA-E630B644179F ABSTRACT. The problem of generic and subgeneric Ariantinae constitute one of the few exceptions: rank in Ariantinae is briefly discussed. A review of generally accepted genera and subgenera (especial- existing views on the system of non-helicine Helicidae ly in the largest genus – Chilostoma) are primarily (Ariantinae, Murellinae, and Thebinae) and differential discriminated on the basis of conchological charac- diagnoses of the taxa are presented. Special attention is ters. paid to the morphology of the atrial stimulator and, At the same time, it should be noted that the especially, penial papilla, because these organs play an important role in evolution of helicoid groups, provid- diversity of shells and especially of the reproductive ing the functioning of a pre-copulatory isolating mech- tract of various Ariantinae is comparatively low. anism. Thus, there is a problem of defining characters that can be used to distinguish taxa. Some years ago, I wrote: “Subdivision of the Introduction genus Helicigona into subgenera at the present time is conditional and is based mainly on conchological The family Helicidae is a rather large group of features whereas anatomy of their type species is snails having European and circummediterranean very similar.