Der Gute Mensch' Von Weinsberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
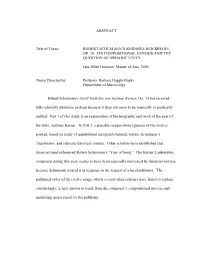
Complete Document
ABSTRACT Title of Thesis: ROBERT SCHUMANN’S KERNER-LIEDERREIHE, OP. 35: ITS COMPOSITIONAL GENESIS AND THE QUESTION OF ORGANIC UNITY Jane Ellen Harrison, Master of Arts, 2006 Thesis Directed by: Professor Barbara Haggh-Huglo Department of Musicology Robert Schumann’s Zwölf Gedichte von Justinus Kerner , Op. 35 has received little scholarly attention, perhaps because it does not seem to be musically or poetically unified. Part 1 of this study is an examination of the biography and work of the poet of the texts, Justinus Kerner. In Part 2, a possible compositional genesis of the work is posited, based on study of unpublished autograph material, letters, Schumann’s Tagebücher, and relevant historical context . Other scholars have established that financial need influenced Robert Schumann’s “Year of Song.” The Kerner-Liederreihe, composed during this year, seems to have been especially motivated by financial worries, because Schumann created it in response to the request of a local publisher. The published order of the twelve songs, which several other scholars have failed to explain convincingly, is here shown to result from the composer’s compositional process and marketing issues raised by the publisher. ROBERT SCHUMANN’S KERNER-LIEDERREIHE, OP. 35: ITS COMPOSITIONAL GENESIS AND THE QUESTION OF ORGANIC UNITY By Jane Ellen Harrison Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts 2006 Advisory Committee: Professor Barbara Haggh-Huglo, Chair Professor Peter Beicken Professor Richard King ACKNOWLEDGEMENTS My foremost gratitude goes to my advisor, Dr. -

Nikolaus Lenau's "Faust" : Ein Gedicht
1918 NIKOLAUS LENAU'S "FAUST" Ein Gedicht BY ANTOINE FERDINAND ERNST HENRY MEYER THESIS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN GERMAN COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES UNIVERSITY OF ILLINOIS 19 18 ms 15* ft 5 UNIVERSITY OF ILLINOIS L^......i 9 il c3 THIS IS TO CERTIFY THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION BY £j£rtdt£k^ $^Zf.& ENTITLED (^^*ditL4. i%. £&Z. A^rrtf. ^.t^kit^. ^^....^^^.^(^.. IS APPROVED BY ME AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF wiÄrfifdt^ Instructor in Charge Approved : HEAD OF DEPARTMENT OF titäkttt**^ 410791 ÜlUC Inhaltsübersicht. Seite A. Einführung. i _ üi B. Biographischer Abriss. I. Lenaus Jugend in Österreich-Ungarn bis zum Jahre 1831. 1-20 II. Wander jähre vom Juni 1831 bis September 1833. a. In Schwaben 21 - 29 b. Amerika-Reise und Aufenthalt 30 - 35 III. Faust Periode. 36 - 56 (Oktober 1833 bis März 1836) C. Schluss. 57 - 62 Digitized by the Internet Archive in 2013 http://archive.org/details/nikolauslenausfaOOmeye 1 Nikolaus Lenau's "Faust" . Ein Ge dicht. A. Einführung. ^nter den vielen Bearbeitern der Faustsage nimmt Nikolaus Lenau einen hervorragenden Platz ein. Von den nachgoetheschen Dich Lungen ist seine Bearbeitung unzweifelhaft die gediegenste. Sie ist eine "Neu- und weiterdi chtung des Faustproblems, eine neue dichterische Auffassung und Durchführung des Faustoff es. Um seine originelle Lebens Anschauung in Torte zu kleiden, wählte Lenau sich Faust "den Philosophen der Philosophen", wie sich dieser in prahlerischer Y'eise genannt hatte, zum Sprecher aus. Der grosse Goethe benutzte den Faust zur Schilderung des Menschen, das heisst, der gesamten Menschheit. -

Kerner, Justinus Geboren 18.091786, Ludwigsburg Gestorben 21.02
Kerner, Justinus Geboren 18.091786, Ludwigsburg Gestorben 21.02.1862, Weinsberg Wirkungsstätte Weinsberg Tätigkeitsfeld Dichter, Arzt und medizinischer Schriftsteller Leistung Namhafter Vertreter der Schwäbischen Dichterschule, bemühte sich um die Erhaltung der Burgruine Weibertreu Beschreibung Justinus war der dritte von vier Söhnen, und er hatte außerdem zwei Schwestern. Er ging in Ludwigsburg zur Schule und wurde dann zunächst in Maulbronn, wohin sein Vater versetzt worden war, von Stipendiaten der dortigen Klosterschule unterwiesen, dann erhielt er in Knittlingen Unterricht. Nach dem Tod seines Vaters 1799 kam er als Kaufmannslehrling in das Kontor der herzoglichen Tuchfabrik in Ludwigsburg. Kerner gefiel die stumpfsinnige Arbeit nicht und er fing an, Gedichte zu schreiben und die Kranken des im selben Gebäude untergebrachten Irrenhauses durch Spie- len auf seiner Maultrommel zu unterhalten. Von 1804 bis zu seiner Promo- tion 1808 studierte er Medizin und Naturwissenschaften in Tübingen. Be- reits zu Studienzeiten war er mit Ludwig Uhland und Gustav Schwab be- freundet, woraus sich später der Kern der Schwäbischen Dichterschule entwickeln sollte, zu deren namhaftesten Vertretern Kerner gehörte. 1807 Justinus Kerner lernte er bei einer Feier aus Anlass von Uhlands Geburtstag seine spätere Frau Friederike kennen, von ihm Rickele (von Ruit) genannt und in vielen Gedichten verewigt, die er 1813 heiratete. Aus der Ehe gingen die Töchter Marie und Emma sowie der Sohn Theobald hervor. Eine enge Freund- schaft verband Kerner mit seinem Kommilitonen und Arztkollegen David Assing in Hamburg, der Friederike in schwerer Krankheit geheilt hatte, ebenso mit Assings Ehefrau Rosa Maria und ihrem Bruder Karl August Varnhagen von Ense in Berlin. Nach seinem Studium und mehreren Reisen war er ab 1810 als Arzt tätig, zunächst in Dürrmenz, ab 1811 Badearzt in Wildbad und ab 1812 als praktischer Arzt in Welzheim. -

Musikstunde Mit Katharina Eickhoff Montag, 6
__________________________________________________________________________ (Svevia, terra di poeti! – Für Volker Kälberer, der das alles mit viel schönen Reden gepriesen hat.) Musikstunde mit Katharina Eickhoff Montag, 6. Dezember 2010 Schwabenstreiche – Ausfahrten in romantischer Seelenlandschaft mit Kerner, Uhland, Mörike und den Freunden Teil I: Der Mann im Turm Indikativ Die spinnen, die Schwaben. Leben da in ihrem Ländle vor sich hin, verwahren sich gegen den Fortschritt in Gestalt zukunftsweisender Verkehrspolitik, sparen, kehren die Gasse, schieben ihre Spätzle vom Brett und sind dabei mit ihrer Kulturgeschichte so liebend verbunden wie kein anderes deutsches Völkchen. Weshalb auch die anderen sich gerade über sie besonders gern lustig machen. Die älteren zumindest unter den Schwaben sind allesamt noch in diesem seltsamen Zauberkreis großgeworden, der von Außenstehenden so misstrauisch beäugt wird, und dessen geistiges Zentrum irgendwo zwischen Ludwigsburg und Tübingen liegt, oder vielleicht auch in Weinsberg bei Kerners unterm Sofa, oder im Wirtshaus Hirsch zu Echterdingen, wo sich alles traf, was dichten konnte,- an der Stuttgarter Weinsteige, wo alle die Dichter gen Süden wanderten, oder auf der rauen Alb, wo einst ein melancholischer Vikar namens Mörike statt Predigten Gedichte von der Kanzel hat regnen lassen. 2 Diese Älteren wissen auch noch, wer Graf Eberhard im Barte war und wieso er sein Haupt jedem Untertanen kühnlich in den Schoß legen konnte, sie finden blind Wilhelm Hauffs Grab auf dem Stuttgarter Hoppenlau-Friedhof, wissen, dass Ludwig Uhland den Schwabenstreich erfunden hat und kennen jene Silcher-Lieder, von denen unsereins noch nicht mal mehr den Refrain zusammenkriegt. Und so ist auswärts dieses spezifische Bild des Schwaben entstanden: heimatliebend, den Blick nach innen gerichtet, Württemberger trinkend und dabei schwäbische Dichter zitierend. -
10. Some Remarks on the New Edition of the Works of Wilhelm Müller1
https://www.openbookpublishers.com © 2021 Roger Paulin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Roger Paulin, From Goethe to Gundolf: Essays on German Literature and Culture. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021, https://doi.org/10.11647/OBP.0258 Copyright and permissions for the reuse of many of the images included in this publication differ from the above. Copyright and permissions information for images is provided separately in the List of Illustrations. In order to access detailed and updated information on the license, please visit, https://doi.org/10.11647/OBP.0258#copyright Further details about CC-BY licenses are available at, https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://doi.org/10.11647/OBP.0258#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. ISBN Paperback: 9781800642126 ISBN Hardback: 9781800642133 ISBN Digital (PDF): 9781800642140 ISBN Digital ebook (epub): 9781800642157 ISBN Digital ebook (mobi): 9781800642164 ISBN Digital (XML): 9781800642171 DOI: 10.11647/OBP.0258 Cover photo and design by Andrew Corbett, CC-BY 4.0. -

Kleksografías De Justinus Kerner Selección, Traducción Y Estudio Preliminar*
TEXTOS Y CONTEXTOS KLEKSOGRAFÍAS DE JUSTINUS KERNER SELECCIÓN, TRADUCCIÓN Y ESTUDIO PRELIMINAR* Luis Montiel** Historia de la Medicina. Facultad de Medicina Universidad Complutense I. ESBOZO BIOGRÁFICO Médico, poeta, visionario: con estos tres calificativos define a nuestro personaje su biógrafo Otto Joachim Grüsser1, y cualquiera que conozca sumariamente la vida de este personaje del Romanticismo alemán reconocerá que le hace justicia. Esa tri- ple vertiente de su personalidad, desplegada por lo general en los campos correspon- dientes —como médico estudió con gran finura el botulismo; como poeta, al lado de Uhland, es cabeza del romanticismo suabo; como visionario se hará célebre con el caso de la vidente de Prevorst— se manifiesta de manera conjunta y armoniosa, al final de su vida, en esas curiosas producciones de las que pretendo mostrar algunos ejemplos en este trabajo: las kleksografías. Justinus Andreas Christian Kerner nació en Ludwigsburg el 18 de Septiembre de 1786. Sexto hijo del matrimonio formado por Christoph Ludwig Kerner (1744- 1799) y Friederike Luise Stockmayer (1750-1817), vino al mundo en esta localidad por ser la sede de la corte del Duque Carl Eugen de Württemberg (1728-1793), mo- ———— * Proyecto BHA 2000-0721. ** Profesor Titular de Historia de la Ciencia. Dpto. de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid-España. 1 GRÜSSER, O.J. (1987) Justinus Kerner. Arzt, Poet, Geisterseher. Berlin, Springer Verlag. Puede encontrar- se un excelente resumen de la biografía de Kerner en GÜNDEL, K. (1995). Die deutschen Romantiker. Zürich, Artemis und Winkler, pp. 152-155. FRENIA, Vol. -

Sketches from My Boyhood by Justinus Kerner
Sketches from My Boyhood by Justinus Kerner Sketches from My Boyhood by Justinus Kerner Translated from the German with an Introduction by Harold B. Segel Sketches from My Boyhood by Justinus Kerner Translated from the German with an Introduction by Harold B. Segel This book first published 2015 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2015 by Harold B. Segel and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-7627-5 ISBN (13): 978-1-4438-7627-8 TABLE OF CONTENTS List of Illustrations ...................................................................................... x Note from the Translator ............................................................................ xi Introduction ............................................................................................... xii Justinus Kerner and His Boyhood Memories Sketches from My Boyhood Justinus Kerner Preface ......................................................................................................... 1 My Birth and Early Years in Ludwigsburg. The Period of Duke Karl ........ 3 Schiller in Ludwigsburg in 1793. His Defense of Duke Karl. Favorable -

The Genesis and Reception History of Robert Schumann's Kerner
The Genesis and Reception of Robert Schumann’s Kerner Liederreihe, Op. 35 Robert Joseph Gennaro A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music. Chapel Hill 2009 Approved by: Jon W. Finson Mark Evan Bonds Tim Carter Annegret Fauser Jocelyn Neal ©2009 Robert Joseph Gennaro ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Robert Joseph Gennaro: The Genesis and Reception of Robert Schumann’s Kerner Liederreihe, Op. 35 (Under the direction of Jon W. Finson) Robert Schumann’s Zwölf Gedichte von Justinus Kerner: Eine Liederreihe, op. 35 (1840), represents the composer’s final song cycle from his Liederjahr, and it stands as one of his three contributions to the nineteenth-century Wanderlieder tradition (the others being op. 36 and op. 39). While multiple comprehensive studies address several of Schumann’s song cycles (opp. 39, 42, and 48), op. 35 has not received the same amount of attention from musicologists. One of the reasons for this, according to Barbara Turchin, is the misunderstanding of op. 35’s poetic theme and musical substance. The Kerner Liederreihe lacks the kind of teleological narrative found in Dichterliebe and Frauenliebe und Leben. But there may be more important questions surrounding op. 35 than tightly-knit narrative progression. My study places op. 35 in the context of the loosely-knit nineteenth-century Wanderlieder cycle by tracing its history from genesis through critical reception. I examine the process by which Schumann composed these songs, from his selection of Kerner’s verse to the chronology of composition, realization in the Berlin Liederbücher, and organization in the first edition print. -

Swr2-Musikstunde-20101209.Pdf
__________________________________________________________________________ Musikstunde mit Katharina Eickhoff Donnerstag, 9. Dezember 2010 Schwabenstreiche – Ausfahrten in romantischer Seelenlandschaft mit Kerner, Uhland, Mörike und den Freunden Teil IV: Im Kernerhaus Indikativ „Seine Augen haben etwas Geisterhaftes und Frommes,...er selbst hat etwas Somnambüles, das ihn auch im Scherz und Lachen begleitet. Er kann lange sinnen und träumen, und dann plötzlich auffahren, wo dann der Schreck der anderen ihm gleich wieder zum Scherze dient. Wahnsinnige kann er nachmachen, dass man zusammenschaudert, und obwohl er dies possenhaft beginnt, so ist ihm doch im Verlauf nicht possenhaft dabei zumut...Nun denkt Euch noch die einfachste, ganz vernachlässigte Kleidung, vorgebeugte Haltung, ungleichen, ungeraden Gang, eine stete Neigung, sich anzulehnen oder niederzulegen, und bei allem diesen einen doch wohlgewachsenen, ganz hübschen Jungen – so habt ihr ein vollständiges Bild meines Kerners.“ So beschreibt Karl August Varnhagen von Ense, der als Student aus dem Norden nach Tübingen gekommen ist, seinen Studienkollegen und Freund Justinus Kerner. „Aha“, sagten freundlich-interessiert, aber ahnungslos die meisten, als ich erzählte, dass ich über Kerner schreiben will. Ziemlich viele kennen ihn gar nicht mehr, und wenn überhaupt, dann ist heute nur noch ein verzerrtes Bild von Justinus Kerner in Umlauf – der dicke, frohgemute Heimatdichter, der, Inbegriff schwäbischer 2 Behaglichkeit, in Weinsberg im Schatten der Weibertreu residierte, mengenweise prominente Besucher empfing und mit Württemberger Wein traktierte, und der dort die Nationalhymne Württembergs geschrieben hat, die heute eben auch kein Mensch unter vierzig mehr kennt, geschweige denn aufsagen kann, jenes „Preisend mit viel schönen Reden/ihrer Länder Wert und Zahl/saßen viele deutsche Fürsten/einst zu Worms im Kaisersaal“.