Konversionen Denkmal – Werte – Wandel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kachess Drought Relief Pumping Plant and Keechelus Reservoir-To-Kachess
Kachess Drought Relief Pumping Plant and Keechelus Reservoir-to-Kachess Reservoir Conveyance FINAL Environmental Impact Statement KITTITAS and YAKIMA COUNTIES, WASHINGTON ERRATA 2 Kachess Reservoir Keechelus Reservoir Kachess Reservoir Keechelus Reservoir Estimated Total Cost Associated with Developing and Producing this Final EIS is approximately $3,500,000. DEPARTMENT OF ECOLOGY St ate of Washington U.S. Department of the Interior State of Washington Bureau of Reclamation Department of Ecology Pacific Northwest Region Office of Columbia River Columbia-Cascades Area Office Yakima, Washington Yakima, Washington Ecology Publication Number: 18-12-011 March 2019 Errata Sheets March 25, 2019 The Kachess Drought Relief Pumping Plant and Keechelus Reservoir to Kachess Reservoir Conveyance Final Environmental Impact Statement has been revised with information that was inadvertently excluded from the final document. 1. Volume II: Comments and Responses, a placement error occurred on Page DEIS-CR-10. This page should be replaced with Errata 1 as a continuance of page DEIS-CR-9. 2. Volume III: Reclamation did not receive a petition with several thousand signatures sent via Change.org, including associated comments by the July 11, 2018, deadline for the Supplemental Draft EIS public comment period. However, the sender did attempt to e-mail the petition via Change.org, so it has been included for full disclosure and is represented as Errata 2. Errata 2 Errata #2 Recipient: Maria Cantwell, Dan Newhouse, Reuven Carlyle, Guy Palumbo, Sharon Brown, Brad Hawkins, Steve Hobbs, John McCoy, Kevin Ranker, Tim Sheldon, Lisa Wellman Letter: Greetings, I am writing to express my concern and disapproval of the proposed Kachess Drought Relief Pumping Plant and Keechelus Reservoir-to-Kachess Reservoir Conveyance within Kittitas County, WA. -

REFLECTIONS 148X210 UNTOPABLE.Indd 1 20.03.15 10:21 54 Refl Ections 54 Refl Ections 55 Refl Ections 55 Refl Ections
3 Refl ections DAS MAGAZIN DES ÖSTERREICHISCHEN Refl ections SONG CONTEST CLUBS MERCI CHÉRIE – MERCI, JURY! AUSGABE 2015 | ➝ Es war der 5. März 1966 beim Grand und belgischen Hitparade und Platz 14 in Prix d’Eurovision in Luxemburg als schier den Niederlanden. Im Juni 1966 erreichte Unglaubliches geschah: Die vielbeachte- das Lied – diesmal in Englisch von Vince te dritte Teilnahme von Udo Jürgens – Hill interpretiert – Platz 36 der britischen nachdem er 1964 mit „Warum nur war- Single-Charts. um?“ den sechsten Platz und 1965 mit Im Laufe der Jahre folgten unzähli- SONG CONTEST CLUBS SONG CONTEST 2015 „Sag‘ ihr, ich lass sie grüßen“ den vierten ge Coverversionen in verschiedensten Platz belegte – bescherte Österreich end- Sprachen und als Instrumentalfassungen. Wien gibt sich die Ehre lich den langersehnten Sieg. In einem Hier bestechen – allen voran die aktuelle Teilnehmerfeld von 18 Ländern startete Interpretation der grandiosen Helene Fi- der Kärntner mit Nummer 9 und konnte scher – die Versionen von Adoro, Gunnar ÖSTERREICHISCHEN schließlich 31 Jurypunkte auf sich verei- Wiklund, Ricky King und vom Orchester AUSSERDEM nen. Ein klarer Sieg vor Schweden und Paul Mauriat. Teilnehmer des Song Contest 2015 – Rückblick Grand Prix 1967 in Wien Norwegen, die sich am Podest wiederfan- Hier sieht man das aus Brasilien stam- – Vorentscheidung in Österreich – Das Jahr der Wurst – Österreich und den. mende Plattencover von „Merci Cherie“, DAS MAGAZIN DES der ESC – u.v.m. Die Single erreichte Platz 2 der heimi- das zu den absoluten Raritäten jeder Plat- schen Single-Charts, Platz 2 der deutschen tensammlung zählt. DIE LETZTE SEITE ections | Refl AUSGABE 2015 2 Refl ections 2 Refl ections 3 Refl ections 3 Refl ections INHALT VORWORT PRÄSIDENT 4 DAS JAHR DER WURST 18 GRAND PRIX D'EUROVISION 60 HERZLICH WILLKOMMEN 80 „Building bridges“ – Ein Lied Pop, Politik, Paris. -

Amtliches Verkündigungsblatt Der Stadt Weißenfels
29. Jahrgang Ausgegeben am 1. März 2019 Nummer 2 Weißenfelser Amtsblatt Amtliches Verkündigungsblatt der Stadt Weißenfels ❖ Inhalt Vorwort des Oberbürgermeisters Amtliche Bekanntmachungen – Stadt Weißenfels - Öffentliche Bekanntma- chung zur Festsetzung der Grundsteuer für das Kalen- derjahr 2019 durch öffentli- che Bekanntmachung (§ 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz) - Bekanntmachung des Auf- stellungsbeschlusses und der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Nr. 39 der Stadt Weißenfels Wohn- gebiet „Am Sportplatz“ im Ortsteil Langendorf - Wahl des Stadtrates und der Ortschaftsräte in den Ortschaften der Stadt Wei- ßenfels, I. Zusammenset- zung des Gemeindewahl- ausschusses, II. Sitzung des Wahlausschusses zur Zulassung der Wahlvor- schläge - Sitzübergang im Ort- schaftsrat Schkortleben Amtliche Bekanntmachungen – Jagdgenossenschaft Burgwerben - Einladung zur Mitglieder- versammlung Amtliche Bekanntmachungen – Jagdgenossenschaft Großkorbetha - Einladung zur Jahresver- sammlung Amtliche Bekanntmachungen – Jagdgenossenschaft Schkortleben - Einladung zur Mitglieder- ELV versammlung Amtliche Bekanntmachungen – $8667(//81* Sonstige - Gewässerschau in der Stadt Weißenfels 0XVHXP:HLHQIHOV - Deichschau LP6FKORVV1HX$XJXVWXVEXUJ Nichtamtlichen Teil - Aus dem Stadtrat - Aus der Verwaltung =HLW]HU6WUDH - Kulturelle Veranstaltungen - Museum Schloss :HLHQIHOV Neu-Augustusburg - Informationen aus der Stadtbibliothek - Informationen Anzeigenteil www.weissenfels.de © Nemtschek-Stiftung Liebe Weißenfelserinnen, liebe Weißenfelser, dieser Februar scheint -

Rollins Magazine, Spring 2012 Rollins College Office Ofa M Rketing and Communications
Rollins College Rollins Scholarship Online Rollins Magazine Marketing and Communications Spring 2012 Rollins Magazine, Spring 2012 Rollins College Office ofa M rketing and Communications Follow this and additional works at: http://scholarship.rollins.edu/magazine Part of the Higher Education Commons Recommended Citation Rollins College Office of Marketing and Communications, "Rollins Magazine, Spring 2012" (2012). Rollins Magazine. Paper 20. http://scholarship.rollins.edu/magazine/20 This Magazine is brought to you for free and open access by the Marketing and Communications at Rollins Scholarship Online. It has been accepted for inclusion in Rollins Magazine by an authorized administrator of Rollins Scholarship Online. For more information, please contact [email protected]. SPRING | 2012 ROLLINS MAGAZINE THE PSYCHOLOGY OF PLACE How does your environment influence what you do and why you do it? P. 13 Plus: Rollins Alumni Make Important Contributions to the Sciences + the Feminist Movement Forges Ahead at Rollins SPRING | 2012 ROLLINS MAGAZINE 13 | THE PSYCHOLOGY OF PLACE 18 | THE EXCITEMENT OF DISCOVERY COVE R ILLUSTRATION BY EMILIANO PONZI 28 | NEW WAVE FEMINISM The Excitement of DISCOVERY PAGE 18 1 | CONVERSATION WITH THE PRESIDENT 2 | FROM THE GREEN 34 | ALUMNI SPOTLIGHT 37 | CONNECTED FOR LIFE 39 | ALUMNI REGIONAL CLUBS 43 | CLASS NEWS 48 | THE LAST WORD TALK TO US EDITOR: LAURA J. COLE ’04 ’08 MLS CREATIVE DIRECTOR: MARY WETZEL WISMAR-DAVIS ’76 ’80 MBA ROLLINS MAGAZINE E-MAIL: [email protected] ASSISTANT EDITOR: AMANDA D’ASSARO PHONE: 407-646-2791 WRITE: 1000 Holt Ave. – 2729, Winter Park, FL 32789-4499 GRAPHIC DESIGN: AUDREY PHILLIPS, DESIGN STUDIO ORLANDO, INC. WEB: rollins.edu/magazine; click on “Talk to U s” All ideas expressed in Rollins Magazine are those of the authors or the editors and do ROLLINS ALUMNI ASSOCIATION not necessarily reflect the offi cial position of the Alumni Association or the College. -
Obituary "A" Index
Obituary "A" Index Copyright © 2004 - 2020 GRHS DISCLAIMER: GRHS cannot guarantee that should you purchase a copy of what you would expect to be an obituary from its obituary collection that you will receive an obituary per se. The obituary collection consists of such items as a) personal cards of information shared with GRHS by researchers, b) www.findagrave.com extractions, c) funeral home cards, d) newspaper death notices, and e) obituaries extracted from newspapers and other publications as well as funeral home web sites. Some obituaries are translations of obituaries published in German publications, although generally GRHS has copies of the German versions. These German versions would have to be ordered separately for they are kept in a separate file in the GRHS library. The list of names and dates contained herein is an alphabetical listing [by surname and given name] of the obituaries held at the Society's headquarters for the letter combination indicated. Each name is followed by the birth date in the first column and death date in the second. Dates may be extrapolated or provided from another source. Important note about UMLAUTS: Surnames in this index have been entered by our volunteers exactly as they appear in each obituary but the use of characters with umlauts in obits has been found to be inconsistant. For example the surname Büchele may be entered as Buchele or Bahmüller as Bahmueller. This is important because surnames with umlauted characters are placed in alphabetic order after regular characters so if you are just scrolling down this sorted list you may find the surname you are looking for in an unexpected place (i.e. -
Deutsche Nationalbibliografie 2015 a 29
Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2015 A 29 Stand: 15. Juli 2015 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2015 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-ReiheA29_2015-9 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- ansonsten -
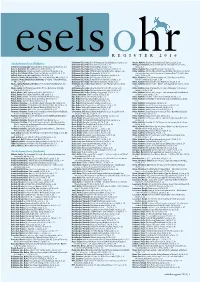
Eselsohr Register 2007–2016
esels oREGISTEhrR 2016 Brillmann-Ede, Heike: Eine Hommage an Astrid Lindgren, 03/16, S. 35 Jessler, Nadine: Sägen, kleben, häkeln (IO Spot), 12/16, S. 29 Artikelverzeichnis (Bulletin) Brillmann-Ede, Heike: Früh übt sich, 12/16, S. 31 Kitzing, Constanze v.: Ausmalbilder für Flüchtlingskinder (IO Spot), Archipowa, Anastassija: Schatzkammer der Illustration, BU 03/16, S. 6 Brillmann-Ede, Heike: Herzensdinge, 06/16, S. 26 04/16, S. 9 Bensch, Katharina: BücherBilderKunst, BU 04/16, S. 13 Brillmann-Ede, Heike: Kleiner Engel mit Träumen, 12/16, S. 23 Köhler, Natalie: Wünsche & Wirklichkeit, 06/16, S. 18 Bensch, Katharina: LitCam: Grenzenloses Lernen, BU 04/16, S. 10 Brillmann-Ede, Heike: Mit den Augen der Liebe sehen, 08/16, S. 24 Köller, Kathrin: „Ich möchte weiterhin Geschichten schreiben, von denen Galling, Ines/Nickel, Ulrike: Dänische Delikatessen, BU 02/16, S. 12 Brillmann-Ede, Heike: Ränkespiele, 10/16, S. 32 die Leute denken, dass Kinder sie nicht lesen sollten!“ (Porträt: Alex Galling, Ines: Smørrebrød und Bücher, BU 02/16, S. 4 Brillmann-Ede, Heike: Schreiben als Abenteuer, 06/16, S. 15 Gino), 12/16, S. 22 Hirvonen, Vuokko/Nickel, Ulrike: Samisches Aufblühen, BU 02/16, S. 11 Brillmann-Ede, Heike: Shit happens, 07/16, S. 21 Köller, Kathrin: 6 Tage, 90 Veranstaltungen, 7000 Besucher: White Laustsen, Mette/Christensen, Henriette: Grönland – Kalaallit Nunaar, Brillmann-Ede, Heike: Temporeiches Verwirrspiel, 08/16, S. 27 Ravens Festival 2016, 07/16, S. 24 BU 02/16, S. 6 Brillmann-Ede, Heike: Überlebensstrategien, 03/16, S. 24 Köller, Kathrin: Alles Kuhl (Porträt: Anke Kuhl), 04/16, S. 10 Mucke, Sylvia/Paxmann, Christine: Förderung auf Skandinavisch, BU Brillmann-Ede, Heike: Warum Klassiker? Ein Plädoyer (Kommentar), Köller, Kathrin: Auf der Flucht – Kinder- und Jugendbücher 2016, 02/16, 02/16, S. -

Lünen-Horstmar, PLS Vom 04.-05.06.2 Beratung, Planung Und Durchführung Von Reit- Und Fahrturnieren Stand: 24.05.2016 Seite 1 Von 27
Teilnehmer- / Pferdeübersicht TURNIERORGANISATION Bernhard Hessling Lünen-Horstmar, PLS vom 04.-05.06.2 Beratung, Planung und Durchführung von Reit- und Fahrturnieren Stand: 24.05.2016 Seite 1 von 27 ABRAHAM,LENA ZRFV Voßwinkel e.V. genannte Prf.:18: 1, 21/2: 1, 22: 1, 0210 Daddy`s Darling DE 441411471109 07j.Westf Schi S v. Desperados M.v. Rubin-Royal Züchter: Gabor Szecsi Besitzer: Michaele Abraham 0325 Happyness 29 DE 441410471705 11j.Westf Db S v. His Highness M.v. Apart Züchter: Josef Feldmann Besitzer: Michaele Abraham AHNEMANN,ELENA RFV St. Georg Werne e. V. genannte Prf.:20/1: 1, 21/1: 1, 0373 Liadora DE 441410988208 08j.Westf B S v. Lugato M.v. Royal Angelo I Züchter: Wilhelm Trillmann Besitzer: Elena Ahnemann 0376 Lightness T DE 441410988108 08j.Westf B S v. Lacordos M.v. Grannus Züchter: Wilhelm Trillmann Besitzer: Gregor Trillmann ALI,TAHAR Dortmunder RV e.V. genannte Prf.:19: 1, 20/1: 1, 21/1: 1, 22: 1, 0136 Charmante 33 DE 431311326603 13j.Hann F S v. Chasseur I M.v. Grafenstein Züchter: Carola Lampe Besitzer: Tahar Ali 0307 Ginster 103 DE 333331030799 17j.Old Schi W v. Gingerino M.v. Argentinus Züchter: Erwin Risch Besitzer: Saskia Seibel 0484 Quidam's Alegria DE 418180160903 13j.OS B S v. Quidam's Rubin M.v. Acord II Züchter: Wilhelm Meiners Besitzer: Tahar Ali ANDERSHOF,NADINE RV Brambauer e.V. genannte Prf.:15: 1, 16/1: 1, 20/1: 1, 0183 Contessa PS DE 427270363805 11j.Meckl. B S v. Condelaro M.v. Polarpunkt Züchter: Pappelhof Staven/Sass Gb Besitzer: Nadine Andershof ANDREE,MARIE KRISTIN RV Rhynern e.V. -

The Multiplier Effect Are Married in Jim and Sue and Bill Gross on Linda Lippman’S Life
® SPRING 2013 NON-PROFIT ORG. U.S. POSTAGE PAID Catalyst PERMIT NO. 22328 Cedars-Sinai Medical Center LOS ANGELES, CA 8700 Beverly Boulevard, Suite 2416 Los Angeles, California 90048 Catalyst IN THIS ISSUE The Bonds of Health Head Strong PIMCO founder Bill Gross A childhood of agonizing and his wife, Sue, make migraines, and the “blessings a transformational gift to of adversity,” led Ozioma Cedars-Sinai’s Advanced Nwosu — now a Cedars-Sinai Health Sciences Pavilion. Washington Scholar — to a career in neuroscience. Love, Actually Lipstick Service Herb Klein honors his wife’s Volunteer makeup artists memory and the people at help cancer patients face Cedars-Sinai who entered the mirror and restore their Circle of Friends. their self-confidence. Healthy Passions Love of family and health The Multiplier Effect are married in Jim and Sue and Bill Gross on Linda Lippman’s life. Fostering Health in Los Angeles, and the Transformative Impact of the Advanced Health Sciences Pavilion Contents Redefining Modern The Starting Point Medicine for the Community The Major Catalyst Catalyst hope this new issue of Catalyst finds you and your loved ones 10 The Bonds of Health thriving and in the best of spirits. Catalyst is published 10 three times a year by the PIMCO founder Bill Gross and his wife, Sue, make a transformational This is an exciting year for Cedars-Sinai and the community we serve. Community Relations and gift to Cedars-Sinai’s Advanced Health Sciences Pavilion. IThanks to the generous and steadfast support of our donors, the Advanced Development Department of Cedars-Sinai Medical Center. -

Angela Million · Anna Juliane Heinrich Thomas Coelen Editors
Angela Million · Anna Juliane Heinrich Thomas Coelen Editors Education, Space and Urban Planning Education as a Component of the City Education, Space and Urban Planning Angela Million • Anna Juliane Heinrich Thomas Coelen Editors Education, Space and Urban Planning Education as a Component of the City 123 Editors Angela Million Thomas Coelen Urban and Regional Planning (ISR) Educational Science and Psychology Technische Universität Berlin (TU Berlin) University of Siegen Berlin Siegen Germany Germany Anna Juliane Heinrich Urban and Regional Planning (ISR) Technische Universität Berlin (TU Berlin) Berlin Germany ISBN 978-3-319-38997-4 ISBN 978-3-319-38999-8 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-38999-8 Library of Congress Control Number: 2016939045 © Springer International Publishing Switzerland 2017 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. -
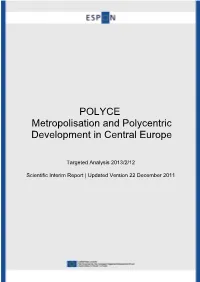
POLYCE Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe
POLYCE Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe Targeted Analysis 2013/2/12 Scientific Interim Report | Updated Version 22 December 2011 ESPON 2013 1 This report presents the interim results of a Targeted Analysis conducted within the framework of the ESPON 2013 Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The partnership behind the ESPON Programme consists of the EU Commission and the Member States of the EU27, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. Each partner is represented in the ESPON Monitoring Committee. This report does not necessarily reflect the opinion of the members of the Monitoring Committee. Information on the ESPON Programme and projects can be found on www.espon.eu The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This basic report exists only in an electronic version. © ESPON & The Transnational Project Group as indicated in the List of Authors, 2011. Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON Coordination Unit in Luxembourg. ESPON 2013 2 List of authors Lead Partner: Vienna University of Technology (VUT), Centre of Regional Science Rudolf Giffinger, Johannes Suitner, Justin Kadi, Hans Kramar, Christina Simon University of Ljubljana (LJU), Faculty of Civil Engineering and Geodesy Natasa Pichler-Milanovic, Alma Zavodnik-Lamousek, Samo Drobne, Miha Konjar Slovak University of Technology (STUBA), -

Housing Capital Resource and Representation
Jahrbuch für Europäische Geschichte. European History Yearbook Jahrbuch für Europäische Geschichte European History Yearbook Herausgegeben von Johannes Paulmann in Verbindung mit Markus Friedrich und Nick Stargardt Edited by Johannes Paulmann in cooperation with Markus Friedrich and Nick Stargardt Band/Volume 18 Housing Capital Resource and Representation Edited by Simone Derix and Margareth Lanzinger Herausgegeben am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte von Johannes Paulmann in Verbindung mit Markus Friedrich und Nick Stargardt Gründungsherausgeber: Heinz Duchhardt ISBN 978-3-11-052994-4 e-ISBN (PDF) 978-3-11-053224-1 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-053002-5 ISSN 1616–6485 Die Online Ausgabe steht unter einer Creative Commons CC BY-NC-ND Lizenz (vgl. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Titelbild: Traditional Flemish architecture in Bruges, Flanders, Belgium © Alexander Spatari / Moment / gettyimages Satz: Konvertus, Haarlem Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck ♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com Contents Simone Derix and Margareth Lanzinger Housing Capital: Interdisciplinary