Deutscher Bundestag Kleine Anfrage
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plenarprotokoll 19/117
Plenarprotokoll 19/117 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 117. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 16. Oktober 2019 Inhalt: Ausschussüberweisung . 14309 B Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- dere Aufgaben . 14311 C Gustav Herzog (SPD) . 14311 D Tagesordnungspunkt 1: Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- Erste Beratung des von der Bundesregierung dere Aufgaben . 14312 A eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, Gustav Herzog (SPD) . 14312 B 105 und 125b) Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- Drucksache 19/13454 . 14309 C dere Aufgaben . 14312 B Oliver Luksic (FDP) . 14312 C Tagesordnungspunkt 2: Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- Erste Beratung des von der Bundesregierung dere Aufgaben . 14312 C eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Oliver Luksic (FDP) . 14312 D Reform des Grundsteuer- und Bewertungs- rechts (Grundsteuer-Reformgesetz – Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- GrStRefG) dere Aufgaben . 14313 A Drucksachen 19/13453, 19/13713 . 14309 D Maik Beermann (CDU/CSU) . 14313 B Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- Tagesordnungspunkt 3: dere Aufgaben . 14313 B Erste Beratung des von der Bundesregierung Ingrid Remmers (DIE LINKE) . 14313 D eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- Änderung des Grundsteuergesetzes zur dere Aufgaben . 14314 A Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung Dr. Anna Christmann (BÜNDNIS 90/ Drucksache 19/13456 . 14309 D DIE GRÜNEN) . 14314 A Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- dere Aufgaben . 14314 B Tagesordnungspunkt 4: Dr. Anna Christmann (BÜNDNIS 90/ Befragung der Bundesregierung DIE GRÜNEN) . 14314 C Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- Dr. Helge Braun, Bundesminister für beson- dere Aufgaben . 14310 A dere Aufgaben . 14314 C Dr. Rainer Kraft (AfD) . -

Drucksache 19/1858 19
Deutscher Bundestag Drucksache 19/1858 19. Wahlperiode 25.04.2018 Kleine Anfrage der Abgeordneten Christoph Meyer, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, Christine Aschenberg-Dugnus, Jens Beeck, Nicola Beer, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Christian Dürr, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, Katja Hessel, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, Gyde Jensen, Thomas L. Kemmerich, Karsten Klein, Daniela Kluckert, Pascal Kober, Dr. Lukas Köhler, Wolfgang Kubicki, Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Michael Georg Link, Oliver Luksic, Dr. Jürgen Martens, Alexander Müller, Roman Müller-Böhm, Frank Müller-Rosentritt, Dr. Martin Neumann, Bernd Reuther, Christian Sauter, Frank Schäffler, Judith Skudelny, Bettina Stark-Watzinger, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Benjamin Strasser, Linda Teuteberg, Michael Theurer, Dr. Andrew Ullmann, Gerald Ullrich, Johannes Vogel (Olpe), Sandra Weeser, Nicole Westig und der Fraktion der FDP „Operation Abendsonne“ – Beförderungen und Stellenhebungen durch die Bundesregierung am Ende der 18. Wahlperiode Laut Meldung des Nachrichtenmagazins „DER SPIEGEL“ vom 18. Oktober 2017 wies der damalige geschäftsführende Chef des Bundeskanzleramts Peter Altmaier seine Kabinettskollegen schriftlich darauf hin, dass „...zur Vermeidung einer Präjudizierung der künftigen Bundesregierung (...) bei der Beschlussfas- sung kabinettspflichtiger Personalien besondere politische Zurückhaltung geboten (sei).“ (www.spiegel.de/politik/deutschland/kanzleramt-peter-altmaier-will- -

Deutscher Bundestag Kleine Anfrage
Deutscher Bundestag Drucksache 19/30863 19. Wahlperiode 01.07.2021 Kleine Anfrage der Abgeordneten Karsten Klein, Christian Dürr, Otto Fricke, Bettina Stark- Watzinger, Ulla Ihnen, Christoph Meyer, Michael Georg Link, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, Nicole Bauer, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg, Dr. Marco Buschmann, Carl-Julius Cronenberg, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Dr. Christopher Gohl, Thomas Hacker, Reginald Hanke, Torsten Herbst, Katja Hessel, Dr. Gero Hocker, Manuel Höferlin, Dr. Christoph Hoffmann, Reinhard Houben, Olaf in der Beek, Gyde Jensen, Dr. Lukas Köhler, Carina Konrad, Konstantin Kuhle, Alexander Kulitz, Ulrich Lechte, Alexander Müller, Dr. Martin Neumann, Matthias Nölke, Bernd Reuther, Christian Sauter, Matthias Seestern-Pauly, Judith Skudelny, Hermann Otto Solms, Dr. Marie-Agnes Strack- Zimmermann, Benjamin Strasser, Katja Suding, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich, Sandra Weeser, Nicole Westig und der Fraktion der FDP Wirtschaftshilfen in der Covid-19 Pandemie Am 30.6.2021 entfällt die so genannte "Bundesnotbremse" des Infektionsschutz- gesetzes. Eine Entscheidung der Bundesregierung, ob es zu einer Verlängerung der Regelung kommt, die ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 100 greift, steht aus. Zugleich endet am 30.6.2021 auch die Überbrückungshilfe III für die deutsche Wirtschaft. Trotz bereits laufender Lockerungen der Maßnahmen gegen die Aus- breitung des Coid-19-Virus - bei zeitgleichem Sinken des 7-Tage-Inzidenzwertes - ist eine komplette Rückkehr aller wirtschaftlichen, schulischen oder kulturellen Aktivitäten ohne coronabedingte Einschränkungen derzeit nicht absehbar. Wir fragen die Bundesregierung: Frage 1: Wird die so genannte "Bundesnotbremse" über den 30.6.2021 hinaus verlängert (bitte begründen)? Der Gesetzgeber hat sich gegen eine Verlängerung der sog. „Bundesnotbremse“ über den 30. -

Networking for More Europe EBD Summary 2017/18
European Movement Germany: our areas of work Governance & Participation Actors and Networking Education and Information This area of our work develops Eu- This area of our work conceives and This area of our work combines EBD’s ropean Movement Germany (EBD) coordinates measures for the identifi- education and information measures. measures in the realm of European cation and sustainable networking of The offer aims to reach teachers and affairs. It includes the Europeanisation EU actors in administrative positions, learners in particular, but also tar- and democratisation of governance in EBD member organisations and gets multipliers from interest groups. in the multi-level system of the EU others. Such measures include meet- The implementation of all measures on the basis of a structured dialogue ings of the network “Brussels Alumni achieves the statutory purpose of the between social forces and political in- in Berlin” or the alumni of the College organisation to promote European European stitutions. According to its statute, the of Europe, as well as partner projects integration through information and Movement association directly implements these with member organisations, strategic education work. Specifically, this in- Germany measures itself, supporting European activities between allies and the EBD volves establishing and developing integration through the development database. These activities achieve European education in schools, for of its own initiatives. These include our organisation’s aim of supporting young people and students, as well committee statements on European the EBD members’ various European as disseminating the European idea affairs, background discussions, work- information, cooperation and educa- through information campaigns and ing groups, public events, publications tion activities and thus illustrating the cross-border education projects. -

Wird Durch Die Lektorierte V Ersion Ersetzt
Deutscher Bundestag Drucksache 19/5282 19. Wahlperiode 26.10.2018 ersetzt. - wird durch die lektorierte Version Vorabfassung Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 22. Oktober 2018 eingegangenen Antworten der Bundesregierung Verzeichnis der Fragenden Abgeordnete Nummer Abgeordnete Nummer der Frage der Frage Achelwilm, Doris (DIE LINKE.) .................... 124, 125 Fricke, Otto (FDP) ................................................ 6, 50 Amtsberg, Luise (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .... 43 Gabelmann, Sylvia (DIE LINKE.) ......................... 128 Bause, Margarete Gastel, Matthias (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ................................ 69 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ............................. 134 Bellmann, Veronika (CDU/CSU) ........................... 126 Gehring, Kai (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ......... 51 Beutin, Lorenz Gösta Gelbhaar, Stefan (DIE LINKE.) ................................. 119, 120, 121, 122 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ............................. 135 Brandenburg, Mario (Südpfalz) (FDP) ........... 164, 165 Göring-Eckardt, Katrin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ......................... 52, 53 Brandner, Stephan (AfD) .................................. 84, 113 Groß, Michael (SPD) ...................................... 154, 155 Brantner, Franziska, Dr. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .......................... 44, 85 Grundl, Erhard (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ......................... 20, 21 Büttner, Matthias (AfD) ...................................... 14, 15 Hänsel, Heike (DIE LINKE.) ................................... 54 Buschmann, Marco, -

Drucksache 19/15305 19
Deutscher Bundestag Drucksache 19/15305 19. Wahlperiode 19.11.2019 Kleine Anfrage der Abgeordneten Bernd Reuther, Frank Sitta, Torsten Herbst, Dr. Christian Jung, Daniela Kluckert, Oliver Luksic , Grigorios Aggelidis, Renata Alt, Christine Aschenberg-Dugnus, Nicole Bauer, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein- Neckar), Dr. Marco Buschmann, Carl-Julius Cronenberg, Britta Katharina Dassler, Hartmut Ebbing, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Thomas Hacker, Peter Heidt, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, Torsten Herbst, Katja Hessel, Manuel Höferlin, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, Gyde Jensen, Dr. Marcel Klinge, Carina Konrad, Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Michael Georg Link, Till Mansmann, Christoph Meyer, Alexander Müller, Roman Müller-Böhm, Hagen Reinhold, Christian Sauter, Dr. Wieland Schinnenburg, Judith Skudelny, Bettina Stark-Watzinger, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Katja Suding, Linda Teuteberg, Michael Theurer, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, Dr. Florian Toncar, Gerald Ullrich, Nicole Westig und der Fraktion der FDP Forschungsförderung in der Luftfahrt Das Flugzeug ist die CO2-intensivste Art zu reisen. Deswegen ist über die Kli- maschädlichkeit des Luftverkehrs in den letzten Monaten häufig berichtet wor- den. Dabei wird das Flugzeug die einzige Möglichkeit bleiben, weite Strecken zurückzulegen, ohne dabei eine tage- oder wochenlange Reisedauer in Kauf zu nehmen. Außerdem gibt es bereits Ambitionen den Luftverkehr zu dekarboni- sieren. So ist er z. B. seit 2012 im europäischen Zertifikatehandel, und ab 2020 tritt das internationale Kompensationssystem CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) in Kraft, damit der Luftverkehr CO2-neutral wächst. Darüber hinaus haben Flugreisende die Möglichkeit, das auf ihren Flügen ausgestoßene CO2 über Portale wie Atmosfair zu kompensie- ren. -
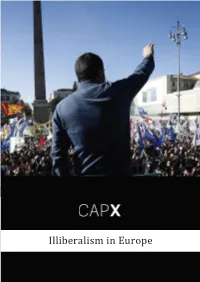
Illiberalism in Europe © CAPX / the ATLAS NETWORK 2019
Illiberalism in Europe © CAPX / THE ATLAS NETWORK 2019 CapX is a politics website,that brings you the best writing on economics, ideas, policy and technology. It is owned and produced by the Centre for Policy Studies. capx.co 2 Illiberalism in Europe CONTENTS Foreword 04 Beware the false clash between ‘liberalism’ and ‘illiberalism’ 06 - Hans Kundnani The CAP doesn’t fit – why the EU’s farm subsidies are ripe for reform 10 - Kai Weiss Ukraine’s government promises a fresh start – or another false dawn 15 - John Ashmore Driving in the wrong direction: the folly of Germany’s green car agenda 21 - Oliver Luksic Woke authoritarianism stems from a worldview based on lies 26 - Konstantin Kisin Emmanuel Macron – France’s failed liberal saviour 30 - Anne-Elisabeth Moutet Viktor Orbán and the corruption of conservatism 34 - Dalibor Rohac Illiberal and economically illiterate – Germany’s new housing policy 39 - Rainer Zitelmann Europe’s politicians fiddle as liberalism burns 44 - John C. Hulsman Sweden’s great tax hoax – a story of fiscal illusions 49 - Nima Sanandaji For liberalism to survive, we must renounce technocracy 54 - Helen Dale Communism is gone, but there is still a burning desire for change in Eastern Europe 59 - Eszter Szucs capx.co 3 Illiberalism in Europe FOREWORD At a time when hard-won progress can seem under threat CapX is proud to present this groundbreaking collection of essays on the theme of Illiberalism in Europe. This book explores the different challenges to liberal economies and societies across the continent, from populism to protectionism, threats to free speech and the scourge of corruption. -

What Parliamentary Budget Authority in the European Union?
Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Doktor der Philosophie“ (Dr. phil.) WHAT PARLIAMENTARY BUDGET-AUTHORITY IN THE EU? The European Parliament and the German Bundestag in the Negotiations of the Multi-Annual Financial Framework 2014-2020 Von: Linn Selle Einreichung: 30. November 2016 Verteidigung: 29. Mai 2017 Betreuer und Erstgutachter: Prof. Dr. Timm Beichelt (Europa-Universität Viadrina) Zweitgutachterin: Prof. Dr. Gabriele Abels (Eberhardt Karls Universität Tübingen) This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ List of Figures i Executive Summary ii 1. Introduction 1 1.1 Research interest 1 1.2 Literature Review 4 1.2.1 EU Parliamentary Representation 4 1.2.2 EU Budgetary Politics 8 1.3 Literature Gaps and Research Question 10 1.4 Structure of Analysis 11 PART I) ANALYTICAL FOUNDATIONS 14 2. Parliamentary Representation 14 2.1 Representation – a interactive, dynamic process 14 2.2 Parliamentary Representation 18 2.3 The EU Representative System 23 3. The Parliamentary Budget Authority 29 3.1 The Development of Parliamentary Budgeting 30 3.2 The Parliamentary Budget Authority 34 4. Methodological Considerations 42 4.1 Case Selection 43 4.2 Dimensions of Representation 46 4.2.1 Internal Representation 46 4.2.2 External Representation 48 4.3 Phases and Levels of Analysis 51 4.4 Data Collection and Analysis 53 4.4.1 Internal Representation 53 4.4.2 External Representation 55 PART II) PARLIAMENTS AND THE EU BUDGETARY SYSTEM 59 5. Parliamentary Representation In The European Union 59 5.1 Parliamentary Representation in the Integration Process 61 5.2 The European Parliament and the Bundestag in the EU Political Process 64 5.2.1 Parliamentary functions in the EU Policy Process 64 5.2.2 Parliamentary Practices 71 5.3 Vertical embeddedness: Interparliamentary Cooperation 76 5.4 What Parliamentary Representation in the EU? 84 6. -

Politikszene 2530.1..5 .– – 31 4.16.20112
politik & Ausgabe Nr. 31875 kommunikation politikszene 2530.1..5 .– – 31 4.16.20112 Foto: Deutscher Bundestag/H. MüllerJ. Grosse-Brömer folgt auf Altmaier Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Michael Grosse-Brömer (51) zum neuen Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Der niedersächsische CDU-Bundestagsabgeordnete erhielt bei der Fraktions- Peter Altmaier sitzung am 22. Mai 161 von 174 abgegebenen Stimmen. Er folgt auf den neuen Bundesumweltminister Peter Altmaier (politikszene 384 berichtete). Als Nachfolger Grosse-Brömers im Amt des Justitiars wurde der nordrhein-westfälische Abgeordnete Helmut Brandt gewählt. seit 2009 2009 bis 2010 2010 bis 2012 Justiziar der CDU/CSU-Bundes- Michael Grosse-Brömer Vorsitzender der Landesgruppe Rechtspolitischer Sprecher Niedersachsen im Deutschen der CDU/CSU-Bundestags- tagsfraktion Bundestag fraktion Eckner lobbyiert für Ford Martin Eckner (45) wird zum 1. Juni Direktor für Regierungs- und Verbandsangelegenheiten bei Ford Foto: Auto-Medienportal.Net/Ford Deutschland. Die Position umfasst die Unterstützung des Lobbyings in Deutschland sowie einigen Reiner Steilen europäischen Märkten. Eckner folgt auf Reiner Steilen, der in Altersteilzeit geht. Eckner war zuletzt „Manager für Europaangelegenheiten“ bei Ford Deutschland in Brüssel. 1994 bis 2004 2004 bis 2009 2010 bis 2012 Angestellter in der Abteilung Zuständig für Regierungs- und Manager für Europaangelegen- betrieblicher Umweltschutz bei Verbandsangelegenheiten bei heiten bei Ford Deutschland in Martin Eckner Ford Deutschland Ford Deutschland Brüssel Laschet soll NRW-CDU führen Armin Laschet (51), bisher stellvertretender Vorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU, soll Medienberichten zufolge neuer Chef der Landespartei werden. Er folgt auf Norbert Röttgen, der nach Norbert Röttgen der Landtagswahl am 13. Mai von seinem Amt zurücktrat. Karl-Josef Laumann, der ebenfalls als Nach- folger Röttgens im Gespräch war, bleibt Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag. -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 19/183 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 183. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 8. Oktober 2020 Inhalt: Wahl der Abgeordneten Leni Breymaier, Kay Fritz Güntzler (CDU/CSU) . 22951 D Gottschalk, Jan Ralf Nolte und Martin Markus Herbrand (FDP) . 22953 C Hohmann als Schriftführer . 22943 A Änderungen der Tagesordnung . 22943 B Fabio De Masi (DIE LINKE) . 22954 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 18 b und Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 22954 D 33 s . 22943 B Michael Schrodi (SPD) . 22955 D Sebastian Brehm (CDU/CSU) . 22956 C Tagesordnungspunkt 26: Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Tagesordnungspunkt 10: Umsetzung der Richtlinien (EU) 2019/878 Antrag der Abgeordneten René Springer, und (EU) 2019/879 zur Reduzierung von Dr. Bernd Baumann, Stephan Brandner, wei- Risiken und zur Stärkung der Proportiona- terer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: lität im Bankensektor (Risikoreduzierungs- Inländische Arbeitskräfte zuerst – Falsche gesetz – RiG) Weichenstellungen des Fachkräfteeinwan- Drucksache 19/22786 . 22943 B derungsgesetzes rückgängig machen Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 22943 C Drucksache 19/23132 . 22957 D Dr. Bruno Hollnagel (AfD) . 22944 C René Springer (AfD) . 22957 D Alexander Radwan (CDU/CSU) . 22945 B Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU) . 22958 D Dr. Florian Toncar (FDP) . 22946 B Linda Teuteberg (FDP) . 22960 A Jörg Cezanne (DIE LINKE) . 22947 A Dr. Lars Castellucci (SPD) . 22961 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 22947 C Susanne Ferschl (DIE LINKE) . 22962 C Johannes Schraps (SPD) . 22948 B Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 22963 A Sepp Müller (CDU/CSU) . 22949 A Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU) . 22964 A René Springer (AfD) . 22964 C Tagesordnungspunkt 27: Dr. -
The Committees of the German Bundestag 2 3 Month in and Month Out, the German Bundestag Adopts New Laws Or Amends Existing Legislation
The Committees of the German Bundestag 2 3 Month in and month out, the German Bundestag adopts new laws or amends existing legislation. The Bundestag sets up permanent committees in every electoral term to assist it in accomplishing this task. In these committees, the Members concentrate on a specialised area of policy. They discuss the items referred to them by the ple- nary and draw up recommen- dations for decisions that serve as the basis for the ple- nary’s decision. The permanent committees of the German Bundestag – at the heart of Parliament’s work The Bundestag is largely free to decide how many commit- tees it establishes, a choice which depends on the priori- ties it wants to set in its par- liamentary work. There are 24 committees in the 19th electoral term. They essen- tially mirror the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios, corre- sponding to the fields for which the ministries are The Committee on Labour and responsible. This facilitates Social Affairs and the Com- parliamentary scrutiny of the mittee on Internal Affairs and Federal Government’s work, Community have 46 members another of the Bundestag’s each, making them among the central functions. largest committees. Only the That said, in establishing com- Committee on Economic mittees, the Bundestag also Affairs and Energy has more sets political priorities of its members: 49. The Committee own. For example, the com- for the Scrutiny of Elections, mittees responsible for sport, Immunity and the Rules of tourism, or human rights and Procedure is the smallest humanitarian aid do not have committee, with 14 members. -

20210325 1-Data.Pdf
Deutscher Bundestag 218. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 25. März 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zum Beschluss des Rates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom (Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz - ERatG) Drs. 19/26821 und 19/27901 Abgegebene Stimmen insgesamt: 645 Nicht abgegebene Stimmen: 63 Ja-Stimmen: 478 Nein-Stimmen: 95 Enthaltungen: 72 Ungültige: 0 Berlin, den 25.03.2021 Beginn: 13:25 Ende: 13:56 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Thorsten Frei X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Michael Frieser X Hans-Joachim Fuchtel X Ingo Gädechens X Dr.