Vorwort Zu PB 5308
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Season 2018-2019 the Philadelphia Orchestra
Season 2018-2019 The Philadelphia Orchestra Saturday, June 15, at 8:00 Sunday, June 16, at 2:00 Yannick Nézet-Séguin Conductor Richard Woodhams Oboe Ricardo Morales Clarinet Daniel Matsukawa Bassoon Jennifer Montone Horn Mozart Sinfonia concertante in E-flat major, K. 297b, for winds and orchestra I. Allegro II. Adagio III. Andantino con variazioni—Andante The June 15 concert is sponsored by Ralph Muller. The June 16 concert is sponsored by John McFadden and Lisa Kabnick. 24 The Philadelphia Orchestra Jessica Griffin The Philadelphia Orchestra Philadelphia is home and orchestra, and maximizes is one of the preeminent the Orchestra continues impact through Research. orchestras in the world, to discover new and The Orchestra’s award- renowned for its distinctive inventive ways to nurture winning Collaborative sound, desired for its its relationship with its Learning programs engage keen ability to capture the loyal patrons at its home over 50,000 students, hearts and imaginations of in the Kimmel Center, families, and community audiences, and admired for and also with those who members through programs a legacy of imagination and enjoy the Orchestra’s area such as PlayINs, side-by- innovation on and off the performances at the Mann sides, PopUP concerts, concert stage. The Orchestra Center, Penn’s Landing, free Neighborhood is inspiring the future and and other cultural, civic, Concerts, School Concerts, transforming its rich tradition and learning venues. The and residency work in of achievement, sustaining Orchestra maintains a Philadelphia and abroad. the highest level of artistic strong commitment to Through concerts, tours, quality, but also challenging— collaborations with cultural residencies, presentations, and exceeding—that level, and community organizations and recordings, the on a regional and national by creating powerful musical Orchestra is a global cultural level, all of which create experiences for audiences at ambassador for Philadelphia greater access and home and around the world. -

Repertoire List
APPROVED REPERTOIRE FOR 2022 COMPETITION: Please choose your repertoire from the approved selections below. Repertoire substitution requests will be considered by the Charlotte Symphony on an individual case-by-case basis. The deadline for all repertoire approvals is September 15, 2021. Please email [email protected] with any questions. VIOLIN VIOLINCELLO J.S. BACH Violin Concerto No. 1 in A Minor BOCCHERINI All cello concerti Violin Concerto No. 2 in E Major DVORAK Cello Concerto in B Minor BEETHOVEN Romance No. 1 in G Major Romance No. 2 in F Major HAYDN Cello Concerto No. 1 in C Major Cello Concerto No. 2 in D Major BRUCH Violin Concerto No. 1 in G Minor LALO Cello Concerto in D Minor HAYDN Violin Concerto in C Major Violin Concerto in G Major SAINT-SAENS Cello Concerto No. 1 in A Minor Cello Concerto No. 2 in D Minor LALO Symphonie Espagnole for Violin SCHUMANN Cello Concerto in A Minor MENDELSSOHN Violin Concerto in E Minor DOUBLE BASS MONTI Czárdás BOTTESINI Double Bass Concerto No. 2in B Minor MOZART Violin Concerti Nos. 1 – 5 DITTERSDORF Double Bass Concerto in E Major PROKOFIEV Violin Concerto No. 2 in G Minor DRAGONETTI All double bass concerti SAINT-SAENS Introduction & Rondo Capriccioso KOUSSEVITSKY Double Bass Concerto in F# Minor Violin Concerto No. 3 in B Minor HARP SCHUBERT Rondo in A Major for Violin and Strings DEBUSSY Danses Sacrée et Profane (in entirety) SIBELIUS Violin Concerto in D Minor DITTERSDORF Harp Concerto in A Major VIVALDI The Four Seasons HANDEL Harp Concerto in Bb Major, Op. -
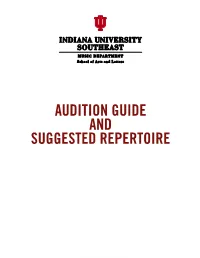
Audition Repertoire, Please Contact the Music Department at 812.941.2655 Or by E-Mail at AUDITION REQUIREMENTS for VARIOUS DEGREE CONCENTRATIONS
1 AUDITION GUIDE AND SUGGESTED REPERTOIRE 1 2 TABLE OF CONTENTS AUDITION REQUIREMENTS AND GUIDE . 3 SUGGESTED REPERTOIRE Piano/Keyboard . 5 STRINGS Violin . 6 Viola . 7 Cello . 8 String Bass . 10 WOODWINDS Flute . 12 Oboe . 13 Bassoon . 14 Clarinet . 15 Alto Saxophone . 16 Tenor Saxophone . 17 BRASS Trumpet/Cornet . 18 Horn . 19 Trombone . 20 Euphonium/Baritone . 21 Tuba/Sousaphone . 21 PERCUSSION Drum Set . 23 Xylophone-Marimba-Vibraphone . 23 Snare Drum . 24 Timpani . 26 Multiple Percussion . 26 Multi-Tenor . 27 VOICE Female Voice . 28 Male Voice . 30 Guitar . 33 2 3 The repertoire lists which follow should be used as a guide when choosing audition selections. There are no required selections. However, the following lists illustrate Students wishing to pursue the Instrumental or Vocal Performancethe genres, styles, degrees and difficulty are strongly levels encouraged of music that to adhereis typically closely expected to the of repertoire a student suggestionspursuing a music in this degree. list. Students pursuing the Sound Engineering, Music Business and Music Composition degrees may select repertoire that is slightly less demanding, but should select compositions that are similar to the selections on this list. If you have [email protected] questions about. this list or whether or not a specific piece is acceptable audition repertoire, please contact the Music Department at 812.941.2655 or by e-mail at AUDITION REQUIREMENTS FOR VARIOUS DEGREE CONCENTRATIONS All students applying for admission to the Music Department must complete a performance audition regardless of the student’s intended degree concentration. However, the performance standards and appropriaterequirements audition do vary repertoire.depending on which concentration the student intends to pursue. -

Oboe Concertos
OBOE CONCERTOS LINER NOTES CD1-3 desire to provide the first recording of Vivaldi’s complete oboe Vivaldi: Oboe Concertos works. All things considered, even the concertos whose It is more than likely that Vivaldi’s earliest concertos for wind authenticity cannot be entirely ascertained reveal Vivaldi’s instruments were those he composed for the oboe. The Pietà remarkable popularity throughout Europe during the early years documents reveal a specific interest on his part for the of the 1700s, from Venice to Sweden, including Germany, instrument, mentioning the names of a succession of master Holland and England. If a contemporary publisher or composer oboists: Ignazio Rion, Ludwig Erdmann and Ignazio Sieber, as used the composer’s name in vain, perhaps attempting to well as Onofrio Penati, who had previously been a member of emulate his style, clearly he did so in the hope of improving his the San Marco orchestra. However, it was probably not one of chances of success, since Vivaldi was one of the most famous these musicians who inspired Vivaldi to write for the oboe, but and widely admired composers of his time. Indeed, in this sense instead the German soloist Johann Christian Richter, who was in imitation bears witness to the eminence of the original. Venice along with his colleagues Pisandel and Zelenka in 1716- Various problems regarding interpretation of text came to 1717, in the entourage of Prince Frederick Augustus of Saxony. the fore during the preparation of the manuscripts’ critical As C. Fertonani has suggested, Vivaldi probably dedicated the edition, with one possible source of ambiguity being Vivaldi’s Concerto RV455 ‘Saxony’ and the Sonata RV53 to Richter, who use of the expression da capo at the end of a movement (which may well have been the designated oboist for the Concerto was used so as to save him having to write out the previous RV447 as well, since this work also called for remarkable tutti’s parts in full). -

Solo Oboe, English Horn with Band
A Nieweg Chart Solo Oboe or Solo English Horn with Band or Wind Ensemble 95 editions April 2017 The 2017 Chart is an update of the 2010 Chart. It is not a complete list of all available works for Oboe or EH and band. Works with prices listed are for sale from any music dealer. Prices current as of 2010. Look at the publisher’s website for the current prices. Works marked rental must be hired directly from the publisher listed. Sample Band Instrumentation code: 3fl[1.2.3/pic] 2ob 7cl[Eb.1.2.3.acl.bcl.cbcl] 3bn[1.2.cbn] 4sax[a.a.t.b] — 4hn 3tp 3tbn euph tuba double bass — tmp+3perc — hp, pf, cel This listing gives the number of parts used in the composition, not the number of players. ------------------ Abbado, Marcello (b. Milan, 1926; ) Concerto in C minor (complete) Arranger / Editor: Trans. Charles T. Yeago Instrumentation: Oboe solo and band Pub: BAS Publishing. SOS-217 http://www.baspublishing.com ------------------ ALBINONI, Tommaso (1674-1745) Concerto in F for TWO Oboes and Band Adapted: Paul R. Brink Grade Level: Medium Pub: Bas Publishing Co.; Score and band set SOS-226 -$65.00 | 2 oboes and piano ENS-708. $10.00 ------------------ ARENZ, Heinz (b. 1924) German wind director, administrator, and composer Concertino fur Solo Oboe und Blasorchester Dur: 7'39" Grade Level: solo 6, band 5 Pub: HeBu Music Publishing; Band score and set 113.00 € Oboe and Piano 11.00 € ------------------ ATEHORTUA, Blas Emilio (b. Medellin, Columbia, 3 October 1933) Concerto for Oboe and Wind Symphony Orchestra Instrumentation listed <http://www.edition-peters.com/pdf/Albinoni-Grieg.pdf> Dur: 15' Pub: C. -

Concertos for Oboe and Oboe D'amore
J.S. Bach Concertos for Oboe and Oboe d’amore Gonzalo X. Ruiz Portland Baroque Orchestra Monica Huggett J.S. Bach (1685-1750) Concertos for Oboe and Oboe d’amore Gonzalo X. Ruiz, baroque oboes Portland Baroque Orchestra Concerto for oboe in G minor, BWV 1056R Concerto for oboe d’amore in A major, BWV 1055R Reconstruction of BWV 1056, Concerto in F minor for Harpsichord Reconstruction of BWV 1055, Concerto in A major for Harpsichord 1 I. [Moderato] 3:10 10 I. [Allegro] 3:56 2 II. Largo 2:25 11 II. Larghetto 4:39 3 III. Presto 3:13 12 III. Allegro ma non tanto 4:08 Concerto for oboe in F major, BWV 1053R Concerto for violin and oboe in C minor, BWV 1060R Reconstruction of BWV 1053, Concerto in E major for Harpsichord Reconstruction of BWV 1060, Concerto in C minor for Two Harpsichords 4 I. [Allegro] 7:05 Monica Huggett, violin soloist 5 II. Siciliano 4:56 13 I. Allegro 4:30 6 III. Allegro 5:46 14 II. Adagio 4:30 15 III. Allegro 3:27 Concerto for oboe in D minor, BWV 1059R Reconstruction based on a concerto fragment and Cantatas 35 and 156 16 Aria from Cantata 51: “Höchster, mache deine Güte” 4:56 7 I. Allegro 5:12 Transcribed by Gonzalo X. Ruiz 8 II. Adagio 2:26 9 III. Presto 3:02 Total Time 67:21 Performed on Period Instruments 2 Gonzalo X. Ruiz, baroque oboes Born in La Plata, Argentina, Gonzalo X. Ruiz is one of the world’s most critically acclaimed baroque oboists. -

Rachmaninoff and Mozart
23 Season 2018-2019 Saturday, June 15, at 8:00 Sunday, June 16, at 2:00 The Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Conductor Richard Woodhams Oboe Ricardo Morales Clarinet Daniel Matsukawa Bassoon Jennifer Montone Horn Clyne Masquerade First Philadelphia Orchestra performances Mozart Sinfonia concertante in E-flat major, K. 297b, for winds and orchestra I. Allegro II. Adagio III. Andantino con variazioni—Andante Intermission Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor, Op. 13 I. Grave—Allegro ma non troppo II. Allegro animato III. Larghetto IV. Allegro con fuoco—Largo—Con moto This program runs approximately 2 hours. These concerts are presented in cooperation with the Sergei Rachmaninoff Foundation. The June 15 concert is sponsored by Ralph Muller. The June 16 concert is sponsored by John McFadden and Lisa Kabnick. Philadelphia Orchestra concerts are broadcast on WRTI 90.1 FM on Sunday afternoons at 1 PM, and are repeated on Monday evenings at 7 PM on WRTI HD 2. Visit www.wrti.org to listen live or for more details. 24 The Philadelphia Orchestra Jessica Griffin The Philadelphia Orchestra Philadelphia is home and orchestra, and maximizes is one of the preeminent the Orchestra continues impact through Research. orchestras in the world, to discover new and The Orchestra’s award- renowned for its distinctive inventive ways to nurture winning Collaborative sound, desired for its its relationship with its Learning programs engage keen ability to capture the loyal patrons at its home over 50,000 students, hearts and imaginations of in the Kimmel Center, families, and community audiences, and admired for and also with those who members through programs a legacy of imagination and enjoy the Orchestra’s area such as PlayINs, side-by- innovation on and off the performances at the Mann sides, PopUP concerts, concert stage. -

Florida State University Libraries
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2018 The Influences of Mannheim Style in W.A. Mozart's Concerto for Oboe, K. 314 (285D) and Jacques-Christian-Michel Widerkehr's Duo Sonata for Oboe and Piano Scott D. Erickson Follow this and additional works at the DigiNole: FSU's Digital Repository. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC THE INFLUENCES OF MANNHEIM STYLE IN W.A. MOZART’S CONCERTO FOR OBOE, K. 314 (285D) AND JACQUES-CHRISTIAN-MICHEL WIDERKEHR’S DUO SONATA FOR OBOE AND PIANO By SCOTT D. ERICKSON A Treatise submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music 2018 Scott Erickson defended this treatise on March 5, 2018. The members of the supervisory committee were: Eric Ohlsson Professor Directing Treatise Richard Clary University Representative Jeffery Keesecker Committee Member Deborah Bish Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the treatise has been approved in accordance with university requirements. ii ACKNOWLEDGMENTS I am forever grateful to everyone who has helped me along this journey. I am particularly indebted to Dr. Eric Ohlsson, whose passion for teaching and performing has changed the course of my life and career. I am thankful for the immeasurable academic guidance and musical instruction I have received from my supervisory committee: Dr. Deborah Bish, Professor Jeffrey Keesecker, and Professor Richard Clary. Finally, I would never have fulfilled this dream without the constant support and encouragement from my wonderful family. -
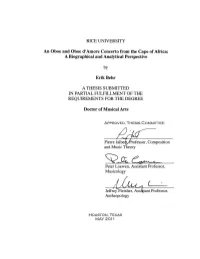
RICE UNIVERSITY an Oboe and Oboe D'amore Concerto from The
RICE UNIVERSITY An Oboe and Oboe d'Amore Concerto from the Cape of Africa: A Biographical and Analytical Perspective by Erik Behr A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE Doctor of Musical Arts ApPROVED, THESIS COMMITIEE: Pierre Jalbe rofessor, Composition and Music Theory Peter Loewen, Assistant Professor, Musicology ( Jeffrey Fleisher, Assi tant Professor, Anthropology HOUSTON, TEXAS MAY 2011 ABSTRACf An Oboe and Oboe d'Amore Concerto from the Cape of Africa: A Biographical and Analytical Perspective by Erik Behr Due to the lack of quality contemporary concertos for the oboe and, especially, the oboe d'amore, this dissertation presents two works from South African composers that provide excellent additions to the concerto repertoire. Allan Stephenson wrote Concerto for Oboe and Strings in 1978 and Peter Louis Van Dijk wrote Elegy Dance-Elegy in 1984. The outstanding quality and idiomatic nature of these works assuages the practical concerns today's oboists have when undertaking a contemporary concerto. Along with their high artistic merit, these concerti are both audience-friendly and financially feasible to present on an international stage. In addition to briefly examining the post-apartheid musical climate that exists in South Africa today, the dissertation thoroughly analyzes the works and includes biographical background of the composers. ACKNOWLEDGEMENTS Grateful thanks and admiration to the two composers of these concerti, Peter Louis Van Dijk and Allan Stephenson, not just for their compositions, but also for the ample discussion time provided by each, facilitating greater understanding of these works. The knowledgeable guidance and constructive criticism of my advisor, Pierre Jalbert, was pivotal in the completion of the dissertation. -

Cello Clarinet
Repertoire List of Eligible Solo Works (one movement of choice is to be performed) Cello Bach, J. C. : Cello Concerto in c minor Bloch : Schelomo, Hebraic Rhapsody for Cello & Orchestra Boccherini : Cello Concerto in B-flat major, G.482 Bruch : Kol Nidrei, Op. 47 Cassadó : Requiebros, Dvorak : Cello Concerto in B minor, Op. 104, B. 191 Dvorak : Rondo, Op.94 Elgar : Cello Concerto in E minor, Op. 85 Faure : Elegy, Op. 24 Haydn : Any Concerto Herbert : Concerto No.2 in E minor for Violoncello & Orchestra, op.30 Lalo : Cello Concerto in D minor Popper : Hungarian Rhapsody, Op.68 Prokofiev : Sinfonia concertante, Op.125 Saint-Saëns : Any Concerto Saint-Saëns : Allegro appassionato, Op.43 Schumann : Cello Concerto in A minor, Op. 129 Shostakovich : Cello Concerto No. 1 in E-flat major, Opus 107 Tchaikovsky : Variations on a Rococo Theme, Op.33 Vieuxtemps : Any Concerto Vivaldi : Any Concerto Clarinet Benjamin : Concerto on Themes by Cimarosa Bozza : Clarinet Concerto Cavallini/Reed: Adagio & Tarantella Crusell : Concerto No.2, Op.5 Debussy : Première rhapsodie Dello Joio : Concertante Finzi : Clarinet Concerto op. 31 Krommer : Clarinet Concerto, Op.36 Mozart : Clarinet Concerto in A major, K. 622 Pleyel : Concerto in C major, B.106 Rossini : Variations for Clarinet & Small Orchestra Spohr : Any Concerto Stamitz : Any Concerto Weber : Any Concerto Double Bass Bottesini : Double Bass Concerto No.2 in B minor Cimador : Double Bass Concerto Dittersdorf : Double Bass Concerto No.2 in E-flat major, Kr.172 Dragonetti : Double Bass Concerto in A major Hoffmeister: Concerto Koussevitzky : Double Bass Concerto, Op.3 Pichl : Double Bass Concerto Vanhal : Concerto for Double Bass & Orchestra Vivaldi: Concerto in a minor (transcribed from violin) Flute Bach : Orchestral Suite No. -

Rep List 1.Pub
Richmond Symphony Orchestra League Student Concerto Competition Repertoire Please choose your repertoire from the approved selections below. Guitar & percussion students are welcome to participate; please contact Carol Sesnowitz, contest coordinator, at [email protected] for repertoire approval no later than November 1. VIOLIN Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor, Op. 119 Bach All Violin concerti Schumann Cello Concerto in A minor Beethoven Violin Concerto in D major Stamitz All Cello concerti Beethoven Romance No. 1 in G major R. Strauss Romanze in F major Beethoven Romance No. 2 in F major Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme, Op.33 Bériot Scéne de Ballet, Op. 100 Vivaldi All Cello concerti Bériot Violin Concerto No. 9 in A minor Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor BASS Haydn All Violin concerti Bottesini Double Bass Concerto No.2 in B minor Kabalevsky Violin Concerto in C Major, Op. 48 Capuzzi Double Bass Concerto in D major Lalo Symphonie Espagnole Dittersdorf Double Bass Concerto in E major Massenet Méditation from Thaïs Dragonetti All Double Bass concerti Mendelssohn Violin Concerto in E minor, Op.64 Koussevitsky Double Bass Concerto in F-sharp minor Mozart Violin Concerto No. 1 in B-flat major Vanhal Concerto for Double Bass Mozart Violin Concerto No. 2 in D major Mozart Violin Concerto No. 3 in G major HARP Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Alwyn Lyra angelica Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Boieldieu Harp Concerto Paganini Violin Concert No. 1 in D major, Op. 6 Debussy Danses sacree et profane Prokofiev Violin Concerto No. -
Index of Mozart's Works by Köchel Number
Cambridge University Press 978-1-107-18105-2 — Mozart in Context Edited by Simon Keefe Index More Information Index of Mozart’s Works by Köchel Number K. 1 Minuet in G 267 K. 261 Adagio in E for violin and orchestra 187 K. 8 Sonata for piano and violin in B-flat 217 K. 264 Variations for piano on ‘Lison dormait’ K. 10–15 Sonatas for piano and violin 135, 188, 217 (Nicolas Dezède) 116 K. 16 Symphony in E-flat 135 K. 269 Rondo in B-flat for violin and K. 19 Symphony in D 135 orchestra 187 K. 20 Chorus ‘God is Our Refuge’ 135 K. 283 Piano Sonata in G 257, 261 K. 21 Aria ‘Va, dal furor portata’ 105, 135, 205 K. 286 Notturno in D 185 K. 23 Aria ‘Conservati’ 205 K. 295 Aria ‘Se al labbro’ 212 K. 35 Die Schuldigkeit des ersten Gebots 47 K. 296,K.376,K.377,K.378,K.379,K.380 K. 38 Apollo et Hyacinthus 85 Sonatas for piano and violin (op. 2) 290 K. 41 Grabmusik 19 K. 297 Symphony in D (‘Paris’) 25, 27, 45, K. 51 La finta semplice 91, 142, 147, 205 116, 140 K. 66 Mass in C 84 K. 297b Sinfonia Concertante in E-flat 45, 189 K. 72a Molto allegro for keyboard 62 K. 299 Concerto for flute and harp in C 16, K. 74b Aria ‘Non curo’ 205 117, 189 K. 77 Aria ‘Misero pargoletto’ 205 K. 301–306 Sonatas for piano and violin 99, 140 K. 82 Aria ‘Se ardir’ 205 K.