Wolfgang Meibeyer Braunschweig, 18
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

181222 ICOMOS Heft LXVII Layout 1 11.01.19 09:15 Seite 94
181222 ICOMOS Heft LXVII_Layout 1 11.01.19 09:15 Seite 94 Circular Villages: Reflections Based on a Global Comparative Analysis Britta Rudolff, Eva Battis and Michael Schmidt 1 Introduction into the surrounding agricultural landscape with fan-shaped farmsteads. The villages’ ground plan and harmonious ap- This paper summarises the findings of a comparative analysis pearance is significantly characterised by a small number of undertaken with a view towards a World Heritage nomination detached-standing vernacular hall houses, predominantly of of the so-called Rundling villages in the Wendland, Germany. the 18th and 19th centuries, whose decorated timber-frame Compared with other similar rural settlement typologies these gables are directed towards the open central village space. are characterised by equally approaching a round ground plan. The site selected for nomination is composed exclusively of The identified Outstanding Universal Value of the Wendland Rundling villages embedded in cultured farmland.1 Rundlinge (see previous paper by Schmidt et al.) selected Given that the settlement landscape and village typology for World Heritage nomination derives from their settlement were found to be the most outstanding features of the Wend- landscape and village typology. The typology developed over land Rundlinge, a typological analysis is the centre piece of the centuries and today features a unique village footprint the comparative study and is synthesised in this paper. This approaching a regular circular shape which extends radially study focuses on villages of more or less comparable settle- Fig. 2.1 The Rundling village Satemin (©IHM, photographer: Eva Battis) 94 ICOMOS · Hefte des Deutschen Nationalkomitees LXVII 181222 ICOMOS Heft LXVII_Layout 1 11.01.19 09:15 Seite 95 Circular Villages: Reflections Based on a Global Comparative Analysis Fig. -

Traditionelle Ortsgrundrissformen Und Neuere Dorfentwicklung
Traditionelle Ortsgrundrissformen und neuere Dorfentwicklung Johann-Bernhard Haversath und Armin Ratusny Die ländlich-agrarisch geprägten nicht- ³ Strathöfken südlich von Kempen 1892 · Krämgen 1899 städtischen Räume in Deutschland, die Ländliche Ortsformen Einzelhöfe Weiler hinsichtlich ihrer Flächenerstreckung Ausschnitte aus historischen bis heute noch weitaus dominieren, las- Messtischblättern 1883-1924 sen sich in der Erscheinung ihrer Sied- lungen vor allem nach zwei Gesichts- vergrößert punkten charakterisieren: nach der von 1: 25000 auf 1:15000 Grundrisserstreckung der Ortsformen und nach dem Grund- und Aufrisstyp Lage der Siedlungen der anzutreffenden Bauernhäuser (ĪĪ Beitrag Haversath/Ratusny, S. 48). Woltow Ländliche Ortsformen Die regionale Differenzierung der tradi- Schönfeld Lübeln tionellen Ortsgrundrissformen ist das Ergebnis der historischen Phasen einer Strathöfken ca. 1500 Jahre währenden Kulturland- bei Kempen Breunsdorf » Neckarwestheim 1898 schaftsentwicklung. Die Grundrissmus- Haufendorf ter zerfallen um 1950, d.h. noch vor der Krämgen Reinholdshain Verstädterung vieler Dörfer, in planmä- ßig-regelhafte Ortsgründungen sowie in Ortsformen, die auf eine regellos-ge- Neckarwestheim wachsene Entwicklung zurückgehen. Ihre jeweilige Genese steht im Zusam- menhang der Siedlungsträger und ihrer Motive sowie im Rahmen der jeweili- gen agrarökologischen Situation. Im vorliegenden Maßstab Die Jahresangaben in den Kartentiteln beziehen sich auf das Jahr der Landesaufnahme bzw. auf einen Berichtigungszeit- (1:3,75 Mio.) erscheint es zweckmäßig, punkt. nach ELLENBERG (1990) acht Ortsfor- mentypen zu unterscheiden: 1. Einzelhöfe, zu denen meist die sie umgebende unregelmäßige Blockflur ge- ᕤ Reinholdshain 1893 ´ Breunsdorf 1906/24 hört, finden sich im gesamten Gebiet Waldhufendorf Straßendorf der Bundesrepublik, sind aber land- schaftsbestimmend vor allem zwischen Niederrhein ᕡ und mittlerer und unte- rer Weser (wo sie teilweise von Klein- weilern, sog. -

Siedlungslandschaft Rundlinge Im Wendland Als UNESCO
INFORMATION Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland als UNESCO-Weltkulturerbe? Samtgemeinde Lüchow Rundlingsverein e.V. Vorsitz Fachausschuss Welterbe und regionale Entwicklung 2 Seit 2012 versucht die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ein Gebiet von gut erhaltenen Rundlingen im Niederen Drawehn als UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Die Kooperationspartner Landkreis Lüchow-Dannenberg, Stadt Lüchow, Stadt Wustrow, der Flecken Clenze, die Gemeinden Küsten, Luckau und Waddeweitz sowie der Rundlingsverein e.V. unterstützen die Samtgemeinde in diesem Bemühen. Seit Jahren wurden mit vielen Veranstaltungen und Veröffentlichungen manche Zwischenziele erreicht. In diesem Corona-Jahr konnten viele Aktivitäten nicht wie geplant durchgeführt werden, und vermutlich wird dies auch im Frühjahr 2021 wegen der Corona-Lage nicht möglich sein. Daher wendet sich dieser Informationsbrief an alle Bewohner und Hauseigentümer der 19 Rundlinge, um noch einmal schriftlich darzulegen, was UNESCO-Welterbe bedeutet, warum wir diese Anerkennung anstreben und wie der weitere Weg aussieht. Was bedeutet Welt(kultur)erbe? Leitidee der Welterbe Konvention ist die Erwägung, dass Teile des Kultur- oder Naturerbes von außergewöhnlicher Bedeutung sind (Outstanding Universal Value = OUV) und daher als Bestandteil des Welterbes der ganzen Menschheit erhalten werden müssen. Damit dieser OUV anerkannt werden kann, muss mindestens eines der zehn Welterbe Kriterien erfüllt sein. Zudem muss ein effektives Managementsystem die Bedingungen der Authentizität (glaubwürdige Darstellung des Wertes) und der Integrität (Unversehrtheit und Vollständigkeit der physischen, Welterbe relevanten Elemente der Stätte) sicherstellen. Welche Bedeutung hat das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt? Die Anerkennung als UNESCO Welterbe ist mit der Verpflichtung für den Vertragsstaat verbunden, langfristigen Schutz und Erhaltung der Welterbestätte sicherzustellen, damit das Welterbe an zukünftige Generationen weitergegeben werden kann. -

Diese Tour Durch Die Rundlingsdörfer Gibt Einen Eindruck Über Ihre
Die Rundlingstour mit GPS-Gerät oder Smart-Phone Erstellt vom Rundlingsverein Grundlage ist eine gpx-Datei, die Sie über www.rundlingsverein.de runterladen können. Wenn der Download nicht funktioniert oder die Datei sich nicht öffnen lässt, braucht ihr Gerät zunächst eine App, die diese Datei lesen kann. Je nach Betriebssystem gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Für Android z.B. OruxMaps, koomo-Routenplaner, iMapMyRide. Auf der Website des Rundlingsvereins geben wir weitere Empfehlungen. Die Route auf verkehrsarmen Wegen und Straßen ist für Radlerinnen und Radler konzipiert und dabei wurde besonders an junge Familien mit Kindern gedacht. Große Teilstrecken sind auch für Reiter und Reiterinnen geeignet. Mit dieser aktuellen Technik, bei der die Software laufend neue Möglichkeiten bietet, will der Rundlingsverein zeigen, dass die Landschaft und die Dörfer im Wendland kein Museum sind, sondern bewohnt und belebt von Menschen unserer Zeit. Wir freuen uns über Erfahrungsberichte und Tipps zu neuen technischen Tricks per Email an [email protected] Mit dem Fahrrad durch die Rundlingslandschaft (Auch für Reiter geeignet) Start am Parkplatz von Lübeln Die Tour durch die Rundlingsdörfer gibt einen Eindruck über ihre Besonderheiten auch abseits der üblichen touristischen Dörfer. Die Tour lädt ein, die Landschaft und die Tier- und Pflanzenwelt unterwegs zwischen den Dörfern zu beobachten und fern vom Alltagsstress zu genießen. Sie verläuft auf wenig befahrenen kleinen Straßen und Wegen. Einige Teilstrecken sind holprig oder völlig unbefestigt. Rennräder sind deshalb weniger geeignet. Da es in den kleinen Dörfern und auf der Strecke kaum Einkaufsmöglichkeiten und nur wenige Gastronomiebetriebe gibt, können Sie sich vor oder nach der Tour hier in Lübeln mit regionalen Gerichten im Kartoffelhotel und im Avoeßel stärken. -

Pioneers of Modern Geography: Translations Pertaining to German Geographers of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Robert C
Wilfrid Laurier University Scholars Commons @ Laurier GreyPlace 1990 Pioneers of Modern Geography: Translations Pertaining to German Geographers of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Robert C. West Follow this and additional works at: https://scholars.wlu.ca/grey Part of the Earth Sciences Commons, and the Human Geography Commons Recommended Citation West, Robert C. (1990). Pioneers of Modern Geography: Translations Pertaining to German Geographers of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Baton Rouge: Department of Geography & Anthropology, Louisiana State University. Geoscience and Man, Volume 28. This Book is brought to you for free and open access by Scholars Commons @ Laurier. It has been accepted for inclusion in GreyPlace by an authorized administrator of Scholars Commons @ Laurier. For more information, please contact [email protected]. Pioneers of Modern Geography Translations Pertaining to German Geographers of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Translated and Edited by Robert C. West GEOSCIENCE AND MAN-VOLUME 28-1990 LOUISIANA STATE UNIVERSITY s 62 P5213 iiiiiiiii 10438105 DATE DUE GEOSCIENCE AND MAN Volume 28 PIONEERS OF MODERN GEOGRAPHY Digitized by the Internet Archive in 2017 https://archive.org/details/pioneersofmodern28west GEOSCIENCE & MAN SYMPOSIA, MONOGRAPHS, AND COLLECTIONS OF PAPERS IN GEOGRAPHY, ANTHROPOLOGY AND GEOLOGY PUBLISHED BY GEOSCIENCE PUBLICATIONS DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND ANTHROPOLOGY LOUISIANA STATE UNIVERSITY VOLUME 28 PIONEERS OF MODERN GEOGRAPHY TRANSLATIONS PERTAINING TO GERMAN GEOGRAPHERS OF THE LATE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURIES Translated and Edited by Robert C. West BATON ROUGE 1990 Property of the LfhraTy Wilfrid Laurier University The Geoscience and Man series is published and distributed by Geoscience Publications, Department of Geography & Anthropology, Louisiana State University. -

181222 ICOMOS Heft LXVII Layout 1 11.01.19 09:12 Seite 1
181222_ICOMOS_Heft_LXVII_Cover_print_Layout 1 11.01.19 11:02 Seite 1 The Cultural Landscape of the Wendland Circular Villages Wendland Circular Villages Circular Wendland ICOMOS · HEFTE DES DEUTSCHEN NATIONALKOMITEES LXVII ICOMOS · JOURNALS OF THE GERMAN NATIONAL COMMITTEE LXVII ICOMOS · CAHIERS DU COMITÉ NATIONAL ALLEMAND LXVII ICOMOS · HEFTE DES DEUTSCHEN NATIONALKOMITEES LXVII ICOMOS · HEFTE DES DEUTSCHEN NATIONALKOMITEES 181222 ICOMOS Heft LXVII_Layout 1 11.01.19 09:12 Seite 1 INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ПАМЯТНИКОВ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ Conservation and Rehabilitation of Vernacular Heritage: The Cultural Landscape of the Wendland Circular Villages International conference and annual meeting of the ICOMOS International Scientific Committee on Vernacular Architecture (CIAV) organised with ICOMOS Germany, the State Office for Monument Con- servation and Archaeology of Lower Saxony, and the Samtgemeinde of Lüchow-Wendland Lübeln, September 28 – October 2, 2016 Edited by Christoph Machat ICOMOS · HEFTE DES DEUTSCHEN NATIONALKOMITEES LXVII ICOMOS · JOURNALS OF THE GERMAN NATIONAL COMMITTEE LXVII ICOMOS · CAHIERS DU COMITÉ NATIONAL ALLEMAND LXVII 181222 ICOMOS Heft LXVII_print_Layout 1 15.02.19 12:21 Seite 2 Impressum ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees Herausgegeben vom Nationalkomitee der Bundesrepublik Deutschland Präsident: Prof. Dr. Jörg Haspel Vizepräsident: Dr. Christoph Machat -

From Grassroots Initiatives to Urban Food System Governance? Case Studies in Montpellier and Toulouse, Southern France Christophe-Toussaint Soulard, Isabelle Duvernoy
From grassroots initiatives to urban food system governance? Case studies in Montpellier and Toulouse, southern France Christophe-Toussaint Soulard, Isabelle Duvernoy To cite this version: Christophe-Toussaint Soulard, Isabelle Duvernoy. From grassroots initiatives to urban food system governance? Case studies in Montpellier and Toulouse, southern France. RuralGeo2017 ”New ru- ral geographies in Europe: actors, processes, policies”, Jun 2017, Braunschweig, Germany. 154 p., 2017, ”New rural geographies in Europe: actors, processes, policies”, European Rural Geographies Conference, June 14-17, 2017, Braunschweig, Germany, Book of Abstracts. hal-01602782 HAL Id: hal-01602782 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01602782 Submitted on 2 Jun 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. “New rural geographies in Europe: actors, processes, policies“ European Rural Geographies Conference June 14 – 17, 2017 Braunschweig, Germany ruralgeo2017.de Book of Abstracts supported by: ER RAU H M C I L D N AK Ä L RuralGeo 2017 RuralGeo Imprint Johann Heinrich -
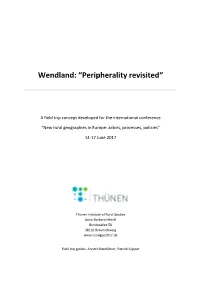
Wendland: “Peripherality Revisited“
Wendland: “Peripherality revisited“ _________________________________________________________________ A field trip concept developed for the international conference “New rural geographies in Europe: actors, processes, policies” 14-17 June 2017 Thünen Institute of Rural Studies Anna-Barbara Heindl Bundesallee 50 38116 Braunschweig www.ruralgeo2017.de Field trip guides: Annett Steinführer, Patrick Küpper Peripherality revisited 2 Peripherality revisited 1. Field trip stops Map 1: Field trip route. Source: Thünen Institute 2017 based on GeoBasis-DE/BKG 2017. 10:00-11:00 Village Diahren: Newcomers in a “periphery”? Field trip partner: Giselher Kühn, village spokesperson/ organic farmer 11:30-12:30 Lübeln: Rundling villages as a phenomenon of the periphery? Field trip partners: Adrian Greenwood, Ilka Burkhardt-Liebig Members of board of “Verein zur Förderung des Wendlandhofes Lübeln und der Rundlinge e.V.“ (Rundling Association) 12:45-13:45 Lunch: Gasthaus Wendel, Lüchow 14:30-15:30 Gorleben: Protest movement and creative industries as an alternative for the Wendland’s development? Field trip partners: Michael Seelig, Grüne Werkstatt Wendland (Green Design Workshop Wendland) Francis Althoff, Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. (Citizens’ Initiative for Environmental Protection Lüchow-Dannenberg) 3 Peripherality revisited 2. Introduction: Wendland as a periphery The Wendland, synonymous for the administrative district of Lüchow-Dannenberg, has always been marked as a remote and structurally weak area. Compared with Germany as a whole, but also with the state (Bundesland) Niedersachsen (Lower Saxony), to which the Wendland belongs, the district has a very low population density. A negative natural balance and an above-average ageing are today’s major demographic challenges (Table 1 and Figure 1). While young people leave the region, in higher age groups the Wendland’s population dia- gram exhibits downs and – rather untypical for a rural periphery – also peaks. -

Űber-Peasants and National Socialist Settlements in the Occupied
DEM SCHWERTE MUSS DER PFLUG FOLGEN: ŰBER-PEASANTS AND NATIONAL SOCIALIST SETTLEMENTS IN THE OCCUPIED EASTERN TERRITORIES DURI NG WORLD WAR TWO Simone C. De Santiago Ramos, M.S. Thesis Prepared for the Degree of MASTER OF ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS May 2007 APPROVED: Alfred C. Mierzejewski, Major Professor Marilyn Morris, Committee Member Denis Paz, Committee Member Adrian Lewis, Chair of the Department of History Sandra L. Terrell, Dean of the Robert B. Toulouse School of Graduate Studies De Santiago Ramos, Simone C. Dem Schwerte Muss Der Pflug Folgen: Űber- Peasants and National Socialist Settlements in the Occupied Eastern Territories during World War Two. Master of Arts (History), May 2007, 100 pp., 1 table, 4 figures, references, 273 titles. German industrialization in the nineteenth century had brought forward a variety of conflicting ideas when it came to the agrarian community. One of them was the agrarian romantic movement led by Adam Műller, who feared the loss of the traditional German peasant. Műller influenced Reichdeutsche Richard Walther Darré, who argued that large cities were the downfall of the German people and that only a healthy peasant stock would be able to ‘save’ Germany. Under Darré’s definition, “Geopolitik” was the defense of the land, the defense with Pflug und Schwert (plow and sword) by Wehrbauern, an ‘Űberbauer-fusion’ of soldier and peasant. In order to accomplish these goals, new settlements had to be established while moving from west to east. The specific focus of this study is on the original Hegewald resettlement ideas of Richard Walther Darré and how his philosophy was taken over by Himmler and fit into his personal needs and creed after 1941. -

People and Nature Belong Together
NATURE PARKS IN GERMANY People and Nature belong together Notre Dame 1 Königsberger Straße 10 Lindenstraße 33 Franz-Hartmann-Straße 9 85072 Eichstätt 29439 Lüchow (Wendland) 15377 Buckow 67466 Lambrecht (Pfalz) Tel. 08421 9876-0 Tel. 05841 120-540 Tel. 033433 158-41 Tel. 06325 9552-0 www.naturpark-altmuehltal.de www.naturpark-elbhoehen- www.np-ms.brandenburg.de www.pfaelzerwald.de wendland.de Kastanienallee 13 Schlossplatz 8 Wargentiner Straße 4 Wirchensee OT Treppeln 17373 Ueckermünde 09487 Schlettau 17139 Basedow 15898 Neuzelle Tel. 039771 441-08 Tel. 03733 622106 Tel. 039957 29120 Tel. 033673 422 www.naturpark-am-stettiner-haff.de www.naturpark-erzgebirge- www.naturpark-mecklenburgische- www.naturpark-schlaubetal. vogtland.de schweiz.de brandenburg.de Wandlitzer Chaussee 55 Strelitzer Straße 42 Wolfteroder Straße 4 a Kirchstraße 4 16321 Bernau b. Berlin 17258 Feldberger Seenlandschaft 37297 Berkatal 16775 Stechlin OT Menz Tel. 03338 75176-0 Tel. 039831 5278-0 Tel. 05651 952125 Tel. 033082 51210 www.naturpark-barnim. www.naturpark-feldberger- www.naturparkmeissner.de www.np-srl.brandenburg.de brandenburg.de seenlandschaft.de Info-Zentrum 3 Wörthstraße 15 Böttcherstraße 3 Am Markt 1 94227 Zwiesel 36037 Fulda 34346 Hann. Münden 19417 Warin Tel. 09922 802480 Tel. 0661 6006-385 Tel. 05541 75-259 Tel. 038482 22-059 www.naturpark-bayer-wald.de www.landkreis-fulda.de www.naturpark-muenden.de www.np-sternberger-seenland.de Arnold-Breithor-Straße 8 Brennereiweg 45 Markt 20 Am Schölerberg 1 15754 Heidesee OT Prieros 14823 Rabenstein OT Raben 04924 Bad Liebenwerda 49082 Osnabrück Tel. 033768 969-0 Tel. 033848 600-04 Tel. 035341 615-0 Tel. -
181222 ICOMOS Heft LXVII Layout 1 11.01.19 09:15 Seite 83
181222 ICOMOS Heft LXVII_Layout 1 11.01.19 09:15 Seite 83 In Search of OUV: A Methodology for Attribute Mapping in the Circular Villages of the Wendland Michael Schmidt, Kerstin Duncker, Britta Rudolff and Michelle Heese 1. The circular villages (Rundlinge) in the Wend- outstanding examples of a historic settlement landscape of land: a historic settlement landscape axially arranged planned settlements and of the specific ty- pology of a coherent and homogenous cohesive axial dispo- In the Hanoverian Wendland, located in the district of Lü- sition scheme with centralised alignment of the village. In chow-Dannenberg in Lower Saxony, a distinctive village ty- the authors’ view, these characteristics can be considered an pology of axially arranged circular villages (Rundlinge) has outstanding example of a traditional form of settlement. been preserved, which forms a settlement landscape of high Around a central open village square, all constitutive elements cultural importance and of potential Outstanding Universal are arranged pointing towards the centre, such as the gabled, Value. The authentic remains of a settlement landscape of half-timbered farmhouses, the farmsteads and the meadows rural character and a characteristic village typology, represent and forests describing the outer extension of the villages. a significant cultural property of the region, which is predes- The homogenous architecture of the vernacular architectural tined for a recognition on the UNESCO World Heritage List. ensemble illustrates a time of economic prosperity in the These circular villages of the Hanoverian Wendland form mid-19th century while also preserving significant earlier el- the largest concentration of continuously occupied, radially ements of the 17th and 18th centuries. -

144 Erdkunde Band 52/1998 with 10 Figures Zusammenfassung. Der
144 Erdkunde Band 52/1998 THE SLAVIC HAMLET ROUND A CULT GREEN AS THE PRECURSOR OF THE REGULAR RUNDLING OF THE MEDIEVAL FRANKISH-GERMAN COLONISATION') With 10 figures HANS-JÜRGEN NITZ Zusammenfassung. Der slawische Rundweiler mit Kultplatz als Vorläufer des planmäßigen Rundlings der mittelalterlichen fränkisch/deutschen Kolonisation Die hier angesprochenen beiden Versionen ländlicher Siedlungen mit Gruppierung der Höfe um einen inneren Platz wurden von der bisherigen Forschung nur unzureichend voneinander abgehoben und oft pauschal als „Rundlinge" zu- sammengefaßt. Eine detaillierte Untersuchung der Formen von Rügen bis Böhmen zeigt, daß sich die als ursprünglich slawische Rundweiler anzusprechenden Formen durch eine weniger regelmäßige Ortsgestaltung und Blockflur von den im Mittelpunkt der bisherigen Forschungen stehenden, erst im Mittelalter angelegten Rundlingen mit planmäßigen Streifenfluren auf der Grundlage der grundherrschaftlichen Hufenverfassung überaus deudich unterscheiden. Die Untersuchung der Verbreitung der Rundweiler mit Blockflur erweist deren Reliktcharakter und begründet die Umstände ihrer Persistenz gegenüber der in den meisten slawischen Siedlungsräumen im Mittelalter durchgesetzten Trans- formation zum planmäßigen Rundling. Dabei wird die Frage nach den historischen Umständen dieses Wandels, wo und wann dieser einsetzte und sich als Innovation ausbreitete, erörtert. Eine bisher nicht beachtete zeitgenössische Quelle aus dem 17. Jahrhundert bezeugt den Ursprung des beiden Formen gemeinsamen zentralen Angers als Kultplatz. Summary. Two versions of a rural settlement type are discussed, which generally are taken together under the term "Rundling" because of the arrangement of the houses round a central green. But actually the two differ: the one form is more irregular and associated with block fields, the other regular with strip fields according to the feudal Hufen system.