Dossier Rechtspopulismus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 239. Sitzung des Deutschen Bundestages am Dienstag, 7. September 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 - AufbhG 2021) in der Ausschussfassung hier: Artikel 12 (Änderung des Infektionsschutzgesetzes) Artikel 13 (Einschränkung von Grundrechten) Drs. 19/32039 und 19/32275 Abgegebene Stimmen insgesamt: 625 Nicht abgegebene Stimmen: 84 Ja-Stimmen: 344 Nein-Stimmen: 280 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 07.09.2021 Beginn: 14:35 Ende: 15:05 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. -
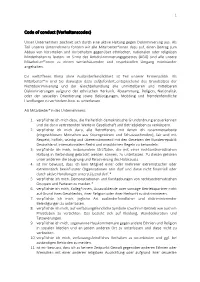
Code of Conduct (Verhaltenscodex)
1 Code of conduct (Verhaltenscodex) Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine aktive Haltung gegen Diskriminierung aus. Als Teil unseres Unternehmens fordern wir alle Mitarbeiter*innen dazu auf, einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Vorbehalten gegenüber ethnischen, nationalen oder religiösen Minderheiten zu leisten. Im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes (AGG) sind alle unsere Mitarbeiter*innen zu einem wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander angehalten. Ein weltoffenes Klima ohne Ausländerfeindlichkeit ist Teil unserer Firmenpolitik. Als Mitarbeiter*in sind Sie deswegen dazu aufgefordert, entsprechend des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung alle unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft, Abstammung, Religion, Nationalität oder der sexuellen Orientierung sowie Belästigungen, Mobbing und fremdenfeindliche Handlungen zu verhindern bzw. zu unterlassen. Als Mitarbeiter*in des Unternehmens 1. verpflichte ich mich dazu, die freiheitlich demokratische Grundordnung anzuerkennen und die darin vertretenden Werte in Gesellschaft und Betriebsleben zu verkörpern. 2. verpflichte ich mich dazu, alle Betroffenen, mit denen ich zusammenarbeite (eingeschlossen Menschen aus Krisengebieten und Schutzsuchenden), fair und mit Respekt, höflich, würdig und übereinstimmend mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, internationalem Recht und ortsüblichen Regeln zu behandeln. 3. verpflichte ich mich, insbesondere Straftaten, die mit einer rechtsextremistischen Haltung -

The Kremlin Trojan Horses | the Atlantic Council
Atlantic Council DINU PATRICIU EURASIA CENTER THE KREMLIN’S TROJAN HORSES Alina Polyakova, Marlene Laruelle, Stefan Meister, and Neil Barnett Foreword by Radosław Sikorski THE KREMLIN’S TROJAN HORSES Russian Influence in France, Germany, and the United Kingdom Alina Polyakova, Marlene Laruelle, Stefan Meister, and Neil Barnett Foreword by Radosław Sikorski ISBN: 978-1-61977-518-3. This report is written and published in accordance with the Atlantic Council Policy on Intellectual Independence. The authors are solely responsible for its analysis and recommendations. The Atlantic Council and its donors do not determine, nor do they necessarily endorse or advocate for, any of this report’s conclusions. November 2016 TABLE OF CONTENTS 1 Foreword Introduction: The Kremlin’s Toolkit of Influence 3 in Europe 7 France: Mainstreaming Russian Influence 13 Germany: Interdependence as Vulnerability 20 United Kingdom: Vulnerable but Resistant Policy recommendations: Resisting Russia’s 27 Efforts to Influence, Infiltrate, and Inculcate 29 About the Authors THE KREMLIN’S TROJAN HORSES FOREWORD In 2014, Russia seized Crimea through military force. With this act, the Kremlin redrew the political map of Europe and upended the rules of the acknowledged international order. Despite the threat Russia’s revanchist policies pose to European stability and established international law, some European politicians, experts, and civic groups have expressed support for—or sympathy with—the Kremlin’s actions. These allies represent a diverse network of political influence reaching deep into Europe’s core. The Kremlin uses these Trojan horses to destabilize European politics so efficiently, that even Russia’s limited might could become a decisive factor in matters of European and international security. -

European Parliament Elections 2019 - Forecast
Briefing May 2019 European Parliament Elections 2019 - Forecast Austria – 18 MEPs Staff lead: Nick Dornheim PARTIES (EP group) Freedom Party of Austria The Greens – The Green Austrian People’s Party (ÖVP) (EPP) Social Democratic Party of Austria NEOS – The New (FPÖ) (Salvini’s Alliance) – Alternative (Greens/EFA) – 6 seats (SPÖ) (S&D) - 5 seats Austria (ALDE) 1 seat 5 seats 1 seat 1. Othmar Karas* Andreas Schieder Harald Vilimsky* Werner Kogler Claudia Gamon 2. Karoline Edtstadler Evelyn Regner* Georg Mayer* Sarah Wiener Karin Feldinger 3. Angelika Winzig Günther Sidl Petra Steger Monika Vana* Stefan Windberger 4. Simone Schmiedtbauer Bettina Vollath Roman Haider Thomas Waitz* Stefan Zotti 5. Lukas Mandl* Hannes Heide Vesna Schuster Olga Voglauer Nini Tsiklauri 6. Wolfram Pirchner Julia Elisabeth Herr Elisabeth Dieringer-Granza Thomas Schobesberger Johannes Margreiter 7. Christian Sagartz Christian Alexander Dax Josef Graf Teresa Reiter 8. Barbara Thaler Stefanie Mösl Maximilian Kurz Isak Schneider 9. Christian Zoll Luca Peter Marco Kaiser Andrea Kerbleder Peter Berry 10. Claudia Wolf-Schöffmann Theresa Muigg Karin Berger Julia Reichenhauser NB 1: Only the parties reaching the 4% electoral threshold are mentioned in the table. Likely to be elected Unlikely to be elected or *: Incumbent Member of the NB 2: 18 seats are allocated to Austria, same as in the previous election. and/or take seat to take seat, if elected European Parliament ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• www.eurocommerce.eu Belgium – 21 MEPs Staff lead: Stefania Moise PARTIES (EP group) DUTCH SPEAKING CONSITUENCY FRENCH SPEAKING CONSITUENCY GERMAN SPEAKING CONSTITUENCY 1. Geert Bourgeois 1. Paul Magnette 1. Pascal Arimont* 2. Assita Kanko 2. Maria Arena* 2. -
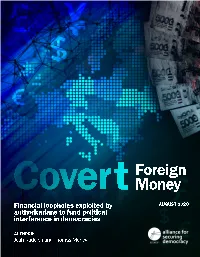
ASD-Covert-Foreign-Money.Pdf
overt C Foreign Covert Money Financial loopholes exploited by AUGUST 2020 authoritarians to fund political interference in democracies AUTHORS: Josh Rudolph and Thomas Morley © 2020 The Alliance for Securing Democracy Please direct inquiries to The Alliance for Securing Democracy at The German Marshall Fund of the United States 1700 18th Street, NW Washington, DC 20009 T 1 202 683 2650 E [email protected] This publication can be downloaded for free at https://securingdemocracy.gmfus.org/covert-foreign-money/. The views expressed in GMF publications and commentary are the views of the authors alone. Cover and map design: Kenny Nguyen Formatting design: Rachael Worthington Alliance for Securing Democracy The Alliance for Securing Democracy (ASD), a bipartisan initiative housed at the German Marshall Fund of the United States, develops comprehensive strategies to deter, defend against, and raise the costs on authoritarian efforts to undermine and interfere in democratic institutions. ASD brings together experts on disinformation, malign finance, emerging technologies, elections integrity, economic coercion, and cybersecurity, as well as regional experts, to collaborate across traditional stovepipes and develop cross-cutting frame- works. Authors Josh Rudolph Fellow for Malign Finance Thomas Morley Research Assistant Contents Executive Summary �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 Introduction and Methodology �������������������������������������������������������������������������������������������������� -

Identit〠E Democrazia
Identità e Democrazia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Identità e Democrazia (in inglese: Identity and Identità e Democrazia Democracy, ID) è un gruppo politico del Parlamento Europeo di destra, fondato nel 2019 dopo le elezioni (EN) Identity and Democracy europee del 2019. Il gruppo è il successore del gruppo Presidente Marco Zanni fondato nel 2015 Europa delle Nazioni e della Libertà. (Lega) Vicepresidente Nicolas Bay (RN) Jörg Meuthen Indice (AfD) Storia Stato Unione Obiettivi politici europea Composizione Abbreviazione ID Note Fondazione 13 giugno 2019 Voci correlate Ideologia Nazionalismo Conservatorismo Storia nazionale Populismo di Il 12 giugno 2019 è stato annunciato che il gruppo destra successore a Europa delle Nazioni e delle Libertà si Identitarismo sarebbe chiamato "Identità e Democrazia" e avrebbe Sovranismo incluso partiti come la Lega Nord (Italia), Anti-immigrazione Raggruppamento Nazionale (Francia) e Alternativa per la Collocazione Destra [1] Germania (Germania)[2]. Il leghista Marco Zanni è stato Partito europeo AEPN nominato Presidente[3]. Il 13 giugno 2019 il gruppo, composto da 73 europarlamentari, è stato lanciato a Seggi 73 / 751 Bruxelles da Marine Le Pen[4]. Europarlamento Obiettivi politici I principali obiettivi politici del gruppo sono bloccare una maggiore integrazione europea ed ottenere maggiore autonomia nelle politiche di spesa, ovvero la possibilità di fare maggiore deficit e debito senza incorrere in penalità da parte della Commissione Europea.[5] Composizione Identità e Democrazia è formato da -
The Committee on Economic Cooperation and Development
The Committee on Economic Cooperation and Development 2 “The central challenge in develop- ment cooperation is and remains for the state, businesses and society to work together to provide impe- tus to people in partner countries to help themselves. We can achieve this if we cooperate globally to bring about a shift away from short-term crisis management and towards a strategy of sustainable development. Local populations need to muster the creative power to make the most of their potential. The members of the Committee put their confidence in committed people who work to create a decent future in their home countries.” Dr Peter Ramsauer, CDU/CSU Chairman of the Committee on Economic Cooperation and Development 3 The German Bundestag’s decisions are prepared by its committees, which are estab- lished at the start of each elec- toral term. Four of them are stipulated by the Basic Law, the German constitution: the Committee on Foreign Affairs, the Defence Committee, the Committee on the Affairs of the European Union and the Petitions Committee. The Budget Committee and the Committee for the Rules of Procedure are also required by law. The spheres of respon- sibility of the committees essentially reflect the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios. This enables Parliament to scruti- nise the government’s work effectively. The Bundestag committees The German Bundestag sets political priorities of its own by establishing additional committees for specific sub- jects, such as sport, cultural affairs or tourism. In addition, special bodies such as parlia- mentary advisory councils, The committees discuss and committees of inquiry or deliberate on items referred study commissions can also to them by the plenary. -

Plenarprotokoll 19/139
Plenarprotokoll 19/139 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 139. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 15. Januar 2020 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17335 B nung . 17327 B Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn Absetzung der Tagesordnungspunkte 6 b und (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 17335 D 14 c . 17329 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17335 D Nachträgliche Ausschussüberweisung . 17329 D Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) . 17336 A Feststellung der Tagesordnung . 17329 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17336 B Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) . 17336 C Tagesordnungspunkt 1: Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17336 D Befragung der Bundesregierung Kai Whittaker (CDU/CSU) . 17337 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17330 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17337 A René Springer (AfD) . 17331 A Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17337 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17331 B Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17337 D René Springer (AfD) . 17331 C Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17338 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17331 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 A Antje Lezius (CDU/CSU) . 17332 A Michael Gerdes (SPD) . 17338 B Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17332 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 B Antje Lezius (CDU/CSU) . 17332 B Michael Gerdes (SPD) . 17338 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17332 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 D Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17332 D Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 17339 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17333 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17339 B Dr. Martin Rosemann (SPD) . 17333 B Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 17339 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17333 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17339 D Dr. Martin Rosemann (SPD) . -

Priority Question for Written Answer
Priority question for written answer P-002058/2020 to the Commission Rule 138 Julie Lechanteux (ID), Mathilde Androuët (ID), Jordan Bardella (ID), Aurelia Beigneux (ID), Dominique Bilde (ID), Annika Bruna (ID), Gilbert Collard (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Catherine Griset (ID), Jean-François Jalkh (ID), France Jamet (ID), Virginie Joron (ID), Herve Juvin (ID), Jean-Lin Lacapelle (ID), Hélène Laporte (ID), Gilles Lebreton (ID), Thierry Mariani (ID), André Rougé (ID), Nicolas Bay (ID), Maxette Pirbakas (ID) Subject: Legal basis for geo-tracking and the sharing of personal data during the coronavirus outbreak On 24 March 2020, the Commission revealed that it had held talks with telecommunications operators about joining forces to tackle the coronavirus outbreak. Thierry Breton, the Internal Market Commissioner, held a videoconference with the heads of Europe’s telecommunications companies and the GSMA (Global System for Mobile Communications) to explore options for sharing geolocation metadata in order to map and forecast the spread of the virus. The Commission claims that such a move would be fully in line with the General Data Protection Regulation and e-privacy legislation. How does the Commission intend to guarantee EU citizens full anonymisation of their personal data? How exactly does the Commission envisage using such data? Not content with surveillance and quarantine enforcement, Israel and a number of Asian countries have adopted a proactive AI-based approach that alerts individuals if they have been in contact with a virus carrier. How do the Commission’s plans compare, and what logistical support will it provide the Member States which opt for this approach? PE650.848v01-00. -

Rechtsextreme Ideologien Rhetorische Textanalysen Als Weg Zur Erschließung Rechtsradikalen Und Rechtsextremistischen Schriftmaterials
RolfBachem Rechtsextreme Ideologien Rhetorische Textanalysen als Weg zur Erschließung rechtsradikalen und rechtsextremistischen Schriftmaterials 44 Rech ts extreme Ideologien Rhetorische Textanalysen BKA Redaktion: Heinrich Schielke Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut ISSN 0174-5433 Nachdruck und Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe und mit Genehmigung des 13undeskriminalamts Gesamtherstellung: DruckVerlag Kettler GmbH, Bönen Rolf Bachern Rechtsextreme Ideologien Rhetorische Textanalysen als Weg zur Erschließung rechtsradikalen und rechtsextremistischen Schriftmaterials Bundeskrirninalarnt Wiesbaden 1999 BKA - Forschungsreihe herausgegeben vom Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut Band 44 Beirat: Prot. Dr. Hans-Jürgen Kerner Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen Wolfgang Sielatt Leiter des Landeskriminalamts Hamburg Prof. Dr. Dr. h. c. mulf. Klaus Tieäemann Direktor des Instituts für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht der Universität Freiburg i. Sr. Klaus Jürgen Timm Direktor des Hessischen Landeskriminalarnts Vorwort Rechtsextremisten verbreiten ihre Ideologie nicht mehr nur mit traditionellen Mitteln wie Plakaten, Flugblättern, Aufklebern, Broschüren und Büchern. Die modeme Informationstechnologie hat ihnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten eröffnet. Massenhaft werden zum Beispiel Tonträger mit rassistischen Inhalten (vorwiegend im Ausland) produziert und verbreitet, Mailboxen oder das Internet für Propaganda, Agitation, den Austausch von Nachrichten und zur Verabredung -

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/ Dr
Plenarprotokoll 19/103 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 103. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 5. Juni 2019 Inhalt: Ausschussüberweisungen 12527 A Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12531 B Alexander Graf Lambsdorff (FDP) 12531 D Tagesordnungspunkt 1: Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12532 A Befragung der Bundesregierung Alexander Graf Lambsdorff (FDP) 12532 A Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12527 C Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12532 B Markus Frohnmaier (AfD) 12528 C Matern von Marschall (CDU/CSU) 12532 D Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12528 D Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12533 A Markus Frohnmaier (AfD) 12529 A Eva-Maria Schreiber (DIE LINKE) 12533 B Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12529 A Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12533 B Dr Christoph Hoffmann (FDP) 12529 B Eva-Maria Schreiber (DIE LINKE) 12533 C Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12529 C Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12533 D Dr Christoph Hoffmann (FDP) 12529 C Ottmar von Holtz (BÜNDNIS 90/ Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12529 C DIE GRÜNEN) 12533 D Volker Kauder (CDU/CSU) 12529 D Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12534 A Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12529 D Ottmar von Holtz (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) 12534 B Helin Evrim Sommer (DIE LINKE) 12530 A Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12534 B Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12530 B Dietmar Friedhoff (AfD) 12534 C Helin Evrim Sommer (DIE LINKE) 12530 B Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12534 C Dr Gerd Müller, Bundesminister BMZ 12530 C Dietmar Friedhoff (AfD) 12534 D Agnieszka Brugger -

GENERAL ELECTIONS in FRANCE 10Th and 17Th June 2012
GENERAL ELECTIONS IN FRANCE 10th and 17th June 2012 European Elections monitor Will the French give a parliamentary majority to François Hollande during the general elections on Corinne Deloy Translated by Helen Levy 10th and 17th June? Five weeks after having elected the President of the Republic, 46 million French citizens are being Analysis called again on 10th and 17th June to renew the National Assembly, the lower chamber of Parlia- 1 month before ment. the poll The parliamentary election includes several new elements. Firstly, it is the first to take place after the electoral re-organisation of January 2010 that involves 285 constituencies. Moreover, French citizens living abroad will elect their MPs for the very first time: 11 constituencies have been espe- cially created for them. Since it was revised on 23rd July 2008, the French Constitution stipulates that there cannot be more than 577 MPs. Candidates must have registered between 14th and 18th May (between 7th and 11th May for the French living abroad). The latter will vote on 3rd June next in the first round, some territories abroad will be called to ballot on 9th and 16th June due to a time difference with the mainland. The official campaign will start on 21st May next. The French Political System sembly at present: - the Union for a Popular Movement (UMP), the party of The Parliament is bicameral, comprising the National former President of the Republic Nicolas Sarkozy, posi- Assembly, the Lower Chamber, with 577 MPs elected tioned on the right of the political scale has 313 seats; by direct universal suffrage for 5 years and the Senate, – the Socialist Party (PS) the party of the new Head the Upper Chamber, 348 members of whom are ap- of State, François Hollande, positioned on the left has pointed for 6 six years by indirect universal suffrage.