Klimaschutzkonzept Twistetal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Bereichs- Fahrplan
Ausgabe 2016 Alles was ich will! Bereichs- fahrplan Alle Informationen rund um AST, Bus und Bahn inklusive Fahrplanauszüge gültig von 13.12.2015 bis 10.12.2016 (Die Fahrpläne der alten Ausgabe sind ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2015 nicht mehr gültig.) Mit freundlicher Unterstützung von: Linienverzeichnis Bahnlinie R42 (Bestwig/Brilon Stadt) – Brilon Wald – Willingen – Korbach – Frankenberg – Marburg/L. ..................................... S. 4 Kostenlose Fahrt mit SauerlandCard zwischen Brilon und Willingen Bf. Kostenlose Fahrt mit MeineCardPlus im Bereich Willingen – Frankenberg. (Willingen – Ernsthausen = NVV-Tarif, ansonsten DB-Tarif) Buslinie 382 Willingen – Brilon Wald – Brilon ............................................ S. 14 Kostenlose Fahrt mit SauerlandCard auf gesamter Strecke. (Willingen – Brilon = Ruhr-Lippe-Tarif) Buslinie 486 Brilon – Gudenhagen – Willingen .......................................... S. 16 Kostenlose Fahrt mit SauerlandCard auf gesamter Strecke. Liebe Gäste, liebe Willinger, (Willingen – Brilon = Ruhr-Lippe-Tarif) die Zahl der Fahrtstrecken, Haltestellen und Verkehrsmittel ist Buslinie 506 sowohl im Verkehrsgebiet des Nordhessischen VerkehrsVerbundes Willingen – Schwalefeld – Rattlar – Diemelsee – (NVV) als auch im Bereich des Landkreises Waldeck-Frankenberg Bad Arolsen – Marsberg ....................................................... S. 18 und des angrenzenden Hochsauerlandkreises so umfangreich, Kostenlose Fahrt mit SauerlandCard und MeineCardPlus auf gesamter Strecke. dass ein dickes Buch zu -

Telefonverzeichnis Der Kreisverwaltung Des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Korbach (März 2021)
Telefonverzeichnis der Kreisverwaltung des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Korbach (März 2021) Kreishaus Bürogebäude Bürogebäude Bürogebäude Bürogebäude Südring 2 Am Kniep 50 Briloner Landstraße 60 Auf Lülingskreuz 60 Auf dem Hagendorf 1 Zentrale 05631 954-0 Zentrale 05631 954-0 Zentrale 05631 954-0 Zentrale 05631 954-800 Zentrale 05631 954-0 Merhof, Oliver (FD 1.1) 232 Freund, Helene 298 Knoche, Wilhelm 809 Herguth, Harald 252 Landrat und Vorzimmer Staude, Ronja 327 Iwaniak, Martina 244 Kuklovsky, Katharina 562 Heß, Maximilian 257 Emde, Hannelore 202 Ußpelkat, Ralf 180 Korschewsky, Monika 242 Müller, Tanja 120 Höhle, Rüdiger 251 Kubat, Dr. Reinhard 202 Kramer, Dirk 279 Müller, Ursula 889 Knippschild, Gina Tabea 559 1.2 Fachdienst Personal Michel, Andrea 334 Rieb, Susanne 561 Kreitsch, Martin 245 Erster Kreisbeigeordneter und Blumenstein, Julia 538 Vorzimmer Röse, Regina 537 Rinklin, Walter 811 Meyer, Marina 515 Fisseler, Bernd 302 Frese, Karl-Friedrich 335 Ruckert, Sarah 312 Römer, Dr. Jürgen 449 Przybilla, Nancy 558 Hellwig, Petra 307 Kuhn, Heike 336 Rummel, Madeline 299 Schneider, Theresia 853 Rampelt, Jan-Hendrik 250 Henkler, Cornelia 301 Sauerwald, Annette 283 Schultz, Ute 534 Tripp, Sigrid 249 Kreisbeigeordneter Hesse-Kaufhold, Annegret 303 Schürmann, Sophia 315 Weber, Irmhild 818 Weidenhagen, Thorsten 248 Schäfer, Friedrich 392 Jauernig, Tatjana 229 Schwarz, Timo 308 Wenzel, Antje 808 Witte, Holger 246 Kiepe, Karl-Heinz 304 Spratte, Monika 126 Kreisbeigeordnete Lichanow, Viktoria 398 Stark, Almut 383 2.3 Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, 2.6 Fachdienst Informationstechnik Kultur, Paten- und Partnerschaften und digitale Verwaltung Behle, Hannelore 323 Mann, Andreas (FD 1.2) 388 Stracke, Reiner 314 Frömel, Petra 337 Arnold, Christian 435 Merhof, Heidrun 309 Wagner, Uwe 241 Büroleitung Heimbuchner, Ann-Katrin 338 Baraniak, Wolfgang 330 Möller, Annika 305 Webelhuth, Anne 244 Mann, Andreas (BL) 388 Reitmaier, Tanja (FD 2.3) 517 Berkenkopf, Markus 405 Querl, Marie-Luise 365 Wilke, Harald 311 Wecker, Dr. -

The German Civil Code
TUE A ERICANI LAW REGISTER FOUNDED 1852. UNIERSITY OF PENNSYLVANIA DEPART=ENT OF LAW VOL. {4 0 - S'I DECEMBER, 1902. No. 12. THE GERMAN CIVIL CODE. (Das Biirgerliche Gesetzbuch.) SOURCES-PREPARATION-ADOPTION. The magnitude of an attempt to codify the German civil. laws can be adequately appreciated only by remembering that for more than fifteefn centuries central Europe was the world's arena for startling political changes radically involv- ing territorial boundaries and of necessity affecting private as well as public law. With no thought of presenting new data, but that the reader may properly marshall events for an accurate compre- hension of the irregular development of the law into the modem and concrete results, it is necessary to call attention to some of the political- and social factors which have been potent and conspicuous since the eighth century. Notwithstanding the boast of Charles the Great that he was both master of Europe and the chosen pr6pagandist of Christianity and despite his efforts in urging general accept- ance of the Roman law, which the Latinized Celts of the western and southern parts of his titular domain had orig- THE GERM AN CIVIL CODE. inally been forced to receive and later had willingly retained, upon none of those three points did the facts sustain his van- ity. He was constrained to recognize that beyond the Rhine there were great tribes, anciently nomadic, but for some cen- turies become agricultural when not engaged in their normal and chief occupation, war, who were by no means under his control. His missii or special commissioners to those people were not well received and his laws were not much respected. -

Naturschutz Aktuell 169-187 Naturschutz Aktuell Zusammengestellt Von W
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Hefte Edertal Jahr/Year: 1987 Band/Volume: 13 Autor(en)/Author(s): Lübcke Wolfgang Artikel/Article: Naturschutz aktuell 169-187 Naturschutz aktuell zusammengestellt von W. Lübcke Kurz_notiert Allendorf: Erfolgreich zur Wehr setzte sich die HGON gegen die von der Gemeinde Allendorf geplante Asphaltierung eines Feldwe ges durch die Ederauen von Rennertehausen. (FZ v. 7* u. 8.1.86) 1984 waren die Feuchtwiesen durch einen Vertrag zwischen BFN und dem Wasser- und Bodenverband Rennertehausen gesichert wor den. (Vergl. Vogelk. Hefte 11 (1985) Bad Wildungen: Die Nachfolge von Falko Emde (Bad Wildungen) als Leiter des Arbeitskreises Waldeck-Frankenberg der HGON trat Harmut Mai (Wega) an. Sein Stellvertreter wurde Bernd Hannover (Lelbach). Schriftführer bleibt Karl Sperner (Wega). (WA vom 11.1.86) Bad Wildungen: Gegen die Zerstörung von Biotopen als "private Fortsetzung der Flurbereinigung" protestierte die DBV-Gruppe Bad Wildungen. Gravierendstes Beispiel ist die Dränierung der Feucht wiesen im Dörnbachtal bei Odershausen. (WLZ v. 14.1.86) Frankenau-Altenlotheim: Ohne Baugenehmigung entstand ein Reit platz in einem Feuchtwiesengelände des Lorfetales. U. a. wurde die Maßnahme durch Kreismittel bezuschußt. Im Rahmen eines Land schaftsplanes sollen Ersatzbiotope geschaffen werden. (WLZ v. 19.3.86) Volkmarsen: Verärgert zeigte sich die Stadt Volkmarsen über die NSG-Verordnung für den Stadtbruch (WLZ v. 20.3- u. 24.7.86). Ein Antrag auf Novellierung der VO wurde von der Obersten Natur- schutzbehörde abgelehnt. Rhoden: Einen Lehrgang zum Thema "Lebensraum Wald" veranstalte te der DBV-Kreisverband vom 20. bis 22. Juni 1986 in der Wald arbeiterschule des FA Diemelstadt. -

Mitmachen Und … … Gasgrill Von Weber Stunden Oder 750 Kilowatt Strom Gewinnen Seite 15
direktMagazin der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH www.ewf.de Mitmachen und … … Gasgrill von Weber oder 750 Kilowatt stunden Strom gewinnen Seite 15 04 08 REGION. FREILICHT - BÜHNE TWISTE ERDGAS. ANSCHLUSS Ausgabe 2/2017 MIT ZUKUNFT 02 EWF – EDITORIAL Gas geben Die Energiewende hat Nachholbedarf. Etwa ein Drittel der deutschen Stromerzeu gung stammt zwar bereits aus erneuerbaren Energien. Dagegen kommt die Wende auf dem Wärmesektor aber immer noch nicht recht voran. Der Energieverbrauch vieler Gebäude ist weiter zu hoch, veraltete Heizungen erzeugen zu viele klimaschäd liche Abgase. Erdgas kann die „Wärmewende“ beschleunigen: Es hat eine hervor ragende KohlendioxidBilanz, zugleich steht eine sehr ausgereifte und wirkungsvolle Technik zur Verfügung. Über ein großes Leitungsnetz gelangt Erdgas günstig und sicher in den Haushalt, ver sorgt dort die Bewohner mit Wärme. Außerdem ermöglicht dieses Netz, Erdgas als Speicher für mit Wind oder Solarenergie erzeugten Strom zu nutzen. Die Rolle als Unterstützer der Energiewende kann der Energieträger umso besser spielen, je mehr Haushalte und Unternehmen beispielsweise von Heizöl auf Erdgas umstellen und moderne Brennwertgeräte installieren. Deshalb verstärken wir unsere Anstrengungen, noch mehr Anschlüs se an das Netz in unserer Region zu bekommen. Wir bieten dazu auch Informationsveranstal tungen an, wie kürzlich in OberWaroldern. Dort zeigten sich viele Bewohner sehr interessiert an einem ErdgasAnschluss. Das liegt auch an den Möglichkeiten, sich bei der Umstellung auf eine moderne Heizung finanziell unterstützen zu lassen. Für Unternehmen in unserer Region ist Erdgas ebenso eine Alternative: Die Firma Wekal Maschinenbau GmbH aus Fritzlar heizt ihre neue Unter nehmenszentrale damit. Durch den Einsatz von Erdgas und eine effizi ente Brennwertheizung mit Wärmetauscher leistet der Spezialist für Automationstechnik einen Beitrag zur Energiewende: Der Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid verringert sich deutlich. -
Experience Grimmheimat Nordhessen
EXPERIENCE GRIMMHEIMAT NORDHESSEN FREE LEISURE FUN WITH INCLUDING ALL LEISURE TIME ACTIVITIES 2020 FREE TRAVEL BY BUS AND TRAIN www.MeineCardPlus.de EXPERIENCE GRIMMHEIMAT NORDHESSEN CONTENT Welcome to Grimms ´home North Hesse About MeineCardPlus 4 North Hesse is the home of the Brothers Grimm. Jacob and Wilhelm Grimm spent most of their lives Map of leisure activities 6 here, in this picture postcard landscape, where they also collected and wrote down their world-famous fairy tales. The Brothers Grimm enjoyed their travels, The for keen swimmers 8 which took them all over the region; numerous diary entries and letters prove how much they loved living here. for underground Follow in their footsteps and discover the Grimms´ The 28 adventures home North Hesse. Your personalised visitor pass MeineCardPlus gives you unrestricted access to this unique region. Experience more than 140 leisure time activities free of charge during your holiday here. The for nature lovers 31 From water park fun to outstanding museums, a chilling ride on a summer toboggan run to a hike in the mountains or remarkable guided city tours. You for leisure time The 37 even travel for free on the region‘s public transport activities system. Refer to this brochure for more detailed information. We hope you have a fun-filled holiday in our fairy tale The for culture 53 region; enjoy your stay and please, tell everyone you know what a magical time you had! Regards, The for mobility 82 your holiday team from the Grimms´ home North Hesse FREE LEISURE FUN WITH MEINE Eintrittskarte ins Urlaubsvergnügen MEIN Fahrschein für Bus & Bahn MEINE Eintrittskarte ins Urlaubsvergnügen MEIN Fahrschein für Bus & Bahn ABOUT MeineCardPlus is your free pass to North Hesse‘s world of Most of the participating leisure, facilities are easily reached leisure time activities. -

[email protected] Email
Bad Arolsen In Bad Arolsen gibt es vier Ortsgerichte. Die Zuständigkeit richtet sich danach, in welchem Ortsteil Sie wohnen. Ortsgericht Ortsgerichtsvorsteher Vertreter Bad Arolsen I Dietrich Junkermann Norbert Schmidt Ortsteile: Arolsen, Helsen Große Alle 24, 34454 Bad Arolsen, Helsen privat: Prof.-Klapp-Straße 9 Tränketalstraße 11 34454 Bad Arolsen 34454 Bad Arolsen Telefon: 05691 – 8778051 Telefon: 05691 - 912345 Dienstl.:05691-805177 Email: [email protected] Bad Arolsen II Wilhelm Kälber Wilfried Kerkmann Ortsteile: Kohlgrund, Massenhausen, Mengeringhausen, Mengeringhausen Mengeringhausen Schmillinghausen Eichenweg 4 Walmer Weg 6 34454 Bad Arolsen 34454 Bad Arolsen Telefon: 05691 – 6370 Telefon: 05691 - 6928 Email: [email protected] Bad Arolsen III Rudolf Josephy Dr. Günter Steiner Ortsteile: Wetterburg, Neu-Berich, Braunsen Wetterburg Braunsen Remmeker Ring 32 Bilsteiner Straße 9 34454 Bad Arolsen 34454 Bad Arolsen Telefon: 05691 – 5787 Telefon: 05691 - 629645 Email: [email protected] Bad Arolsen IV Wilfried Drunk Jürgen Mewes Ortsteile: Bühle, Landau, Volkhardinghausen Landau Landau Am Besenberg 6 Eschebreite 4 34454 Bad Arolsen 34454 Bad Arolsen Telefon: 05696 – 1247 Telefon: 05696 - 229 Dienstl.: 05696-1226 Email: [email protected] Diemelsee In Diemelsee gibt es drei Ortsgerichte. Die Zuständigkeit richtet sich danach, in welchem Ortsteil Sie wohnen. Ortsgericht Ortsgerichtsvorsteher Vertreter Diemelsee I Wolfgang Theimer Karl-Ernst Büddefeld Ortsteile: Adorf, Rhenegge, Sudeck, Vasbeck Adorf Vasbeck Arolser -

Tel. 05691 – 62472-0
Schützenplatz 4 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Tel. 05691 – 62472-0 Elektro-Engelhard GmbH gegründet: 1967 Beschäftigte: 2 Elektromeister 2 Elektrotechniker 26 Elektromonteure 7 Auszubildende 5 Büroangestellte Seite 1 von 11 Schützenplatz 4 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Tel. 05691 – 62472-0 Referenzliste Sonderbauten Multi-Funktionsgebäude, Skiclub Willingen Weltcup-Skisprungschanze Willingen Biathlon-Anlage Willingen Aussichtsturm Ettelsberg Willingen Bauhof Willingen Freizeitbad Arobella Bad Arolsen Freizeitbad Arobella Saunalandschaft Bad Arolsen Schwimmbad Ihringshausen Schloss Bad Arolsen Schloss Rhoden Schloss Waldeck Schloss Wilhelmsthal Twistesee-Stausee Bad Arolsen Twistesee-Sanitärgebäude Bad Arolsen Twistesee-Strandbad Bad Arolsen Stadthalle Mengeringhausen + Volkmarsen + Rhoden Festhalle Schmillinghausen Dansenberghalle Diemelsee-Adorf Golfclub Bad Arolsen Infocenter Kellerwald Vöhl-Herzhausen Kulturhalle Wolfhagen Kurhaus Bad Wildungen Wandelhalle Bad Wildungen Testzentrum für neue Netze Fraunhofer Institut Fuldatal-Rothwesten Parkdeck Kaiserlindenplatz Bad Wildungen Tierhaus Mengeringhausen Feuerwehrstützpunkt Bad Arolsen Feuerwehrstützpunkt Volkmarsen Feuerwache Diemelsee Hessische Landesfeuerwehrschule Kassel Bauhof Willingen Hessische Erstaufnahmeeinrichtung Bad Arolsen Bahnhofsanierung Felsberg-Gensungen Kampfrichterturm Mühlenkopfschanze Willingen Pfadfinder Bundeszentrale Kassel Seite 2 von 11 Schützenplatz 4 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Tel. 05691 – 62472-0 Krankenhäuser Krankenhaus Bad Arolsen St. Elisabeth -

Landkreis Waldeck-Frankenberg Im Jahr 2019
Bund der Steuerzahler Hessen e.V. November 2019 Kommunale Steuern im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Jahr 2019 Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2018) Grundsteuer Hundesteuer (in Euro) Straßenbeiträge Defizitärer Haushalt Spielappa- Wettauf- Zweitwoh- Gewerbe- Für Pferde- Vergnügung- Kulturförder- Verabschie Stadt/Gemeinde rate- wand- nung- wiederkeh- steuer A B 1. Hund gefährliche steuer steuer abgabe einmalig 2018 2019 dung steuer steuer steuer rend Hunde Allendorf (Eder) 357 (+11) 332 365 48,00 270,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Bad Arolsen 370 350 400 48,00 nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Bad Wildungen 380 360 360 42,00 nein nein ja nein nein nein ja [15] ja nein nein nein ja Battenberg 357(+17) 359 359 50,00 300,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Bromskirchen 380 350 365 48,00 nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Burgwald 380(+10) 395(+15) 395(+15) 54,00 300,00 nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein ja Diemelsee 365(+5) 365(+5) 365(+5) 48,00 300,00 nein ja nein ja nein ja [10] ja nein nein ja ja Diemelstadt 357 365 365 48,00 96,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Edertal 370(+10) 370(+10) 370(+10) 60,00 375,00 nein nein nein ja nein ja [10] ja nein nein nein ja Frankenau 380(+20) 390 390 54,00 nein nein ja nein nein nein ja [12] ja nein nein nein ja Frankenberg 357 330 396 42,00 nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Gemünden 385 370 375 36,00 240,00 nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein ja (Wohra) Haina -

Brilon Korbach Frankenberg Marburg Montag
Burgwaldbahn Gesamtverkehr RE/RB97 G 97 Brilon Korbach Frankenberg Marburg RMV-Servicetelefon: 069 / 24 24 80 24 t s s s s s s s s s s s s Brilon Stadt Brilon# Wald Willingen# # Usseln # Korbach Korbach SüdThalitter HerzhausenSchmittlotheimEderbringhausenViermündenFrankenberg-GoßbergFrankenbergBirkenbringhausen (Eder) Wiesenfeld ErnsthausenMünchhausenSimtshausenWetter Cölbe Marburg (L) P+R RE17 P+R P+R P+R P+R P+R P+R P+R RB41 RB4 RB94 ICE RE98 RE30 RB41 X38 RB94 s = Übergangstarif RMV-NVV # = Bahnhof ist nicht zum RMV-Tarif erreichbar : Station für Rollstuhlfahrer zugänglich Montag - Freitag Am 24.12. und 31.12. Verkehr wie Samstag Gattung RB RB RB RB RB RE RB RB RB RB RB RE RB RE RB RE RB RB Brilon-Stadt # ab 7.05 8.56 10.56 12.56 14.56 16.04 16.56 18.04 18.56 20.56 Brilon Wald # an 7.14 9.04 11.05 13.05 15.05 16.12 17.04 18.12 19.04 21.04 Brilon Wald # ab 5.58 7.27 9.12 11.12 13.12 15.12 16.14 17.12 18.14 19.12 21.12 Willingen # 6.09 7.36 8.39 9.21 11.21 13.21 14.39 15.21 16.25 17.21 18.25 19.21 21.21 Willingen-Usseln # 6.15 7.42 8.45 9.29 11.29 13.29 14.45 15.29 16.31 17.29 18.31 19.29 21.29 Korbach s an 6.31 7.57 9.00 9.45 11.45 13.45 15.00 15.45 16.46 17.45 18.46 19.45 21.45 Korbach s ab 5.54 6.33 8.00 9.02 10.00 12.00 14.00 15.02 16.00 17.02 18.00 19.02 20.00 22.00 Süd 5.56 6.35 8.02 9.04 10.02 12.02 14.02 15.04 16.02 17.04 18.02 19.04 20.02 22.02 Thalitter s 6.02 6.41 8.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08 20.08 22.08 Herzhausen s 6.08 6.47 8.14 9.15 10.14 12.14 14.14 15.15 16.14 17.15 18.14 19.15 20.14 22.14 Schmittlotheim s 6.13 -
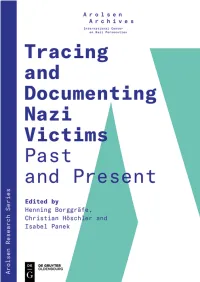
Downloads/.Last Accessed: 9
Tracing and Documenting Nazi Victims Past and Present Arolsen Research Series Edited by the Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution Volume 1 Tracing and Documenting Nazi Victims Past and Present Edited by Henning Borggräfe, Christian Höschler and Isabel Panek On behalf of the Arolsen Archives. The Arolsen Archives are funded by the German Federal Government Commissioner for Culture and the Media (BKM). ISBN 978-3-11-066160-6 eBook (PDF) ISBN 978-3-11-066537-6 eBook (EPUB) ISBN 978-3-11-066165-1 ISSN 2699-7312 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial NoDerivatives 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licens-es/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020932561 Bibliographic Information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2020 by the Arolsen Archives, Henning Borggräfe, Christian Höschler, and Isabel Panek, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: Jan-Eric Stephan Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Preface Tracing and documenting the victims of National Socialist persecution is atopic that has receivedlittle attention from historicalresearch so far.Inorder to take stock of existing knowledge and provide impetus for historicalresearch on this issue, the Arolsen Archives (formerlyknown as the International Tracing Service) organized an international conferenceonTracing and Documenting Victimsof Nazi Persecution: Historyofthe International Tracing Service (ITS) in Context. Held on October 8and 92018 in BadArolsen,Germany, this event also marked the seventieth anniversary of search bureaus from various European statesmeet- ing with the recentlyestablished International Tracing Service (ITS) in Arolsen, Germany, in the autumn of 1948. -

Liste Der Bahnstationen Im Landkreis Waldeck-Frankenberg Und Deren Merkmale
Lokaler Nahverkehrsplan für den Landkreis Waldeck-Frankenberg Anlage II-9 Liste der Bahnstationen im Landkreis Waldeck-Frankenberg und deren Merkmale DB-Stations- Ausstattung Bahnsteigzugang Bahnsteighöhen Verkehrshalt Einwohnerpotenzial im Einzugsbereich kategorie 1 2 Bahnstation Einw. Einw. OT mit zzgl. weitere Stadt-/Ortsteile Bahn- OT bis im Umkreis bis 1 km station 1 km 76 cm RT R, RE IC, ICE und Summe Ein- Aussteiger 2008 Infrastruktur- unternehmen SPS 05 SPS 11 Anzahl Bahn- steigkanten dynamische Anzeige barrierefreie Zuwegung taktile Leitstreifen Aufzug Treppe Rampe Gleisquerung 38 cm 55 cm Landkreis Waldeck-Frankenberg Bad Arolsen DB KHB 6 - 2 x x x x x x x 8.251 8.251 535 Bad Arolsen-Mengeringhausen DB KHB 6 - 1 x x x x 3.689 3.689 104 Bad Wildungen DB KHB 6 - 1 x x x x 9.477 12.234 Bad Wildungen-Altwildungen 169 Bad Wildungen-Mandern DB KHB 6 - 1 x x x x 707 707 6 Bad Wildungen-Wega DB KHB 6 - 2 (x) x x x 769 769 10 Burgwald-Birkenbringhausen DB KHB 6 - 1 x x x 798 1.470 Burgwald-Burgwald 124 Burgwald-Ernsthausen DB KHB 6 - 1 x x x x 1.299 1.299 137 Burgwald-Wiesenfeld DB KHB 6 - 1 x x x x 283 283 46 Frankenberg (Eder) DB KHB 6 - 2 x x x x 12.152 12.152 601 Korbach DB KHB 6 - 4 x x x x x x 18.767 18.767 543 Korbach-Süd DB KHB 6 - 1 x x x 18.767 18.767 154 Twistetal-Twiste DB KHB 6 - 1 x x x x 1.346 1.346 116 Volkmarsen DB KHB 6 - 2 x x x x x 4.689 4.689 359 Volkmarsen-Ehringen DB KHB 6 - 1 x x x x 837 837 71 Volkmarsen-Külte/ DB KHB 6 - 1 x x x x 882 1.963 Bad Arolsen-Neu-Berich, 71 Bad Arolsen-Wetterburg Bad Arolsen-Wetterburg