Roman Scholz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Svědkové Lidskosti Hanns Georg Heintschel Von Heinegg De
Die Ausstellung stellt dem Betrachter in zehn Lebensbildern Menschen vor, welche sich aus ihrer christlichen Überzeugung heraus gegen den Nationalsozialismus von 1938 bis 1945 stellten und so Opfer dieses menschenverachtenden Regimes wurden. Es handelt sich um fünf Priester, zwei Ordensfrauen und drei Laien, die mit ihrem Lebenszeugnis auf je einer Stele präsentiert werden. Das Ende des Nationalsozialismus durfte keiner der hier Vorgestellten erleben. Sie starben entweder vorher in den Konzentrationslagern oder wurden hingerichtet. An sie und darüber hinaus an alle weiteren christlichen sudetendeutschen NS-Gegner der Jahre 1938 bis 1945 will die Ausstellung erinnern. Noch dazu kommt, dass der christliche sudetendeutsche Wiederstand dieser Jahre wissenschaftlich noch nicht umfassend aufgearbeitet wurde. Die Initiatoren der Ausstellung sehen die Ausstellung in diesem Bereich als Anregung. Hanns Georg Heintschel von Heinegg (* 5.September 1919 in Kněžice, † 5.Dezember 1944 in Wien) Lyriker, Theologiestudent und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus Hanns Georg Heintschel-Heinegg entstammte einer aus Heinersdorf an der Tafelfichte stammenden österreichischen Wollwarenfabrikantenfamilie. Sein genauer Geburtsort ist Schloss Kněžice im Böhmerwald, das die Familie 1897 erworben hatte. Er hatte drei Schwestern. Seine Eltern mussten ihre Güter Kněžice, Žíkov und Strunkov im Jahre 1926 wegen Überschuldung verkaufen. Die Familie übersiedelte darauf hin nach Wien. Hanns Georg besuchte dort die Schule. In den 1930er Jahren kam er ans Theresianum. Er begann sich in dieser Zeit bald für deutschsprachige Literatur zu begeistern, und trat nach der Matura 1937 in das Priesterseminar Canisianum in Innsbruck ein. Der Anschluss Österreichs an das deutsche Reich 1938 zwang ihn dazu, das Studium der Theologie abzubrechen. Er schloss sich in Wien der österreichischen Widerstandsbewegung um Roman Karl Scholz an. -

Austrian Federalism in Comparative Perspective
CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 Bischof, Karlhofer (Eds.), Williamson (Guest Ed.) • 1914: Aus tria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I War of World the Origins, and First Year tria-Hungary, Austrian Federalism in Comparative Perspective Günter Bischof AustrianFerdinand Federalism Karlhofer (Eds.) in Comparative Perspective Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS innsbruck university press Austrian Federalism in ŽŵƉĂƌĂƟǀĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2015 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70148, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Book design by Allison Reu and Alex Dimeff Cover photo © Parlamentsdirektion Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011124 ISBN: 9783902936691 UNO PRESS Publication of this volume has been made possible through generous grants from the the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs in Vienna through the Austrian Cultural Forum in New York, as well as the Federal Ministry of Economics, Science, and Research through the Austrian Academic Exchange Service (ÖAAD). The Austrian Marshall Plan Anniversary Foundation in Vienna has been very generous in supporting Center Austria: The Austrian Marshall Plan Center for European Studies at the University of New Orleans and its publications series. -

Mitteilungen Heft 1-2013.Pdf
Liebe Freunde und Wohltäter des Hauses Königstein! Es hat sich viel getan in den ersten Monaten des Jahres 2013. Bei der Wahl um das höchste Amt in der Tschechischen Republik hat Fürst Schwarzenberg mehr als einen Achtungserfolg errungen. Er war der moralische Sieger, wie Sie aus den Ausführungen unseres zweiten Vor- sitzenden ersehen (S. 4), die gekürzt als Leserbrief in der FAZ erschienen sind. Das Schreiben der Germanistin an der Olmützer Universität, Frau Ingeborg Fiala-Fürst, an die Freunde im Ausland (S. 3) zeigt ebenfalls den Stimmungswandel in Tschechien. Das gilt auch von der Rede des Minis- terpräsidenten Nečas bei seinem Besuch im Bayerischen Landtag. Sie handelte von der tschechisch-bayerischen Nachbarschaft im heutigen Europa und sprach von „einer Schicksalsgemeinschaft, die voll Inspirati- on, Bereicherung, aber auch Traumata und Vorurteile ist.“ Während die katholische Wochenzeitschrift Katolický tydeník ange- sichts der Rede von einem Zeichen des Durchbruchs spricht, wird der Premierminister in seiner Heimat dafür von vielen Politikern aufs Unflä- tigste beschimpft. Es wäre naiv anzunehmen, dass er das vorher nicht gewusst hat. Insofern gebührt im großer Dank und manch Politiker sollte sich eine Scheibe davon abschneiden! Wir hier im Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien haben uns natürlich gefreut, dass Nečas auch auf die Kirchen- geschichte einging. Er erwähnte, dass seit dem 9. Jahrhundert das Christentum aus Bayern nach Böhmen kam. Er sprach von den vierzehn böhmischen Herrschern, die sich im Jahre 845 in Regensburg taufen ließen und nannte den hl. Bischof Wolfgang und die Unterstellung der neugegründeten Diözese Prag 973 unter das Erzbistum Mainz. Welcher deutscher Politiker hat bei Besuchen in Prag von Wallfahrten beider Völker über die Grenzen hinaus gesprochen oder von den Statuen des hl. -

The Waldheim Phenomenon in Austria
Demokratiezentrum Wien Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) Richard Mitten THE POLITICS OF ANTISEMITIC PREJUDICE : THE WALDHEIM PHENOMENON IN AUSTRIA Table of Contents: Acknowledgments Chapter One: Introduction: “Homo austriacus” agonistes Chapter Two: Austria Past and Present Chapter Three: From Election Catatonia to the “Waldheim Affair” Chapter Four: “What did you do in the war, Kurt?” Chapter Five: Dis“kurt”esies: Waldheim and the Language of Guilt Chapter Six: The Role of the World Jewish Congress Chapter Seven: The Waldheim Affair in the United States Chapter Eight: The “Campaign” against Waldheim and the Emergence of the Feindbild Chapter Nine: When “The Past” Catches Up 1 Autor/Autorin: Richard Mitten • The Campaign against Waldheim and the Emergence of the Feindbild Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) • Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Demokratiezentrum Wien Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) Introduction: “Homo austriacus” agonistes Gaiety, a clear conscience, the happy deed, the confidence in the future---all these depend, for the individual as well as for a people, on there being a line that separates the forseeable, the light, from the unilluminable and the darkness; on one’s knowing just when to forget, when to remember; on one’s instinctively feeling when necessary to perceive historically, when unhistorically. -

The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria
P1: JZZ 0521856833pre CUNY200B/Art 0521856833 October 7, 2005 21:45 This page intentionally left blank P1: JZZ 0521856833pre CUNY200B/Art 0521856833 October 7, 2005 21:45 The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria This book argues that Germans and Austrians have dealt with the Nazi past very differently and that these differences have had important con- sequences for political culture and partisan politics in the two countries. Drawing on different literatures in political science, David Art builds a framework for understanding how public deliberation transforms the political environment in which it occurs. The book analyzes how public debates about the “lessons of history” created a culture of contrition in Germany that prevented a resurgent far right from consolidating itself in German politics after unification. By contrast, public debates in Austria nourished a culture of victimization that provided a hospitable environ- ment for the rise of right-wing populism. The argument is supported by evidence from nearly 200 semistructured interviews and an analysis of the German and Austrian print media over a twenty-year period. David Art is an assistant professor of political science at the College of the Holy Cross. He teaches courses in European politics, international relations, and globalization. He received his B.A. from Yale University and his Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology. His cur- rent research focuses on the development of right-wing populist parties in comparative and historical perspective. i P1: -

Jahrbuch 2011
www.doew.at Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) Jahrbuch 2011 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) JAHRBUCH 2011 Schwerpunkt: Politische Verfolgung im Lichte von Biographien Redaktion: Christine Schindler Der Druck dieser Publikation wurde finanziell unterstützt durch: Arbeiterkammer Wien Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7 – Wissenschaft) Layout: Christa Mehany-Mitterrutzner Die Beiträge der einzelnen AutorInnen repräsentieren grundsätzlich deren Meinung. Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.d-nb.de abrufbar ISBN 978-3-901142-59-8 © Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wien 2011 Herstellung: Plöchl Druck GmbH, A-4240 Freistadt Auslieferung: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wipplingerstraße 6-8 (Altes Rathaus) A-1010 Wien Tel. +43-1-22 89 469-319 Fax +43-1-22 89 469-391 e-Mail: [email protected] http://www.doew.at Inhalt – Jahrbuch 2011 www.doew.at Christine Schindler Redaktionelle Vorbemerkung 7 Barbara Prammer Rede anlässlich der Jahresversammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes am 9. März 2010, Altes Rathaus 13 Schwerpunkt Politische Verfolgung im Lichte von Biographien Stephan Roth „Mein Augenmerk war immer darauf gerichtet, mich nicht erwischen zu lassen, denn nur, wenn ich am Leben bliebe, konnte ich gegen Hitler kämpfen -

Historicalmaterialism Bookseries
Otto Bauer (1881–1938) Historical Materialism Book Series Editorial Board Sébastien Budgen (Paris) David Broder (Rome) Steve Edwards (London) Juan Grigera (London) Marcel van der Linden (Amsterdam) Peter Thomas (London) volume 121 The titles published in this series are listed at brill.com/hm Otto Bauer in 1931 Otto Bauer (1881–1938) Thinker and Politician By Ewa Czerwińska-Schupp Translated by Maciej Zurowski leiden | boston This is an open access title distributed under the terms of the cc-by-nc License, which permits any non-commercial use, and distribution, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Published with the support of Austrian Science Fund (fwf) First published in German by Peter Lang as Otto Bauer: Studien zur social-politischen Philosophie. © by Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2005. The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov LC record available at http://lccn.loc.gov/2016031159 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and download: brill.com/brill-typeface. issn 1570-1522 isbn 978-90-04-31573-0 (hardback) isbn 978-90-04-32583-8 (e-book) Copyright 2017 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. This work is published by Koninklijke Brill NV. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. Koninklijke Brill nv reserves the right to protect the publication against unauthorized use and to authorize dissemination by means of offprints, legitimate photocopies, microform editions, reprints, translations, and secondary information sources, such as abstracting and indexing services including databases. -
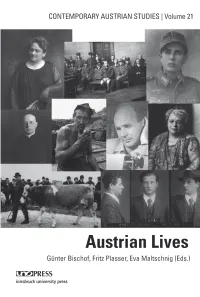
CAS21 for Birgit-No Marks
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Austrian Lives
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Jews and Queers in Late-Twentieth-Century Vienna / Matti Bunzl
© 2008 UC Regents Buy this book Erich Lifka’s “Landesgericht zwei, Wien” appears by permission of Foerster Media. Erich Fried’s “An Österreich” appears by permission of Claassen Verlag, Munich. English-language translation of Erich Fried’s “To Austria” reprinted from Contemporary Jewish Writing in Austria: An Anthology, edited by Dagmar C. G. Lorenz, by permission of the University of Nebraska Press. © 1999 by the University of Nebraska Press. University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England © 2004 by the Regents of the University of California Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Bunzl, Matti, 1971–. Symptoms of modernity : Jews and queers in late-twentieth-century Vienna / Matti Bunzl. p. cm. Includes bibliographical references. isbn 0–520–23842–7 (cloth : alk. paper) — isbn 0–520–23843–5 (pbk. : alk. paper) 1. Jews—Austria—Vienna—Social conditions—20th century. 2. Gays— Austria—Vienna—Social conditions—20th century. 3. Vienna (Austria)— Ethnic relations. 4. Vienna (Austria)—Social life and customs—20th century. 5. Austria—History—1955- 6. Austria—Social policy. 7. Nationalism—Social aspects—Austria. I. Title. ds135.a92 v52216 2004 305.892'4043613'09049—dc21 2003002458 Manufactured in the United States of America 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 10987654 321 The paper used in this publication is both acid-free and totally chlorine- free (tcf). It meets the minimum requirements of ansi/niso z39.48–1992 (r 1997) (Permanence of Paper).8 chapter 1 Myths and Silences It would be unkind not to speak about your guilt that bends you to the ground and threatens to crush you. -

J OÖW - Bibliothek ! L Handbibliothek Sc}Lweq>Unkt: Kathdlischer Widerstand
j OÖW - Bibliothek ! l Handbibliothek Sc}lweq>unkt: KathDlischer Widerstand \1 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes JAHRBUCH 1991 Redaktion: Siegwald Ganglmair VIZEKANZLER A. D. DR. FRITZ BOCK VIZEPRÄSIDENT DES DÖW ZUM 80. GEBURTSTAG (26. 2. 1991) © 1991 by Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien Printed in Austria Umschlaggestaltung: Atelier Fuhrherr, Wien Satz: Michael Kosz Hersteller: Plöchl-Druckgesellschaft m. b. H. & Co. KG„ 4240 Freistadt ISBN 3-901142-02-9 Fritz Bock 5 4 Fritz Bock schüchteru?g.smaß~ahmen, sondern, so paradox es klingen mag, Mittel, die DÖW-VIZEPRÄSIDENT DR. FRITZ BOCK - 80 JAHRE propagandistisch wrrken. Dem war seitens der Vaterländischen Front nichts anderes entgegenzusetzen als die Abhaltung von Versammlungen der Druck von mehr oder minder guten oder schlechten Plakaten und Flug Unter den 151 Namen der Transportliste des sogenannten Prominenten schriften." transports vom 1. April 1938 ins KZ Dachau findet sich neben vielen bekann Ein letzter verzweifelter Versuch, die Unabhängigkeit Österreichs zu ten Persönlichkeiten der Ersten Republik und des Ständestaates auch der retten, war der Gedanke einer Volksbefragung über die österreichische junge Funktionär der Vaterländischen Front Dr. Fritz Bock. Die Zu U~a~hängigkei~. Am 9. März 1938 verkündete Bundeskanzler Schuschnigg sammenstellung des Transports hatte, wie aus dem Begleitschreiben hervor bei emer Rede m Innsbruck, daß diese Volksbefragung am 13. März statt geht, mangels "diesbezüglicher Erfahrungen" der Gefangenhausverwaltung finden solle. Die führenden Propagandafunktionäre der Vaterländischen "einiges Kopfzerbrechen und Arbeit" bereitet. Front, unt~r ihnen Fritz Bock, hatten bereits einige Zeit vorher den Auftrag Als Stellvertretender Bundeswerbeleiter der Vaterländischen Front hatte erhalten, em Konzept für diesen auf wenige Tage beschränkten Werbefeld sich Bock im Kampf gegen die Anschlußbestrebungen der Nationalsoziali zug zu entwerfen. -

Diplomarbeit 1. Und 2. WK in Höflein Christian Alfons
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Höflein du schöner stiller Ort“ ? Die Auswirkungen des 1. und des 2. Weltkrieges am Beispiel eines niederösterreichischen Dorfes Höflein an der Donau um die Jahre 1914 bis 1945 Verfasser Christian Alfons angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 190 313 333 Studienrichtung lt. Studienblatt: (UF Geschichte UF Deutsch) Betreuer: Univ. Prof. Dr. Karl Vocelka 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S. 4 2. Der Ort Höflein S. 7 3. Der Erste Weltkrieg S. 8 4. Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges und die Zwischenkriegszeit S. 15 5. Die Zeit des „Ständestaates“ S. 22 5.1. Historischer Hintergrund S.22 5.2. Höflein an der Donau zur Zeit des „Ständestaates“ S.24 5.2.1. Das religiöse Leben im Ort S.25 5.2.2. Die Vaterländische Front S.28 5.2.3. Erzbischöfliche Visitation S.32 6. Der „Anschluss“ S.34 6.1. Historischer Hintergrund S.34 6.2. Höflein an der Donau März 1938 bis September 1939 S.37 6.2.1. Die Zeit des „Anschlusses“ S.37 6.2.2. Die jüdische Ortsbevölkerung S.39 6.2.3. Oktober 1938 bis September 1939 S.44 7. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs S.47 2 8. Kriegsende S.55 8.1. – März 1945 S.55 8.2. – April 1945 S.56 8.2.1. – 6. April 1945 S.6o 8.2.2. – 7. April 1945 S.6o 8.2.3. – 8. April 1945 S.62 8.2.4. – 9. April 1945 S.64 8.2.5. – 12. April 1945 S.67 8.2.6.