Denkmal Des Monats Steglitz-Zehlendorf Von September
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

University of Birmingham at School with the Avant Garde
University of Birmingham At School with the avant garde: Grosvenor, Ian; van Gorp, Angelo DOI: 10.1080/0046760X.2018.1451559 License: Other (please specify with Rights Statement) Document Version Peer reviewed version Citation for published version (Harvard): Grosvenor, I & van Gorp, A 2018, 'At School with the avant garde: European architects and the modernist project in England', History of Education. https://doi.org/10.1080/0046760X.2018.1451559 Link to publication on Research at Birmingham portal Publisher Rights Statement: This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in History of Education on 19/04/2018, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/0046760X.2018.1451559 General rights Unless a licence is specified above, all rights (including copyright and moral rights) in this document are retained by the authors and/or the copyright holders. The express permission of the copyright holder must be obtained for any use of this material other than for purposes permitted by law. •Users may freely distribute the URL that is used to identify this publication. •Users may download and/or print one copy of the publication from the University of Birmingham research portal for the purpose of private study or non-commercial research. •User may use extracts from the document in line with the concept of ‘fair dealing’ under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (?) •Users may not further distribute the material nor use it for the purposes of commercial gain. Where a licence is displayed above, please note the terms and conditions of the licence govern your use of this document. -

Criterios De Intervención En El Patrimonio Arquitectónico Del Siglo XX Conferencia Internacional Cah20thc
MMiinniisstteerriioo CCrriitteerriiooss ddee IInntteerrvveenncciióónn eenn eell PPaattrriimmoonniioo ddee CCuullttuurraa AArrqquuiitteeccttóónniiccoo ddeell SSiigglloo XXXX CCoonnffeerreenncciiaa II nntteerrnnaacciioonnaall CCAAHH2200tthhCC.. DDooccuummeennttoo ddee MMaaddrriidd 22001111 I nnt te er rvveennttiioonn AApppprrooaacchheess iinn tthhee 2200tthh CCeennttuurryy AArrcchhiitteeccttuurraall HHeerriittaaggee II nntteerrnnaattiioonnaall CoConnffeerreennccee CCAAHH2200tthhCC.. MMaaddrriidd DoDoccuummeenntt 22001111 Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX Conferencia Internacional CAH20thC. Documento de Madrid 2011 Intervention Approaches in the 20th Century Architectural Heritage International Conference CAH20thC. Madrid Document 2011 Madrid, 14, 15 y 16 de junio de 2011 www.mcu.es Catálogo de publicaciones de la AGE http://publicacionesoficiales.boe.es/ Coordinación científica: Juan Miguel Hernández León Fernando Espinosa de los Monteros Dirección y coordinación: María Domingo Iolanda Muíña MINISTERIO DE CULTURA Edita: © SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación © De los textos y las fotografías: sus autores NIPO: 551-11-086-9 ISBN: 978-84-8181-505-4 Depósito legal: M-44469-2011 Imprime: Punto Verde Papel reciclado MINISTERIO DE CULTURA Ángeles González-Sinde Ministra de Cultura Mercedes E. del Palacio Tascón Subsecretaria de Cultura Ángeles Albert Directora General de Bellas Artes y Bienes Culturales Con motivo de la Conferencia Internacional sobre -

The Influence of Green Areas and Roof Albedos on Air Temperatures During Extreme Heat Events in Berlin, Germany
Meteorologische Zeitschrift, Vol. 22, No. 2, 131–143 (April 2013) Open Access Article Ó by Gebru¨der Borntraeger 2013 The Influence of green areas and roof albedos on air temperatures during Extreme Heat Events in Berlin, Germany Sebastian Schubert* and Susanne Grossman-Clarke Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany (Manuscript received May 1, 2012; in revised form November 15, 2012; accepted November 19, 2012) Abstract The mesoscale atmospheric model COSMO-CLM (CCLM) with the Double Canyon Effect Parametrization Scheme (DCEP) is applied to investigate possible adaption measures to extreme heat events (EHEs) for the city of Berlin, Germany. The emphasis is on the effects of a modified urban vegetation cover and roof albedo on near-surface air temperatures. Five EHEs with a duration of 5 days or more are identified for the period 2000 to 2009. A reference simulation is carried out for each EHE with current vegetation cover, roof albedo and urban canopy parameters (UCPs), and is evaluated with temperature observations from weather stations in Berlin and its surroundings. The derivation of the UCPs from an impervious surface map and a 3-D building data set is detailed. Characteristics of the simulated urban heat island for each EHE are analysed in terms of these UCPs. In addition, six sensitivity runs are examined with a modified vegetation cover of each urban grid cell by À25%, 5% and 15%, with a roof albedo increased to 0.40 and 0.65, and with a combination of the largest vegetation cover and roof albedo, respectively. At the weather stations’ grid cells, the results show a maximum of the average diurnal change in air temperature during each EHE of 0.82 K and À0.48 K for the À25% and 15% vegetation covers, À0.50 K for the roof albedos of 0.65, and À0.63 K for the combined vegetation and albedo case. -

The Dahlem Workshops
The Dahlem Workshops History During the last half of the twentieth century, specialization in science greatly in- creased in response to advances achieved in technology and methodology. This trend, although positive in many respects, created barriers between disciplines and could have inhibited progress if left unchecked. Understanding the concepts and methodologies of related disciplines became a necessity. Reuniting the dis- ciplines to obtain a broader view of an issue became imperative, for problems rarely fall conveniently into the purview of a single scientific area. Interdisci- plinary communication and innovative problem solving within a conducive en- vironment were perceived as integral yet lacking to this process. In 1971, an initiative to create such an environment began within Germany’s scientific community. In discussions between the Deutsche Forschungsgemein- schaft (German Science Foundation) and the Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Association for the Promotion of Science Research in Germany), researchers were consulted to compare the needs of the scientific community with existing approaches. It became apparent that something new was required: an approach that began with state-of-the-art knowledge and proceeded onward to challenge the boundaries of current understanding; a form truly interdisci- plinary in its problem-solving approach. As a result, the Stifterverband established Dahlem Konferenzen (the Dahlem Workshops) in cooperation with the Deutsche Forschungsgemeinschaft in 1974. Silke Bernhard, formerly associated with the Schering Symposia, was Figure adapted from L’Atmosphère: Météorologie Populaire, Camille Flammarion. Paris: Librairie Hachette et Cie., 1888. viii The Dahlem Workshops engaged to lead the conference team and was instrumental in implementing this unique approach. The Dahlem Workshops take their name from a district of Berlin known for its strong historic connections to science. -

Individual Accommodation
Individual Accommodation Students looking for accommodation individually may want to look at the following housing listings: Search Engine - Shared Housing (WG): www.studenten-wg.de www.zwischenmiete.de www.wgcompany.de www.wg-welt.de www.wg-gesucht.de www.easywg.de www.wohngemeinschaft.de www.quoka.de/immobilienmarkt www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/berlin/zwischenmiete/k0c203l3331 www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/berlin/untermiete/k0c203l3331 Search Engine - Flats: www.wohnpool.de www.immobilo.de www.waytostay.com www.immobilienscout24.de www.immonet.de/berlin/studentenwohnung.html www.studenten-wohnung.de www.studentenwohnungsmarkt.de www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/berlin/room/k0c203l3331 www.immowelt.de www.nuroa.de www.wohnungsboerse.net www.LocaBerlin.de Furnished Rooms / Apartments: WBM-Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (furnished Apartments): www.wbm.de/wbm/cms/de/wohnen/moebliertes_wohnen/moeblWohnenStart.html Student apartments in Berlin-Dahlem (minimum rental period = 6 months): http://www.je-immobilien-berlin.de/index.php?id=136 House of Nations: http://house-of-nations.de/cms/home.html Berlinovo Apartment GmbH: http://www.berlinovo.de/de IBZ - Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft e.V.: http://www.ibz- berlin.de/wohnen Studentendorf Schlachtensee: www.studentendorf-berlin.com/ Mowitania (holiday flats): www.ferienwohnung-zimmer-berlin.de Singer 109 (Hotel,Hostel,Apartments): www.singer109.com/ Loft-Apartments: www.wohnung-berlin.de/ Be my -

Downloaded for Personal Non-Commercial Research Or Study, Without Prior Permission Or Charge
Hobbs, Mark (2010) Visual representations of working-class Berlin, 1924–1930. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/2182/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Visual representations of working-class Berlin, 1924–1930 Mark Hobbs BA (Hons), MA Submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of PhD Department of History of Art Faculty of Arts University of Glasgow February 2010 Abstract This thesis examines the urban topography of Berlin’s working-class districts, as seen in the art, architecture and other images produced in the city between 1924 and 1930. During the 1920s, Berlin flourished as centre of modern culture. Yet this flourishing did not exist exclusively amongst the intellectual elites that occupied the city centre and affluent western suburbs. It also extended into the proletarian districts to the north and east of the city. Within these areas existed a complex urban landscape that was rich with cultural tradition and artistic expression. This thesis seeks to redress the bias towards the centre of Berlin and its recognised cultural currents, by exploring the art and architecture found in the city’s working-class districts. -

Unternehmensservice Steglitz-Zehlendorf
Standortvorteile: Unternehmensservice · Wirtschaftsfreundlicher und forschungsnaher Standort Steglitz-Zehlendorf · Bedeutender Life-Sciences-Standort mit Kliniken, Instituten, produzierenden und entwickelnden Unternehmen · Enge Kooperation von Universitäten, Instituten und Wirtschaft · Aktive Gründerszene durch Spin Offs bzw. Jungunternehmen, Forschen und leben im Berliner Südwesten u. a. im Umfeld der Freien Universität Berlin Steglitz-Zehlendorf so groß und vielfältig wie eine mittlere Großstadt – · Regionale Unternehmensnetzwerke zur Förderung kleinerer ein Bezirk mit Lebensqualität. Der Bezirk gliedert sich in die Ortsteile und mittlerer Unternehmen Wannsee, Dahlem, Nikolassee, Zehlendorf, Lankwitz, Lichterfelde, · 77 ha großes historisches Gewerbeareal „Goerzallee / Zehlen- Steglitz und Südende. Dank einer guten Autobahn- und S-Bahn-Anbin- dorfer Stichkanal“ mit 170 Firmen dung ist man in nur wenigen Minuten entweder in der Innenstadt oder im Berliner Umland. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf wird auch „grüner Bezirk“ genannt. Steglitz-Zehlendorf bietet · Otto Lilienthal Gedenkstätte Ihre Ansprechpartner zum Unternehmensservice · Gutshaus Steglitz, eines der letzten Bauzeugnisse des preußischen in Steglitz-Zehlendorf Frühklassizismus · Schlosspark Klein-Glienicke – UNESCO Weltkulturerbe Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf Berlin Partner für Wirtschaft · Botanischer Garten, das höchste Gewächshaus der Welt ist mit 42 ha von Berlin und Technologie Gesamtfläche und ca. 18.000 Pflanzensorten die größte Anlage Michael Pawlik Marc Pappert dieser -
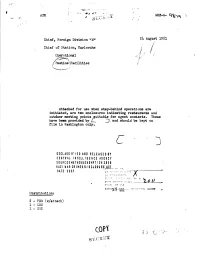
• (OP1 Si ,C1-R"T .L.A%
AIR MG —A— (A %-1 ) Chief, Foreign Division oll" 24 August 1951 . / Chief of . Station, Karlsruhe Operational. IPastime\Facilities Attached for use when star-behind operations are initiated, are two enclosures indicating restaurants and outdoor meeting points suitable for agent contacts. These have been provided by J. should be kept on file in Washington only. C DECLASS IF I ED AND RELEASED BY CENTRAL I NTELL IS ENCE AGENCY SOURCES METHOOSEX EHPT ION MO NAZI WAR CR IMES 01 SCLODURrADL.,,, DATE 20 07 • P'J! U1E104a___, t7.7 77; o Distributiont 2 - FDA (w/attach) 1 - COS 1 - BOB • (OP1 si ,C1-r"T .L.A% POINTS IN BERLIN SUITABLF, FOR OUTDOOR mtEmlis 1. Berlin-Britz Telephone booth in front of Post Office on the corner of . Chaussee Strasse and Tempelhofer Weg. 2. Berlin-Charlottenburg Streetcar stop for the line towards Charlottenburg in front Of S-Bahnhof Westend.. 3. Berlin-Friedenau Telephone booth on the corner of Handjery Strasse and Isolde Strasse (Maybach Platz). 4. Berlin-Friedrichsfelde Pillar used for posters on the corner of Schloss StrasSe and Wilhelm Strasse. 5. .Berlin=Friedrichshain Streetcar stop for line 65 in the direction of Lichtenberg located on Lenin Platz. 6. Derlin-Grffnau Final stop for bus lines A 36 and 38 in Grffnau. 7. Berlin-Gruneuald Ticket counter in S-Bahnhof Halensee. 8. Berlin-Heinersdorf Pillar used for posters on the corner of Stiftsweg and Dreite Strasse. 9. Berlin-Hermsdorf Ticket counter located inside S-Bahnhof Hermsdorf. 10. Berlin-Lankuitz Pillar used for posters on the corner of Marienfelde Strasse and Emmerich Strasse. -

Villa Arons - Barthold Arons Und Sein Sohn Bruno Ahrends
Villa Arons - Barthold Arons und sein Sohn Bruno Ahrends Um 1875 ließ sich der Bankier Heinrich Leo, Mitbegründer des Bank- hauses Delbrück, von den Architekten Kyllmann und Heyden Am Großen Wannsee 5 eine Sommerresidenz errichten. Das Gebäude war dem Stil einer italienischen Villa nachempfunden. Es war die erste „Löwenvilla“, woran noch der Löwenkopf am Springbrunnen erinnert. 1880 erwarb der Bankier Barthold Arons das Anwesen, zu dem die heutigen Grundstücke Am Großen Wannsee 6 und 6a gehörten. Sie dienten als Aussichtsfläche auf den See. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Villa Arons als erste Wannseevilla unter Denkmalschutz gestellt. Barthold Arons (1852 - 1934) stammte aus einer Bankiersfamilie. Er wurde nach zahlreichen Auslandsaufenthalten erfolgreich im Berliner Bank- geschäft tätig und bekleidete mehrere Ämter in Aufsichtsräten der Schwer- und Zellstoffindustrie sowie der Energiewirtschaft. Er engagierte sich im Club von Berlin und war Mitglied der Jüdischen Gemeinde. Der begeisterte Wassersportler gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Segelvereins und wurde im Mitgliederverzeichnis des Vereins Seglerhaus am Wannsee (VSAW) von 1928 als Ehrenmitglied genannt. Villa Arons Barthold Arons (1852 - 1934) Bruno Ahrends 1921 baute sich sein Sohn, Regierungsbaumeister Bruno Ahrends, der seinen Nachnamen hatte Landhaus Bruno Ahrends, um 1920 ändern lassen, auf dem zur Wasserseite am Hang gelegenen Trennstück ein schlichtes Landhaus. Bruno Ahrends war zwischen 1895 und 1931 als Architekt in Berlin tätig. Neben mehreren Landhäusern und kommunalen Bauten wie dem Pfarr- und Gemeindehaus in Wannsee, errichtete er 1928 das Haus der Geschäftsstelle der Domäne Dahlem. Er wurde auch mit Umbauten von Häusern in der Colonie Alsen beauftragt. Ahrends setzte sich auch dafür ein, der Erholung suchenden Berliner Bevölkerung Zugang zum See und zu den Grünflächen zu verschaffen. -

Inhalt Contents
Inhalt Contents 7 Prolog 7 Prologue 13 Vom Jugendstil zur Moderne 13 From Jugendstil to Modernism 19 Das Bauhaus in Weimar, Dessau und Berlin 19 The Bauhaus in Weimar, Dessau and Berlin 27 Berlin und die Moderne 27 Berlin and Modernism 63 Das Neue Bauen in Deutschland 63 New Building in Germany 127 Architektur der Neuen Sachlichkeit in Europa 127 The Architecture of new Objectivity in Europe 179 Internationaler Stil – 179 International Style – Modernes Bauen auf der ganzen Welt Modern Building all over the world 227 Epilog – Die Erben des Bauhauses 227 Epilogue – The Legacy of the Bauhaus 233 Anhang 233 Appendix Bauhaus.indd 5 12.09.18 12:58 Prolog Prologue Bauhaus.indd 7 12.09.18 12:58 8 Israel, Tel Aviv, Wohnhaus Recanati-Saporta, 1935/36, Salomon Liaskowski, Jakob Orenstein Israel, Tel Aviv, Residential building in Recanati-Saporta, 1935/36, Salomon Liaskowski, Jakob Orenstein Bauhaus.indd 8 12.09.18 12:58 Das »Bauhaus« war ursprünglich eine 1919 in Weimar gegründete The “Bauhaus” was originally an art school founded in Weimar in 1919. Kunstschule. Ihr Einfluss erwies sich jedoch als so bedeutend, dass Its influence, however, was so significant that in everyday speech the der Begriff heute umgangssprachlich mit verschiedenen Strömungen term is equated today with various modernist movements in architec- der Moderne in Architektur und Design in der ersten Hälfte des20 . ture and design in the first half of the 20th Century. This broader sense Jahrhunderts gleichgesetzt wird. In diesem erweiterten Sinn wurde of the word is relevant for the choice of buildings in this book. -

Endstation Ungewiss Eine Lange Nacht Über Die „Kindertransporte“ 1938/39
Endstation Ungewiss Eine Lange Nacht über die „Kindertransporte“ 1938/39 Autor: Jochanan Shelliem Regie: Nikolai von Koslowski Redaktion: Dr. Monika Künzel SprecherIn: Matthias Ponnier Bruno Cathomas Sigrid Burkholder Jochen Nix Sendetermine: 28. August 2021 Deutschlandfunk Kultur 28./29. August 2021 Deutschlandfunk __________________________________________________________________________ Urheberrechtlicher Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom Empfänger ausschließlich zu rein privaten Zwecken genutzt werden. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung, die über den in den §§ 45 bis 63 Urheberrechtsgesetz geregelten Umfang hinausgeht, ist unzulässig. © Deutschlandradio - unkorrigiertes Exemplar - insofern zutreffend. 1. Stunde Musik Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra, Movement 1 / 14“ Filmton Nicholas Winton: I have a motto that if something isn’t bluntly impossible, there must be some way doing it. i Atmo Dielen knarzen, bedeutungsschwangere Musik Erzähler 1988 geht eine alte Frau im englischen Maidenhead auf ihren Dachboden, drei alte Bücher in der Hand, sucht einen Staubfreien Platz, um sie zu verstauen. Nicholas Winton Wenn etwas nicht völlig unmöglich ist, muss man einen Weg finden, es zu tun. Erzähler Sie öffnet eine Truhe und stößt auf Briefe ihres Mannes, die sie nicht kennt. Sie findet Stempel, Ordner voller Daten, Namen und Adressen. Von dieser Zeit hatte Nicholas Winton ihr nie etwas erzählt. Filmton Joe Schlesinger Mann Dieser alte Mann hat mir das Leben gerettet und das Leben Hunderter anderer Menschen während des Zweiten Weltkrieges auch. ii Atmo ruhigere Musik – Schreibmaschine Nicholas Winton Ich sah diese Menschen, die in Schwierigkeiten waren, in Gefahr gewesen sind, Menschen, mit denen Hitler etwas vorhatte. Winton I saw these people, who were in difficulties, in danger, people on Hitlers backlist iii Mann We tried to get to America, we tried to get to England, we tried to get to Palestine, but all the governments said O, o, borders are now closed. -

Division, Records of the Cultural Affairs Branch, 1946–1949 108 10.1.5.7
RECONSTRUCTING THE RECORD OF NAZI CULTURAL PLUNDER A GUIDE TO THE DISPERSED ARCHIVES OF THE EINSATZSTAB REICHSLEITER ROSENBERG (ERR) AND THE POSTWARD RETRIEVAL OF ERR LOOT Patricia Kennedy Grimsted Revised and Updated Edition Chapter 10: United States of America (March 2015) Published on-line with generous support of the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference), in association with the International Institute of Social History (IISH/IISG), Amsterdam, and the NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies, Amsterdam, at http://www.errproject.org © Copyright 2015, Patricia Kennedy Grimsted The original volume was initially published as: Reconstructing the Record of Nazi Cultural Plunder: A Survey of the Dispersed Archives of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), IISH Research Paper 47, by the International Institute of Social History (IISH), in association with the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam, and with generous support of the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference), Amsterdam, March 2011 © Patricia Kennedy Grimsted The entire original volume and individual sections are available in a PDF file for free download at: http://socialhistory.org/en/publications/reconstructing-record-nazi-cultural- plunder. Also now available is the updated Introduction: “Alfred Rosenberg and the ERR: The Records of Plunder and the Fate of Its Loot” (last revsied May 2015). Other updated country chapters and a new Israeli chapter will be posted as completed at: http://www.errproject.org. The Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), the special operational task force headed by Adolf Hitler’s leading ideologue Alfred Rosenberg, was the major NSDAP agency engaged in looting cultural valuables in Nazi-occupied countries during the Second World War.