Sullivan-Journal Nr. 13 (Juli 2015)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Bible in Music
The Bible in Music 115_320-Long.indb5_320-Long.indb i 88/3/15/3/15 66:40:40 AAMM 115_320-Long.indb5_320-Long.indb iiii 88/3/15/3/15 66:40:40 AAMM The Bible in Music A Dictionary of Songs, Works, and More Siobhán Dowling Long John F. A. Sawyer ROWMAN & LITTLEFIELD Lanham • Boulder • New York • London 115_320-Long.indb5_320-Long.indb iiiiii 88/3/15/3/15 66:40:40 AAMM Published by Rowman & Littlefield A wholly owned subsidiary of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, Maryland 20706 www.rowman.com Unit A, Whitacre Mews, 26-34 Stannary Street, London SE11 4AB Copyright © 2015 by Siobhán Dowling Long and John F. A. Sawyer All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the publisher, except by a reviewer who may quote passages in a review. British Library Cataloguing in Publication Information Available Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Dowling Long, Siobhán. The Bible in music : a dictionary of songs, works, and more / Siobhán Dowling Long, John F. A. Sawyer. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8108-8451-9 (cloth : alk. paper) — ISBN 978-0-8108-8452-6 (ebook) 1. Bible in music—Dictionaries. 2. Bible—Songs and music–Dictionaries. I. Sawyer, John F. A. II. Title. ML102.C5L66 2015 781.5'9–dc23 2015012867 ™ The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI/NISO Z39.48-1992. -
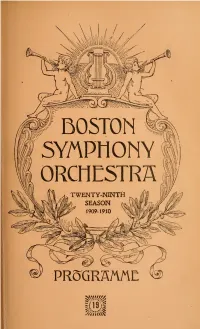
Progrmne the DURABILITY Of
PRoGRmnE The DURABILITY of PIANOS and the permanence of their tone quality surpass anything that has ever before been obtained, or is possible under any other conditions. This is due to the Mason & Hamlin system of manufacture, which not only carries substantial and enduring construction to its limit in every detail, but adds a new and vital principle of construc- tion— The Mason & Hamlin Tension Resonator Catalogue Mailed on Jtpplication Old Pianos Taken in Exchange MASON & HAMLIN COMPANY Establishea;i854 Opp. Institute of Technology 492 Boylston Street SYMPHONY HALL, BOSTON HUNTINGTON 6-MASSACHUSETTS AVENUES , ( Ticket Office, 1492 J Telephones_, , Back^ ^ Bay-d \ Administration Offices. 3200 \ TWENTY-NINTH SEASON, 1909-1910 MAX FIEDLER, Conductor prngramm^ of % Nineteenth Rehearsal and Concert WITH HISTORICAL AND DESCRIP- TIVE NOTES BY PHILIP HALE FRIDAY AFTERNOON, MARCH 18 AT 2.30 O'CLOCK SATURDAY EVENING, MARCH 19 AT 8.00 O'CLOCK COPYRIGHT, 1909, BY C. A. ELLIS PUBLISHED BY C. A.ELLIS, MANAGER 1417 Mme. TERESA CARRENO On her tour this season will use exclusively j^IANO. THE JOHN CHURCH CO. NEW YORK CINCINNATI CHICAGO REPRESENTED BY 6. L SGHIRMER & CO., 338 Boylston Street, Boston, Mass. Boston Symphony Orchestra PERSONNEL |J.M.^w^^w^»l^^^R^^^^^^^wwJ^^w^J^ll^lu^^^^wR^^;^^;^^>^^^>u^^^g,| Perfection in Piano Makinrf THE -^Mamtin Qaartcr Grand Style V, in figured Makogany, price $650 It is tut FIVE FEET LONG and in Tonal Proportions a Masterpiece of piano building^. It IS Cnickering & Sons most recent triumpLi, tke exponent of EIGHTY-SEVEN YEARS experience in artistic piano tuilding, and tlie lieir to all tne qualities tkat tke name of its makers implies. -

4373 MUSICAL-PT/Jr
C M Y K musical musicalVISITORS TO BRITAIN VISITORS musicalVISITORS Over the centuries Britain has attracted many musical visitors. This book tells the stories of the many composers who visited – a varied and often eccentric collection of individuals. lisztThe earliest were invited by royalty with musical tastes; some were refugees from religious TO and political oppressions; others came as spies, a few to escape from debt and even murder chopincharges. However, the main motive was a possibility of financial reward. BRITAIN The rise in the nineteenth century of the celebrity composer, who was often also a conductor, is also traced. With the development of new forms of transport, composers TO DAVID GORDON • PETER GORDON were able to travel more extensively, both from the Continent and from the USA. New BRITAIN wagneropportunities were also presented by the opening of public halls, where concerts could be held, as well as the growth of music festivals. In the twentieth and twenty-first centuries the aeroplane has enabled a regular influx of composers, and the book ends with a liszt consideration of the universalising of music as well as the impact of new forms, such as mozartjazz. chopin Musical Visitors to Britain is a fascinating book which should appeal to both the general handelreader and those with a special interest in music history. David Gordon is one of the leading harpsichordists in the UK, and performs with violinists wagner DAVID GORDON DAVID haydnAndrew Manze, Nigel Kennedy and the baroque orchestra English Concert, specialising in PETER GORDON improvisation. He is also a jazz pianist, and has given many workshops on aspects of Renaissance, baroque and jazz improvisation. -

Pierrot Lunaire
Words and Music Liverpool Music Symposium 3 Words and Music edited by John Williamson LIVERPOOL UNIVERSITY PRESS First published 2005 by LIVERPOOL UNIVERSITY PRESS 4 Cambridge Street, Liverpool L69 7ZU Copyright © Liverpool University Press 2005 All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publishers. British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data applied for 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ISBN 0-85323-619-4 cased Every effort has been made to contact copyright holders and the publishers will be pleased to be informed of any errors or omissions for correction in future editions. Edited and typeset by Frances Hackeson Freelance Publishing Services, Brinscall, Lancs Printed in Great Britain by MPG Books, Bodmin, Cornwall Contents Notes on Contributors vii Introduction John Williamson 1 1 Mimesis, Gesture, and Parody in Musical Word-Setting Derek B. Scott 10 2 Rhetoric and Music: The Influence of a Linguistic Art Jasmin Cameron 28 3 Eminem: Difficult Dialogics David Clarke 73 4 Artistry, Expediency or Irrelevance? English Choral Translators and their Work Judith Blezzard 103 5 Pyramids, Symbols, and Butterflies: ‘Nacht’ from Pierrot Lunaire John Williamson 125 6 Music and Text in Schoenberg’s A Survivor from Warsaw Bhesham Sharma 150 7 Rethinking the Relationship Between Words and Music for the Twentieth Century: The Strange Case of Erik Satie Robert Orledge 161 vi 8 ‘Breaking up is hard to do’: Issues of Coherence and Fragmentation in post-1950 Vocal Music James Wishart 190 9 Writing for Your Supper – Creative Work and the Contexts of Popular Songwriting Mike Jones 219 Index 251 Notes on Contributors Derek Scott is Professor of Music at the University of Salford. -

Bach Christmas Oratorio BWV 248 (Novello Edition Ed
PROGRAMME NOTES AND PREFACES Bach Christmas Oratorio BWV 248 (Novello edition ed. N. Jenkins) HISTORY AND ORIGINS OF THE WORK Although Bach's Christmas Oratorio (1734) has been as popular a work for choirs and choral societies to perform as his two Passions, it has striven against Handel's Messiah as the obvious work to choose for a Christmas performance. Its daunting length when performed uncut, and the need for a work with a less demanding orchestration (such as that found in Messiah) has probably meant that it has been chosen less often than it should have been. This may go some way to explain why there has been no new English edition since the original Novello Octavo edition, containing John Troutbeck's translation, of 1874. My researches in the British Library have turned up no other published translation apart from an incomplete version by Helen Johnston - also published in the year 1874. Helen Johnston (1813-87) was the first person to translate any of the major Bach choral works into English, producing her translation of the St Matthew Passion for Sir William Sterndale Bennett's 1862 edition. She does not appear to have turned her attention to the St John Passion, which was receiving frequent performances in England during the 1870s under the direction of Sir Joseph Barnby, since he used a translation made by a Minor Canon of Westminster Abbey - the Rev. John Troutbeck (1832-99). Troutbeck was an indefatigable translator, not only of all Bach's major choral works, but also of Oratorios by Beethoven, Brahms, Dvorak, Gounod, Liszt, Saint-Saens, Schumann and Weber. -

“What Language Shall I Borrow?” Singing in Translation
“WHAT LANGUAGE SHALL I BORROW?” SINGING IN TRANSLATION Daniel A. Mahraun Daniel A. Mahraun Choir Director Lutheran Church of the Holy Trinity Kailua-Kona, Hawaiʻi [email protected] 8 CHORAL JOURNAL Volume 56 Number 10 e have all likely done it at one time or another: we have conducted Wor sung works in translation. Our reasons probably varied. Perhaps we saw no point in teaching the original language to that particular choir. Perhaps we made the choice for the sake of a particular audience. Perhaps our decision was based solely on expediency. Regardless, any conscious or unconscious reason we had likely fl ew in the face of what many of us have heard or been taught: that the performance of vocal music in translation is a form of blasphemy. The late Roger Doyle made a case for singing in translation in his 1980 Choral Journal article, “What? Sing It in English? What Will the Neighbors Think?” In it, he bases his thoughts on the principal question of how to involve, to the fullest extent, the musicians and the listeners in a performance. Doyle lists what he saw as the four usual arguments against singing in translation then proceeds to reason them away. Those arguments are: 1) The nuance of the composer’s language is integral to the fl ow of the music. 2) Translations are provided in the printed programs. 3) The audience can’t understand the English either. 4) Good English versions are very scarce.1 “WHAT LANGUAGE SHALL I BORROW?” Though not advocating the use of English at all times 1) Singing in our native language saves rehearsal time. -

U.S. Sheet Music Collection
U.S. SHEET MUSIC COLLECTION SUB-GROUP I, SERIES 4, SUB-SERIES B (VOCAL) Consists of vocal sheet music published between 1861 and 1890. Titles are arranged in alphabetical order by surname of known composer or arranger; anonymous compositions are inserted in alphabetical order by title. ______________________________________________________________________________ Box 181 Abbot, Jno. M. Gently, Lord! Oh, Gently Lead Us. For Soprano Solo and Quartette. Harmonized and adapted from a German melody. Troy, NY: C. W. Harris, 1867. Abbot, John M. God Is Love. Trio for Soprano, Tenor, and Basso. Adapted from Conradin Kreutzer. New York: Wm. A. Pond & Co., 1865. Abbot, John M. Hear Our Prayer. Trio for Soprano, Contralto, and Basso. Brooklyn: Alphonzo Smith, 1862. Abbot, John M. Hear Our Prayer. Trio for Soprano, Contralto, and Basso. Brooklyn: Charles C. Sawyer, 1862. 3 copies. Abbot, John M. Hear Our Prayer. Trio for Soprano, Contralto, and Basso. Brooklyn: J. W. Smith, Jr., 1862. 3 copies. Abbot, John M. Softly now the light of day. Hymn with solos for Soprano, Tenor, and Contralto or Baritone. New York: S. T. Gordon, 1866. Abbott, Jane Bingham. Just For To-Day. Sacred Song for Soprano. Words by Samuel Wilberforce. Chicago: Clayton F. Summy Co., 1894. Abraham’s Daughter; or, Raw Recruits. For voice and piano. New York: Firth, Pond & Co., 1862. Cover features lithograph printed by Sarony, Major & Knapp. Abt, Franz. Absence and Return. For voice and piano. Words by J. E. Carpenter, PhD. From “New Songs by Franz Abt.” Boston: Oliver Ditson & Co., [s.d.]. Abt, Franz. Autumnal Winds (Es Braust der Herbstwind). Song for Soprano or Tenor in D Minor. -

Autumn 2014 Concert Programme
Dumfries Choral Society Autumn Concert Bach: Cantata No.140, “Sleepers, Wake!” Finzi: In Terra Pax Bach / Gounod: Ave Maria Gounod: St Cecilia Mass Organ: John Kitchen Piano: Margaret Harvie Conductor: Ian Hare Rebecca Tavener (Soprano) Malcolm Bennett (Tenor) Philip Gault (Bass) St John’s Church, Newall Terrace, Dumfries Saturday 15th November, 7.30pm www.dumfrieschoralsociety.co.uk Programme Scottish Charity Number SC002864 £1.50 ACKNOWLEDGEMENTS Honorary President: The Duchess of Buccleuch and Queensberry Scottish Charity No. SC002864 Website: www.dumfrieschoralsociety.co.uk Dumfries Choral Society, a member of Making Music Scotland, gratefully acknowledges the generous financial assistance and services given by the following Patrons, Friends, and Sponsors: Patrons Friends The Duchess of Buccleuch Mr & Mrs Peter Boreham Mr Ian P M Meldrum Mrs Margaret Carruthers Mrs Jessie Carnochan Mr & Mrs James More Mrs Barbara Kelly Mrs Mary Cleland Mr Hugh Norman Miss Gerry Lynch, MBE Mrs Maureen Dawson Mr & Mrs Frank Troup Mr J & Dr P McFadden Mrs Agatha Ann Graves Mr John Walker Rev & Mrs Andrew Mackenzie Mrs Nan Kellar Mrs Maxine Windsor Mrs Agnes Riley Mr A Hamish MacKenzie Mrs Jennifer Taylor Sponsors The Aberdour Hotel Barnhill Joinery Ltd Asher Associates Elite Display Barbours, Dumfries Weesleekit Web Design Dumfries Choral Society extends especial thanks to the Directors of Bibliographic Data Services – a local employer serving global markets – for their extremely generous assistance with the creation of the Society’s new website. If you would like information about becoming a Friend, Patron, or Sponsor of Dumfries Choral Society, please contact the Patrons’ Secretary, Mrs Sheena Meek (07753 824073), or visit the website at: www.dumfrieschoralsociety.co.uk The Society gratefully acknowledges a generous donation received from the Buccleuch Charitable Trust. -

Mr Troutbeck As the Surgeon's Friend: the Coroner and the Doctors- an Edwardian Comedy
Medical History, 1995, 39: 259-287 Mr Troutbeck as the Surgeon's Friend: The Coroner and the Doctors- An Edwardian Comedy D ZUCK* On 17 May 1902, at the age of 48, after a brief illness, pneumonia, Athelston Braxton Hicks, coroner for the South-Western District of London and the Kingston District of Surrey, died.1 He was the son of the eminent obstetrician and gynaecologist, consultant to Guy's and St Mary's Hospitals, whose name is still attached to the irregular painless uterine contractions that occur during pregnancy.2 Originally he had been intended for the medical profession, and had been a student at Guy's for several years. He had been called to the bar in 1875, had been coroner for 17 years, and deputy before that. He had performed good public service in many ways. He had secured the regulation of the licensing of small boats, and of the sale of carbolic acid. He had campaigned against the evils of baby farming, and for fireguards in homes where there were small children. He was an authority on coroner's law, had been a very distinguished secretary and vice- president of the Coroner's Society, and had served on the Joint Committee of the British Medical Association and the Coroner's Society. "Though a member of the legal profession", in the words of his obituarist, he had taken a great interest in medical questions affecting his office. Many coroners and doctors attended his funeral, and the Medical Defence Union was represented. Had the term carried its present-day connotation, the Association, which was campaigning for the appointment of medically qualified coroners, might well have described him as "one of us". -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 29,1909-1910, Trip
THE LYRIC THEATRE . BALTIMORE Twenty-ninth Season, J909-J9J0 MAX FIEDLER, Conductor Programme nf % Fifth and Last Concert WITH HISTORICAL AND DESCRIP- TIVE NOTES BY PHILIP HALE WEDNESDAY EVENING, MARCH 23 AT 8.15 COPYRIGHT, 1909, BY C. A. ELLI8 PUBLISHED BY C. A. ELLIS, MANAGER Mme. TERESA CARRENO On her tour this season will use exclusively Piano. THE JOHN CHURCH CO. NEW YORK CINCINNATI CHICAGO REPRESENTED BY THE KRANZ-SMITH PIANO CO. 100 North Charles Street Boston Symphony Orchestra PERSONNEL Twenty-]ainth Season, 1909-1910 MAX FIEDLER, Conductor First Violins. Hess, Willy Roth, O. Hoffmann, J. Krafft, W. Concertmaster. Kuntz, D. Fiedler, E. Theodorowica, J. Noack, S. Mahn, F. Eichheim, H Bak, A. Mullaly, J. Strube, G. Rissland, K. Ribarscb, A. Traupe, W. Second Violins. Barleben, K. Akeroyd, J. Fiedler, B. Berger, H. Fiumara, P. Currier, F. Marble, E. Eichler, J. Tischer-Zeitz, H. Kuntz, A. Goldstein, H. Goldstein, S Kurth, R. Werner, H. Violas. Fenr, E. Heindl, H. Rennert, B. Kolster, A. Zahn, F. Gietzen, A. Hoyer, H. Kluge, M. Forster, E. Kautzenbach, W Violoncellos. Warnke, H. Nagel, R. Barth, C. Belinski, M. Warnke, J. Keller, J. Kautzenbach, A. Nast, L. Hadley, A. Smalley, R. Basses. Keller, K. Agnesy, K. Seydel, T. Ludwig, O. Gerhardt, G. Kunze, M. Huber, E. Schurig, R. Flutes. Oboes. Clarinets. Bassoons* Maquarre, A. Longy, G. Grisez, G. Sadony, P. Brooke, A. Lenom, C. Mimart, P. Mueller, E. Battles, A. Sautet, A. Vannini, A. Regestein, E. Fox, P. English Horn. Bass Clarinet. Contra-Bassoon. Mueller, F. Stumpf, K. Helleberg, J. Horns. Horns. Trumpets. Trombones, . -

Johann Sebastian Bach's St John Passion (BWV 245): A
Johann Sebastian Bach’s St John Passion (BWV 245): A Theological Commentary Studies in the History of Christian Traditions Editor in Chief Robert J. Bast (Knoxville, Tennessee) In cooperation with Paul C.H. Lim (Nashville, Tennessee) Eric Saak (Liverpool) Christine Shepardson (Knoxville,Tennessee) Brian Tierney (Ithaca, New York) Arjo Vanderjagt (Groningen) John Van Engen (Notre Dame, Indiana) Founding Editor Heiko A. Oberman † volume 168 The titles published in this series are listed at brill.com/shct Johann Sebastian Bach’s St John Passion (BWV 245): A Theological Commentary With a New Study Translation by Katherine Firth and a Foreword by N.T. Wright By Andreas Loewe leiden | boston Cover illustration: High Altar Reredos of St Paul’s Cathedral in Melbourne, Australia. Photo by Dr Carsten Murawski. Courtesy of St Paul’s Cathedral. This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, ipa, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface. issn 1573-5664 isbn 978 90 04 26547 9 (hardback) isbn 978 90 04 27236 1 (e-book) Copyright 2014 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Nijhoff, Global Oriental and Hotei Publishing. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill nv provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, ma 01923, usa. -
Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 99, 1979-1980
H^l eleven 99th SEASON *^«?s &%^ >) BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA SEIJI OZAWA Music Director — ^ <f mm V.S.O.t* 11 <s$Utt&>ft&ndm enf7%r mvH^ 6' £0. V&QP COGNAC FRANCE ***&£''* ISO ifcitoiSOTTLKO HY F BPMV MARTIN NE CHAMPAGNE COGW THE FIRST NAME IN COGNAC SINCE 172 FINE CHAMPAGNE COGNAC: FROM QUALITY: A DISTINGUISHING ATTRIBUTE State Street Bank and Trust Company unites you to an evening with The Boston Symphon) Orchestra every Friday at nine on WCRB/IM. Seiji Ozawa, Music Director Colin Davis, Principal Guest Conductor Joseph Silverstein, Assistant Conductor Ninety-Ninth Season 1979-80 The Trustees of the Boston Symphony Orchestra Inc. Talcott M. Banks, Chairman Nelson J. Darling, Jr., President Philip K. Allen, Vice-President Sidney Stoneman, Vice-President Mrs. Harris Fahnestock, Vice-President John L. Thorndike, Vice-President Roderick M. MacDougall, Treasurer Vernon R. Alden Archie C. Epps III Thomas D. Perry, Jr. Allen G. Barry E. Morton Jennings, Jr. Irving W. Rabb LeoL. Beranek Edward M. Kennedy Paul C. Reardon Mrs. John M. Bradley George H. Kidder David Rockefeller, Jr. George H.A. Clowes, Jr. Edward G. Murray Mrs. George Lee Sargent Abram T. Collier Albert L. Nickerson John Hoyt Stookey Trustees Emeriti Richard P. Chapman John T. Noonan Mrs. James H. Perkins Administration of the Boston Symphony Orchestra Thomas W. Morris General Manager Peter Gelb Gideon Toeplitz Daniel R. Gustin Assistant Manager Orchestra Manager Assistant Manager Joseph M. Hobbs Walter D.Hill William Bernell Director of Director of Assistant to the Development Business Affairs General Manager Lawrence Murray Dorothy Sullivan Anita R.