Struktur- Und Funktionsanalyse Von Corporate Social Responsibility
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ne Xamax FC BASEL 1893 Dimanche 14 Fevrier 2010 STADE DE LA MALADIÈRE À 16H00
N° 28, saison 2009/10 Axpo Super League NE XAMAX FC BASEL 1893 DIMANCHE 14 FEVriER 2010 STADE DE LA MALADIÈRE À 16H00 Shkelzen Gashi EDITORIAL Après deux mois d’interruption, la compétition a enfin recommencé. La préparation hivernale s’est très bien déroulée, avec un stage d’oxy- génation à Couvet (magnifiques installations et accueil extraordinaire), trois matches amicaux en Suisse (une victoire et deux nuls), un stage de 10 jours en Espagne où l’équipe a pu s’entraîner dans d’excellentes conditions. Durant cette pause, le mercato (au 1er février) a été actif au sein du club. Nos deux attaquants Brown et Gavranovic vont poursuivre leur aventure à l’étranger. Nous leur souhaitons plein succès. Cordiale bienvenue au nouveau centre-avant Sanel Kuljic, appelé pour entourer nos jeunes joueurs et faire trembler les filets adverses. La convoitise de nos joueurs démontre l’excellence du travail effectué par Pierre-André Schurmann et toute son équipe. C’est clair il faut repartir, relancer la machine, mais tous ensemble avec vous également cher public, cette deuxième phase peut nous donner de grandes satisfactions. Bienvenue au FC Bâle ce jour de la Saint-Valentin. Belle Fête aux Amoureux en espérant que Xamax pourra vous donner un joli cadeau, sous la forme de trois points bien emballés avec du papier de soie rouge et noir. Au nom de la Direction Philippe Salvi 3 IMPRESSUM SOMMAIRE Editeur 3 Editorial Neuchâtel Xamax S.A. Quai Robert-Comtesse 3 Case postale 2749 5 Impressum 2001 Neuchâtel Sommaire Tél. 032 725 44 28 [email protected] 7-11 Entraîneurs/Joueurs www.xamax.ch Marketing 12-13 Des nouvelles de PRO’IMAX SA la relève Quai Robert-Comtesse 3 2000 Neuchâtel 15 Photo Souvenir PARTAGER DES Tél. -

Abschiedsspiel Birgit Prinz Frauen-Nationalmannschaft 1.FFC Frankfurt
OFFIZIELLES MAGAZIN DER DEUTSCHEN FRAUEN-NATIONALMANNSCHAFT • 1/2012 • SCHUTZGEBÜHR 1.- € Abschiedsspiel Birgit Prinz Frauen-Nationalmannschaft 1.FFC Frankfurt Volksbank-Stadion Frankfurt 27.03.2012 www.dfb.de www.fussball.de 20 Jahre Partnerschaft Hol‘ Dir Dein offizielles DFB-Fan-Shirt zur EM! Jetzt Kassenbons von 8 Kästen Bitburger sammeln und gratis Dein individuelles DFB-Fan-Shirt sichern,* mit Deinem Namen, Deiner Wunschnummer und den gedruckten Unterschriften unserer Nationalmannschaft. Erhältlich ist es in zwei Größen. Mach mit! Alle Infos auf www.bitburger.de. Deutschland feiert die EM mit Bitburger – dem Bier unserer Nationalmannschaft und ihrer Fans. *20 x 0,5-l oder 24 x 0,33-l Bitburger (alle Sorten, kein Stubbi). Sammelzeitraum 19.03. bis 12.05.2012. Einsendeschluss ist der 14.05.2012. Tipp: Kassenbons bis zum 7. Mai einschicken und Shirt garantiert zum ersten Deutschland-Spiel erhalten! Teilnahme ab 18 Jahren. Erlebe jetzt den TV-Spot mit der Nationalmannschaft. Scanne diesen QR-Code mit einer Smartphone-App. wwww.bitburger.deww.bitburger.de Liebe Fans, ich bin kein Mensch der großen Worte. Daran wird sich auch anlässlich meines Abschiedsspiels nichts ändern. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich aus drücklich bei Euch zu bedanken. Schließlich wart Ihr für mich auch Weggefährtinnen und -gefährten während meiner gesamten Karriere. Rückblickend kann ich sagen, dass es kein Spiel ohne Unterstützung von Euch gab. Überall und zu jeder Gelegenheit habe ich diese Begleitung wahrgenommen – Fahnen, Schals, Trikots gesehen oder Anfeuerung, Aufmunterung, Ermutigung gehört. Und zwar nicht nur bei den großen Spielen bei Welt- oder Europameisterschaften, Endspielen um den UEFA-Cup oder den DFB-Pokal, sondern auch bei Testspielen in kleineren Städten. -

Frauen-Bundesliga Extra • Schutzgebühr 1.- €
OFFIZIELLES MAGAZIN DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES • FRAUEN-BUNDESLIGA EXTRA • SCHUTZGEBÜHR 1.- € Frauen-Bundesliga www.dfb.de www.fussball.de all passion facebook.com/adidasfootball Liebe Freunde des Fußballs, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011 hat dem Frauenfußball in Deutschland eine enorme Aufmerksamkeit gebracht. 782.000 Zuschauer haben die Spiele live in den Stadien verfolgt, zudem haben das Fernsehen, der Hörfunk und die Presse umfangreich über das Turnier berichtet. Allein die wunderbaren TV-Einschaltquoten dokumentieren, mit welchem Interesse das Thema verfolgt wurde. All dies spiegelt eine sensationelle Rückmeldung für unseren Sport wider, aus der jeder, der sich in der Frauen-Bundesliga engagiert, neue Motivation für die Zukunft ziehen kann. Denn mit dem Start der Frauen-Bundesliga in die Saison 2011/2012 bietet sich die nächste Möglichkeit, den Frauenfußball von seiner schönsten Seite zu präsentieren. Schließlich steht diese Spielklasse für hochwertigen und attraktiven Sport. Auch wenn es der DFB- Auswahl nicht gelungen ist, den Traum vom dritten WM-Titelgewinn in Folge zu ver - wirklichen, bleibt die Bundesliga die Liga der Weltmeisterinnen. Nicht nur weil weiterhin viele Spielerinnen aktiv sind, die zu den WM-Triumphen 2003 und 2007 beigetragen haben, sondern auch weil in Saki Kamagui, Yuki Nagasato und Kozue Ando mittlerweile drei japanische Weltmeisterinnen ihre fußballerische Heimat in Deutschland gefun - den haben. Ihre Wechsel zu den Klubs der Frauen-Bundesliga sprechen für das Ansehen und die Leistungsstärke unserer Vereine. Das wird natürlich insbesondere durch die Vergleiche auf internationaler Ebene dokumentiert. Die Erfolge der deutschen Vertreter in der UEFA Women’s Champions League sind ein starkes Argument. In den zehn Jahren seit Bestehen des Wettbewerbs standen deutsche Klubs acht Mal im Endspiel und konnten sechs Mal den Titel gewinnen. -

Italy Germany
MATCH REPORT Final tournament - Group phase - Group B Thursday, 9 June 2005 - 17:15 (local time) Deepdale - Preston ITALY GERMANY 0 (0) (2) 4 1 Carla Brunozzi (GK) 1 Silke Rottenberg (GK) 3 Tatiana Zorri 2 Kerstin Stegemann 4 Sara Di Filippo 4 Stephanie Jones 5 Elisabetta Tona (C) 9 Birgit Prinz (C) 9 Patrizia Panico 10 Renate Lingor 10 Elisa Camporese 11 Anja Mittag 11 Ilaria Pasqui 13 Sandra Minnert 13 Gioia Masia 14 Britta Carlson 15 Viviana Schiavi 16 Conny Pohlers 16 Elena Ficarelli 17 Ariane Hingst 18 Pamela Conti 18 Kerstin Garefrekes 2 Giulia Domenichetti 3 Sonja Fuss 6 Giulia Perelli 5 Sarah Günther 7 Chiara Gazzoli 6 Inka Grings 8 Damiana Deiana 7 Pia Wunderlich 12 Michela Cupido (GK) 8 Sandra Smisek 14 Valentina Lanzieri 12 Ursula Holl (GK) 17 Melania Ganniadini 15 Nadine Angerer (GK) 19 Valentina Boni 19 Navina Omilade 20 Chiara Marchitelli (GK) 20 Petra Wimbersky Coach Coach Carolina Morace Tina Theune-Meyer Referee Fourth official Kari Seitz (USA) Amy Rayner (ENG) Assistant referees UEFA delegate Andi Regan (NIR) Bontcho Todorov (BUL) Elke Lüthi (SUI) 20:14:44 (C) Captain (GK) Goalkeeper 9/6/2005 uefa.com Matchday 4 - Group B - Thursday, 9 June 2005 - MATCH REPORT ITALY GERMANY 0 (0) (2) 4 11' 9 Birgit Prinz 18' 16 Conny Pohlers 19' 6 Inka Grings (in) 2 Kerstin Stegemann (out) 10 Elisa Camporese 27' 13 Gioia Masia 35' 8 Damiana Deiana (in) 46' 15 Viviana Schiavi (out) 49' 16 Conny Pohlers 2 Giulia Domenichetti (in) 51' 18 Pamela Conti (out) 55' 4 Stephanie Jones 74' 11 Anja Mittag 19 Valentina Boni (in) 75' 3 Tatiana Zorri (out) 77' 8 Sandra Smisek (in) 11 Anja Mittag (out) 4 Sara Di Filippo 81' Disclaimer: The statistics provided herewith are for information purposes only and are NOT the official UEFA match statistics. -

Match Report
FIFA Women's World Cup China 2007 Match Report Final Germany - Brazil 2:0 (0:0) Match Date Venue / Stadium / Country Time Att. 32 30 SEP 2007 Shanghai / Shanghai Hongkou Football Stadium / CHN 20:00 31000 sold out Match Officials: Referee: Tammy OGSTON (AUS) Assistant Referee 1: Maria Isabel TOVAR (MEX) 4th Official: Mayumi OIWA (JPN) Assistant Referee 2: Rita MUNOZ (MEX) Match Commissioner: Janine HELLAND (CAN) General Coordinator: Jeannette SAARINEN (FIN) Goals Scored: Birgit PRINZ (GER) 52' , Simone LAUDEHR (GER) 86' Germany (GER) Brazil (BRA) [ 1] Nadine ANGERER (GK) [ 1] ANDREIA (GK) [ 2] Kerstin STEGEMANN [ 2] ELAINE [ 5] Annike KRAHN [ 3] ALINE (C) (-88') [ 6] Linda BRESONIK [ 4] TANIA (-81') [ 7] Melanie BEHRINGER (-74') [ 5] RENATA COSTA [ 8] Sandra SMISEK (-80') [ 7] DANIELA [ 9] Birgit PRINZ (C) [ 8] FORMIGA [ 10] Renate LINGOR [ 9] MAYCON [ 14] Simone LAUDEHR [ 10] MARTA [ 17] Ariane HINGST [ 11] CRISTIANE [ 18] Kerstin GAREFREKES [ 20] ESTER (-63') Substitutes: Substitutes: [ 3] Saskia BARTUSIAK [ 6] ROSANA (+63') [ 4] Babett PETER [ 12] BARBARA (GK) [ 11] Anja MITTAG [ 13] MONICA [ 12] Ursula HOLL (GK) [ 14] GRAZIELLE [ 13] Sandra MINNERT [ 15] KATIA (+88') [ 15] Sonja FUSS [ 16] SIMONE [ 16] Martina MUELLER (+74') [ 17] DAIANE [ 19] Fatmire BAJRAMAJ (+80') [ 18] PRETINHA (+81') [ 20] Petra WIMBERSKY [ 19] MICHELE [ 21] Silke ROTTENBERG (GK) [ 21] THAIS (GK) Coach: Silvia NEID (GER) Coach: Jorge BARCELLOS (BRA) Cautions: Kerstin GAREFREKES (GER) 7' , DANIELA (BRA) 59' , Linda BRESONIK (GER) 63' Expulsions: Additional Time: First half: 1 min., second half: 4 min. N: Not Eligible to Play I: Injured A: Absent 2Y: Second yellow card (C): Captain Att: Attendance AET: After extra time GK Goalkeeper PSO: Penalty shoot-out SUN 30 SEP 2007; 15:54 CET / 21:54 local time - Version 1 Page1/2 FIFA Women's World Cup China 2007 Game Statistics Final Germany - Brazil 2:0 (0:0) Match Date Venue / Stadium / Country Time Att. -

Genie Im Konflikt Diego
RUND > DAS FUSSBALLMAGAZIN_Nr. 20, MÄRZ 2007 2,80€ Nr. 20, MÄRZ 2007 20, Nr. RUND FUSSBALLMAGAZIN DAS WWW.RUND-MAGAZIN.DE DAS FUSSBALLMAGAZIN RUND Schalke 04 Darüber streiten die Altintop-Zwillinge Dopingtest Wenn Profi s nicht pinkeln können Hansa Rostock Reportage: Ein Klub überrascht sich selbst Diego: Genie im Konfl ikt Wie der Vater die Karriere des Bremer Stars gefährdet Schweiz_5,50sfr_Österreich_3,20€_Luxemburg_3,20€_Spanien_3,80€_Griechenland_4,00€_Italien_3,80€ rrund0307_001_Titel.inddund0307_001_Titel.indd 1 008.02.20078.02.2007 221:13:161:13:16 UUhrhr RUND Einlaufen LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, der Bremer Diego war der überragende Spieler der Hinrunde in der Schleswig-Holsteins: in Wakendorf II, 1400 Einwohner, rund 40 Ki- Fußballbundesliga. Zu rechnen war damit nicht, schließlich kam der lometer nördlich von Hamburg. RUND hat genau dies erkannt und ist Brasilianer bei seinem letzten Klub, dem FC Porto, nur unregelmäßig ab sofort Hauptsponsor der G-Jugend-Mannschaft des TuS Wakendorf- zum Einsatz und saß dort monatelang auf der Tribüne. Angeblich pass- Götzberg. Mit Hilfe eines ausgeklügelten und fl ächendeckenden Sich- te er nicht in das taktische Konzept von Trainer Co Adriaanse. In Bre- tungssystems wurden die besten Vier- bis Siebenjährigen des Dorfes men musste der 22-Jährige die Nachfo lge von Werder-Dirigent Johan gescoutet. Doch überzeugen Sie sich selbst: Unsere große Fotostrecke Micoud antreten, was ihm viele Skeptiker nicht zugetraut hatten. Aber ab Seite acht zeigt, wie sich das RUND-Perspektivteam auf die Welt- Diego hat sich im kalten Bremen gut zurechtgefunden, wenn ihn auch meisterschaft 2026 vorbereitet. heute noch der Alltag im Norden Deutschlands vor Rätsel stellt. -

2009 Uefa European Women's Championship Match Press Kit
2009 UEFA EUROPEAN WOMEN'S CHAMPIONSHIP MATCH PRESS KIT Germany Italy Lahti Stadium, Lahti Friday 4 September 2009 - 15.00CET (16.00 local time) Matchday 4 - Quarter-finals Contents Match background.........................................................................................2 Team facts.....................................................................................................2 Squad list.......................................................................................................5 Match-by-match lineups................................................................................7 Tournament schedule....................................................................................9 Head coach..................................................................................................11 Competition facts..........................................................................................12 Tournament information................................................................................14 Legend.........................................................................................................15 Germany v Italy Friday 4 September 2009 - 15.00CET (16.00 local time) MATCH PRESS KIT Lahti Stadium, Lahti Match background There will be a repeat of the 1997 final when UEFA European Women's Championship holders Germany play Italy at Lahti Stadium on Friday. • Germany, aiming for a fifth straight title, stormed through Group B, beating Norway 4-0, France 5-1 and – after having already clinched -

German Bundesliga 1 1995-96
BORUSSIA DORTMUND Bundesliga 1 1995-96 Home Attack 2.65 Home Defence 0.82 Away Attack 1.82 Away Defence 1.41 Goalkeeper STEFAN KLOS (97) WOLFGANG DE BEER (99) HARALD SCHUMACHER (100) Penalty Taker STEFAN REUTER (60) ANDREAS MOLLER(80) MICHAEL ZORC (100) MICHAEL ZORC 20 RUBEN SOSA 87 HEIKO HERRLICH 30 STEFFEN FREUND 90 ANDREAS MOLLER 40 JORG HEINRICH 93 KARLHEINZ RIEDLE 50 JULIO CESAR 96 LARS RICKEN 58 RENE TRETSCHOK 99 JURGEN KOHLER 65 CARSTEN WOLTERS 100 PATRIK BERGER 71 STEPHANE CHAPUISAT 75 STEFAN REUTER 79 MATTHIAS SAMMER 83 FC BAYERN MUNCHEN Bundesliga 1 1995-96 Home Attack 2.06 Home Defence 1.18 Away Attack 1.82 Away Defence 1.53 Goalkeeper OLIVER KAHN (94) MICHAEL PROBST(97) SVEN SCHEUR (100) Penalty Taker MEHMET SCHOLL (50) JURGEN KLINSMANN (100) JURGEN KLINSMANN 22 ANDREAS HERZOG 90 ALEXANDER ZICKLER 35 JEAN-PIERRE PAPIN 93 MEHMET SCHOLL 47 CIRIOCO SFORZA 96 EMIL KOSTADINOV 55 OLIVER KREUZER 98 THOMAS HELMER 62 LOTHAR MATTHAUS 100 CHRISTIAN NERLINGER 69 THOMAS STRUNZ 76 CHRISTIAN ZIEGE 81 MARKUS BABBEL 84 DIETMAR HAMANN 87 FC SCHALKE 04 Bundesliga 1 1995-96 Home Attack 1.65 Home Defence 0.94 Away Attack 1.00 Away Defence 1.18 Goalkeeper JENS LEHMANN (94) JORG ALBRECHT (100) Penalty Taker INGO ANDERBRUGGE MARTIN MAX 28 ANDREAS MULLER 98 YOURI MULDER 53 UWE WEIDEMANN 100 INGO ANDERBRUGGE 66 THOMAS LINKE 73 OLAF THON 80 MICHAEL BUSKENS 85 DAVID WAGNER 90 TOM DOOLEY 92 WALDEMAR KSIENZYK 94 RADOSLAV LATAL 96 BORUSSIA MONCHENGLADBACH Bundesliga 1 1995-96 Home Attack 1.71 Home Defence 1.29 Away Attack 1.35 Away Defence 1.71 Goalkeeper -

150518 ESC Gebaerdensprache
Südwestrundfunk Presseinformation Anstalt des öffentlichen Rechts Johanna Leinemann Pressestelle Hans-Bredow-Straße 76530 Baden-Baden Telefon 07221 929-22285 18. Mai 2015 Telefax 07221 929-26318 [email protected] An die Redaktionen Fernsehen, Jugend SWR.de/presse 60. „Eurovision Song Contest“ in internationaler Gebärdensprache EinsPlus überträgt den „Eurovision Song Contest 2015“ live aus Wien im TV und als Stream auf EinsPlus.de in internationaler Gebärdensprache / Am 19., 21., und 23. Mai 2015 Der 60. Eurovision Song Contest im Mai steht unter dem Motto „Building Bridges“: „Brücken bauen“ – auch über sprachliche Grenzen hinweg. Zum ersten Mal wird die größte TV- Unterhaltungsshow der Welt in Internationaler Gebärdensprache gezeigt. EinsPlus übernimmt das einzigartige Angebot des ORF und zeigt die beiden Halbfinale und das Finale am Dienstag, 19., Donnerstag, 21., und Samstag, 23. Mai 2015, live aus Wien jeweils um 21 Uhr, sowie als Livestream auf EinsPlus.de. Alle Songs werden in Internationale Gebärdensprache übertragen und von gehörlosen Performerinnen und Performern präsentiert, die Bühnen-Moderationen werden von Gebärdendolmetschern live in die Internationale Gebärdensprache übersetzt. Über mehrere Wochen hinweg haben die Dolmetscher die Songs der insgesamt 40 Teilnehmerländer einstudiert. Dabei haben sie nicht nur an einer wörtlichen Übersetzung der Liedtexte gearbeitet, sondern auch jeweils eine eigene Dramaturgie entwickelt. So sollen Gefühl und Geist jedes einzelnen Songs spürbar und erlebbar werden. Teamleader und Choreograf ist der hörende österreichische Gebärdensprachdolmetscher Delil Yilmaz, der von zwei gehörlosen Gebärdensprachdolmetschern unterstützt wird. Der ESC überschreitet im Jubiläumsjahr noch mehr Grenzen: Zum ersten Mal ist auch Australien dabei und hat seinen Startplatz im Finale sicher. Auch das Gastgeberland Österreich sowie die „Big Five“, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien, werden dabei sein. -

Betze × Dresden Hauptpartner 3
ITN #01 × 2020/21 FR. 18.09.2020, 17 .45 UHR BETZE × DRESDEN HAUPTPARTNER 3. LIGA INHALT Allgäuer Latschenkiefer Mobil Gel ist ein Spezialkosmetikum mit dem Original Allgäuer Latschenkiefernöl, wertvollem Beinwell- und Arnikaextrakt zur Einreibung und Massage. Das natürliche Pfl ege-Gel enthält zusätzlich eine Kombination aus Allantoin, Panthenol, Salbei- und Rosmarinöl. Durch die Einreibung und Massage werden beanspruchte Muskeln entspannt. Ihr körperliches Wohlbefi nden verbessert sich, gleichzeitig wird Ihre Haut gepfl egt. Dr. Theiss Naturwaren GmbH | 66424 Homburg | www.latschenkiefer.de INHALT LIEBE FCK-FANS, nach monatelanger Wartezeit dürfen wir an diesem Frei- gegensätzlich anfühlen, möchten wir auch hier noch- tagabend erstmals wieder fast 5.000 von Euch auf dem mal an Euch appellieren, die behördlichen Vorgaben Betzenberg begrüßen. Die Freude darüber ist natürlich umzusetzen und so sicherzustellen, dass auch in den riesig. Denn gerade die Atmosphäre von den Rängen ist kommenden Wochen weiterhin viele Fans die Möglich- es, warum die Roten Teufel an jedem Wochenende Fuß- keit haben, tolle Spiele auf dem Betzenberg zu erleben. ball spielen. Dennoch ist klar, dass wir mit diesem ersten Und mit den Begegnungen gegen Dresden, Mannheim, Schritt noch nicht wieder bei der Normalität angelangt Ingolstadt und Rostock warten zu Saisonbeginn auch sind. Mitten in der Corona-Pandemie ermöglicht es der gleich einige klangvolle Partien in den Heimspielen auf Sonderspielbetrieb aber zumindest, wieder schrittweise dem Betzenberg Fans ins Stadion zu lassen. Dies gelingt jedoch nur, wenn Wir hoffen, Ihr freut Euch genauso darüber, dass es alle die Veränderungen und Einschnitte, die dies mit sich jetzt wieder richtig losgeht wie wir. Lasst uns alle bringt, akzeptieren und sich an die Regeln halten. -

BORUSSIA DORTMUND Bundesliga 1 1996-97
BORUSSIA DORTMUND Bundesliga 1 1996-97 Home Attack 2.24 Home Defence 0.76 Away Attack 1.47 Away Defence 1.65 Goalkeeper STEFAN KLOS Penalty Taker MICHAEL ZORC (60) STEPHANE CHAPUISAT (100) STEPHANE CHAPUISAT 18 IBRAHIM TANKO 88 HEIKO HERRLICH 31 VLADIMIR BUT 90 KARLHEINZ RIEDLE 43 JOVAN KIROVSKI 92 ANDREAS MOLLER 52 PAUL LAMBERT 94 JORG HEINRICH 59 PAULO SOUSA 96 MICHAEL ZORC 66 KNUT REINHARDT 98 JULIO CESAR 71 STEFAN REUTER 100 RENE TRETSCHOK 76 JURGEN KOHLER 80 LARS RICKEN 84 FC BAYERN MUNCHEN Bundesliga 1 1996-97 Home Attack 2.18 Home Defence 0.71 Away Attack 1.82 Away Defence 1.29 Goalkeeper OLIVER KAHN (94) SVEN SCHEUR (100) Penalty Taker MARIO BASLER JURGEN KLINSMANN 23 DIETMAR HAMANN 94 RUGGIERO RIZZITELLI 33 CARSTEN JANCKER 96 ALEXANDER ZICKLER 43 LOTHAR MATTHAUS 98 CHRISTIAN ZIEGE 53 THOMAS STRUNZ 100 MARIO BASLER 62 CHRISTIAN NERLINGER 70 MEHMET SCHOLL 78 THOMAS HELMER 84 MARCEL WITECZEK 89 MARKUS BABBEL 92 FC SCHALKE 04 Bundesliga 1 1996-97 Home Attack 1.12 Home Defence 0.82 Away Attack 0.94 Away Defence 1.53 Goalkeeper JENS LEHMANN Penalty Taker INGO ANDERBRUGGE MARTIN MAX 37 OLIVER HELD 100 MARC WILMOTS 55 YOURI MULDER 64 INGO ANDERBRUGGE 70 TOM DOOLEY 76 RADOSLAV LATAL 82 OLAF THON 88 MICHAEL BUSKENS 91 JOHAN DE KOCK 94 YVES EIGENRAUCH 97 BORUSSIA MONCHENGLADBACH Bundesliga 1 1996-97 Home Attack 2.00 Home Defence 1.00 Away Attack 0.71 Away Defence 1.82 Goalkeeper UWE KAMPS Penalty Taker IOAN LUPESCU MARTIN DAHLIN 25 IOAN LUPESCU 94 ANDRZEJ JUSKOWIAK 45 PETER NIELSEN 96 JORGEN PETTERSSON 63 STEPHAN PASSLACK 98 MARCO VILLA -
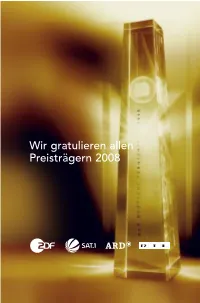
Layout 2005 Lay 01
Wir gratulieren allen Preisträgern 2008 Editorial „Zehn Jahre schon!“ Zehn Jahre schon! DER DEUTSCHE FERNSEHPREIS, diese singuläre, gemeinsame Stiftung der großen Vier, die ansonsten Konkurrenten sind und bleiben, kann ein kleines Jubiläum feiern und eine Zwischenbilanz ziehen. Gut für einige Genugtuung. Der Deutsche Fernsehpreis 2008 Seite 5 Denn was die Initiatoren des Preises mit dem DEUTSCHEN FERNSEHPREIS im Sinn hatten, ließ sich – nicht immer habe sich das immer noch populärste leicht – tatsächlich realisieren: das Pro- Medium eine praktische Möglichkeit grammschaffen eines ganzen Jahres und verschafft, seinen Standard und seine sämtlicher Sparten und Genres von einer Standards zu befragen und im Sinne souveränen Jury darauf prüfen und be- eines Siegels zu bezeugen. werten zu lassen, was es an exemplari- scher Exzellenz hervorgebracht habe. Eine wertvolle Möglichkeit, meine ich, Und so das Ausgezeichnete und die Aus- gerade jetzt. Die Medienzukunft ist be- gezeichneten auszuzeichnen, vor dem kanntlich los. Heißt auch, was als Infor- großen Publikum, dem schließlich alle mation und Unterhaltung Bestand haben Qualitätsbemühung zu gelten hat. will und Bestand haben soll, wird ent- schiedener denn je mit der Qualitäts- Und nun, eine Dekade nach Gründung, markenfrage belegt. Das Fernsehen, steht der Preis als medienkulturelle öffentlich-rechtlich oder privat, ist also Errungenschaft da, als beachtete und, ausweispflichtig. Es sollte sich, anders aber klar, auch kritisch betrachtete ausgedrückt, berufen können und eben Institution! nicht nur auf sich selbst. Begehrt ist der Preis und beliebt. Man DER DEUTSCHE FERNSEHPREIS, unab- möchte ihn haben und man möchte im hängig, wie er sich versteht, kommt ihm Saal wie vorm Bildschirm dabei sein, da entgegen und gelegen.