Im Westerwald 941
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

RB 90: Westerburg – Au(Sieg) Fahrplanänderungen Vom 05.09 – 24.10.2020
Fahrgastinfo RB 90: Westerburg – Au(Sieg) Fahrplanänderungen vom 05.09 – 24.10.2020 Sehr geehrte Reisende, im Zeitraum 04.09.2020, 22:00 Uhr bis 25.10.2020, 02:00 Uhr führt die DB Netz AG durchgehend Bauarbeiten zwischen Au(Sieg) und Betzdorf(Sieg) durch. Es finden Gleis- und Hangsicherungsarbeiten statt. Diese Arbeiten erfordern die Sperrung der Strecke. Daher kommt es zu Fahrplanänderungen und Haltausfällen bei den Zügen der Linien RE9 (DB), RB90, RB93, und RE99 (HLB). Die Strecke wird in verschiedenen Abschnitten für den Bahnverkehr total gesperrt. Aus betrieblichen Gründen kommt es wegen der Bauarbeiten auch zwischen Westerburg, Altenkirchen (Ww) und Au(Sieg) zu einzelnen Zugausfällen und Fahr- planabweichungen. Bitte beachten Sie für Ihre Reisen zwischen Au(Sieg), Betzdorf(Sieg) und Siegen die in diesem Abschnitt die Zugausfälle und die geänderten Fahrpläne. Bitte beachten Sie, dass sich in Kloster Marienthal, Hohegrete und Geilhausen die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs sich nicht in unmittelbarer Nähe der Bahnhaltepunkte befinden. In den Bussen des Schienenersatzverkehrs ist die Fahrradmit- nahme nicht möglich. Ihre Hessische Landesbahn RB90 Westerburg - Au(Sieg), gültig 05.09.-25.09.2020 Verkehrstag Mo-Fr Sa Sa Mo-Fr tgl Nacht 5.9. - 25.9. 5.9. 12.9. - 25.9. 5.9. - 25.9. 5.9. - 25.9. 25.9. / 26.9. Zug/Verkehrsmittel SEV-Halt ; 61702 ; ; 61804 29360 29376/91676 29378 Bemerkung 10 Min. früher 12 Min. später Westerburg ab 4:32 4:22 Langenhahn 4:39 4:29 Rotenhain 4:43 4:33 Enspel 4:46 4:36 Büdingen 4:50 4:40 Nistertal-Bad Marienberg -

Themenroute / Rundtour / Teilweise Bahntrassen-Radweg
WW1 Themenroute / Rundtour / teilweise Bahntrassen-Radweg Start/Ziel: Hachenburg Bahnhof Fahrtrichtung: Gegen den Uhrzeigersinn Distanz: 214 km (davon 4 km in NRW) Zeit: 17 Std. 55 Min. (bei 12 km/h) Hm ↑: 3.212 m Hm ↓: 3.212 m ▪ Schwer, wegen der Länge, der Höhenunterschiede und des hohen Streckenanteils auf Anforderung: nicht asphaltierten Belägen ▪ Hachenburg Bf. (Westerwald-Sieg-Bahn RB 90 Siegen-Limburg/Lahn) ▪ Anreise: Niedererbach und Dreikirchen Bf. (Unterwesterwaldbahn RB 29 Limburg/Lahn- Siershahn) sowie Westerburg Bf. (Westerwald-Sieg-Bahn RB 90 Siegen-Limburg/Lahn) Der WW1 führt als große Fahrradrunde durch den Westerwald. Umfassender lässt sich die Region im Rahmen einer 4-Tages-Tour kaum erradeln. Der Themenradweg bietet neben Kurz- großartigen Natur- und Landschaftserlebnissen eine Vielzahl kultureller Höhepunkte. beschreibung: Unterwegs lernt man die Vielfältigkeit und den Charme des Westerwaldes und seiner Menschen kennen. Die sportliche Rundtour erfordert jedoch gute Kondition! Der Radweg verlässt Hachenburg nach einem Schlenker in Richtung Altstadt und folgt dem Rothenbach durch den Hatterter Grund. Nach Wahlrod geht es über einen Hügel hinweg Weg- zum Waldsee Maroth, der zum Baden einlädt. Von Ort zu Ort zieht sich die Route über beschreibung: weite Feld-, Wiesen- und Weideflächen nach Selters, dass sich für eine Pause anbietet. Im Hachenburg Saynbachtal erwartet den Radfahrer eine Straßenpassage, ehe die Tour im Steilanstieg bis durch ein Waldgebiet nach Wirscheid und Sessenbach führt. Begleitet von herrlichen Grenzau: Panoramablicken auf die Montabaurer Höhe endet die Etappe mit der Serpentinenabfahrt 50 km nach Grenzau. Von Grenzau verläuft der Radweg im Herzen des Kannenbäckerlandes, Deutschlands berühmtester Keramik- und Tonregion, nach Höhr-Grenzhausen. Auf die Kannenbäckerstadt folgt ein Bahntrassen-Radweg, von dem sich ein Abstecher zum Weg- Limesturm Hillscheid lohnt. -

Bad Marienberg Q Hachenburg
Rennerod BUS Hachenburg – Bad Marienberg 483 Westerburg gültiggültig ab ab 09.12.2018 12.08.2019 Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH (RMV), Koblenz Rennerod Rennerod Q Hachenburg - Bad Marienberg ÃTelefon:Ã 0261 29683468 483483Q Hachenburg - Bad Marienberg Westerburg Westerburg 483483 RMV Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH, 56068 Koblenz, ` 0261/29683468, [email protected] RMVKein Rhein-Mosel Busverkehr Verkehrsgesellschaft an Samstagen, Sonntagen, mbH, 56068 rheinland-pfälzischen Koblenz, ` 0261/29683468, Feiertagen [email protected] sowie am 24. und 31. Dezember. An folgenden Tagen verkehrt diese Linie wie an KeinFerientagen: Busverkehr Rosenmontag, an Samstagen, Fastnachtdienstag, Sonntagen, rheinland-pfälzischen Tag nach Fronleichnam Feiertagen und Tag nachsowie Christi am 24. Himmelfahrt. und 31. Dezember. Es gilt die An Ferienregelung folgenden Tagen für das ver kehrtBundesland diese Linie Rheinland-Pfalz. wie an Ferientagen: Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Fronleichnam und Tag nach Christi Himmelfahrt. Es gilt die Ferienregelung für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Montag bis Freitag Fahrtnummer 0116 0116 0483 0483 0483 0483 0483 0116Montag0483 bis Freitag0483 0483 0483 0116 0483 0483 002 006 001 003 005 007 047 012 009 011 013 015 024 017 019 Fahrtnummer 0116 0116 0483 0483 0483 0483 0483 0483 0116 0483 0483 0483 0483 0116 0483 0483 0483 0483 Verkehrsbeschränkungen 202 206 261 201S 003S 005S 007F 047 212 009F 011S 013 015 224 017 219 021 045 ằ ằ ằ ằ VerkehrsbeschränkungenAnmerkungen Ç Ç F S S 99 S S 99F Ç F S Ç F S Hachenburg Markt ằ ằ 6 00 7 05 ằ 7 50 8 50 ằ 9 50 Unnau-Korb Hachenburgerstr.Anmerkungen Ç Ç ¶ 99 ¶ 99 Ç ¶ ¶ Ç ¶ 99 99 HachenburgUnnau Abzw StangenrodMarkt 6 00¶ 6 00 ¶ 7 05 7¶ 50 8 50¶ 9 50 ¶ 11 45 11 45 Unnau-KorbNorken Westerwaldstraße Hachenburgerstr. -

Übersicht Angebote Sommerschule 2021 Für Homepage KV.Xlsx
Übersicht Angebote der Sommerschule 2021 im Westerwaldkreis Angebotsort 1. Fewo 2. Fewo Alters- Verbandsgemeinde Anbieter Ansprechpartner Anmeldung Gebäude Straße PLZ Ort 16.08.-20.08.21 23.08.-27.08.21 gruppe Bad Marienberg VG Hoher Westerwald-Jugendherberge Erlenweg 4 56470 Bad Marienberg X X 1-4 Frau Weller [email protected] Bad Marienberg VG Hoher Westerwald-Jugendherberge Erlenweg 4 56470 Bad Marienberg X X 1-4 Frau Weller [email protected] Bad Marienberg VG Hoher Westerwald-Jugendherberge Erlenweg 4 56470 Bad Marienberg X X 1-4 Frau Weller [email protected] Bad Marienberg VG Europahaus Marienberg Europastraße 1 56470 Bad Marienberg X X 5-9 Frau Weller [email protected] Bad Marienberg VG Europahaus Marienberg Europastraße 1 56470 Bad Marienberg X X 5-9 Frau Weller [email protected] Bad Marienberg VG Europahaus Marienberg Europastraße1 56470 Bad Marienberg X X 5-9 Frau Weller [email protected] Hachenburg WW Realschule plus und Fachoberschule Kantstraße 19 57627 Hachenburg X X 5-9 Frau Deichmann [email protected] Hachenburg WW Realschule plus und Fachoberschule Kantstraße 19 57627 Hachenburg X X 5-9 Frau Deichmann [email protected] Hachenburg WW Realschule plus und Fachoberschule Kantstraße 19 57627 Hachenburg X X 5-9 Frau Deichmann [email protected] Hachenburg WW Realschule plus und Fachoberschule Kantstraße 19 57627 Hachenburg X X 1-4 Frau Deichmann [email protected] Hachenburg WW Realschule -

711 Stück Schwarzwild in Der VG Hachenburg Erlegt Jagd „Hot Spot“ Großes Thema Bei Versammlung Der Wäller Kreisgruppe
SEITE 14 Westerwald NR. 95 . MONTAG, 24. APRIL 2017 711 Stück Schwarzwild in der VG Hachenburg erlegt Jagd „Hot Spot“ großes Thema bei Versammlung der Wäller Kreisgruppe Von unserem Redaktionsleiter kreis, berichtete Schneider. Im ak- Eine zufriedene Bilanz des ver- Markus Müller tuellen Jagdjahr stehen die Zahlen gangenen Jagdjahres zog der Chef zwar noch nicht endgültig fest, der Kreisgruppe, Klaus Skowro- M Westerwaldkreis. Eigens ein aber es läuft bei etwas zurückge- nek. Insbesondere die vielen und Runder Tisch wurde in der Ver- gangener Strecke darauf hinaus, zum Teil großen Aktionen rund bandsgemeinde Hachenburg ge- dass auf die VG Hachenburg allein ums Wildbret seien bei der Bevöl- bildet, um der zunehmenden Wild- ein Viertel entfällt. Schneider geht kerung bestens angekommen. Bei der Jahreshauptversammlung der Westerwälder Jäger in Westerburg wurden viele Mitglieder geehrt, die seit schweinpopulation mit entspre- davon aus, dass damit auch der ho- In diesem Jahr richtet die Kreis- Jahrzehnten aktiv sind. Außerdem gab es Ehrennadeln für besondere Leistungen. Foto: Markus Müller chenden Maßnahmen Herr zu wer- he Wildschaden von 200 000 Euro gruppe im Mai den Landeswett- den. Von diesem „Hot Spot“ und im Jagdjahr 2015/2016 erheblich bewerb der Jagdhornbläser im den Aktionen berichtete Kreis- zurückgehen kann. Kloster Marienstatt aus. Während Viele Jäger sind seit vielen Jahrzehnten oder in besonderen Funktionen aktiv jagdmeister Bernd Schneider bei Auch Bürgermeister Peter der Jahresversammlung gab die der Jahreshauptversammlung der Klöckner (VG Hachenburg) zeigte Bläsergruppe „Hoher Wester- Bei der Versammlung der Jäger wurden 20 Jäger für 40 Jahre geehrt: Menne, Pottum; Dietmar Bamber- Kreisgruppe Westerwald des Lan- sich zufrieden mit der Zusammen- wald“, die auch daran teilnimmt, wurden Dieter Wolf aus Hundsangen Richard-Peter Heinz, Höhn; Wolf- ger, Maxsain; Hans Dieter Kraft, desjagdverbandes in Westerburg. -

Westerwaldkreis
3.10 | LANDKREIS WESTERWALDKREIS Im Westerwaldkreis sind zum Zeitpunkt der Umfrage in 79 Ortsge- gelt sich auch in den Erwartungen für die nächsten 10 Jahre wider: meinden Einzelhandelsgeschäfte vorhanden (48 %). In den meisten Für die Zukunft gehen 64 % von einer Stagnation im Hinblick auf Ortsgemeinden hat das Ladenhandwerk immer noch eine vorherr- die Nahversorgungsentwicklung aus. 30 % blicken der künftigen schende Rolle. Hierbei dominieren Bäckereien (48 Ortsgemeinden) und Entwicklung mit Skepsis entgegen, nur 6 % sehen optimistisch in Metzgereien (31 Ortsgemeinden) die Ladenlandschaft. Kleinere und die Zukunft. große Supermärkte sowie Discounter existieren in 24 Ortsgemeinden. Beim Vergleich der Verbandsgemeinden im Landkreis Westerwald- Drogeriemärkte findet man dagegen nur in drei Orten vor. Von den kreis zeigt sich, dass Wirges die Verbandsgemeinde mit der besten Ortsgemeinden, die kein Einzelhandelsgeschäft aufweisen, werden Versorgungsstruktur ist. Hier werden sieben von zehn Ortsgemein- 24 Ortsgemeinden (51 %) durch mobile Verkaufswagen versorgt. den durch den Einzelhandel versorgt. Kritischer ist die Lage in der Seit dem Jahr 2000 hat sich die Situation nach Angabe der Orts- VG Ransbach-Baumbach. Hier existieren in drei von zehn Ortsge- bürgermeister in 40 % der Orte verschlechtert. Dieser Trend spie- meinden (70 %) keine Nahversorgungseinrichtungen. BAD MARIENBERG HACHENBURG RENNEROD Landkreis: Westerwald Verbandsgemeinden: 10: Bad Marienburg, Hachenburg, Höhr Grenz- hausen, Montabaur, WESTERBURG Ransbach-Baumbach, Rennerod, -
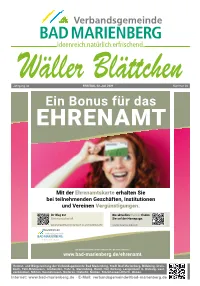
Nr. 26 02. Juli 2021
Verbandsgemeinde BAD MARIENBERG ideenreich.natürlich.erfrischend. Jahrgang 36 FREITAG, 02. Juli 2021 Nummer 26 Ein Bonus für das EHRENAMT Mit der Ehrenamtskarte erhalten Sie bei teilnehmenden Geschäften, Institutionen und Vereinen Vergünstigungen. Ihr Weg zur Die aktuellen PartnerƼRHIR Ehrenamtskarte! 7MIEYJHIV,SQITEKI www.westerwaldkreis.de/ehrenamtskarte-des-westerwaldkreises.html www.bad-marienberg.de/ehrenamt Unterstützt von der Verbandsgemeinde BAD MARIENBERG ideenreich.natürlich.erfrischend. Die Ehrenamtskarte ist eine Initiative des Westerwaldkreises. www.bad-marienberg.de/ehrenamt Heimat- und Bürgerzeitung der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, Stadt Bad Marienberg, Bölsberg, Dreis- bach, Fehl-Ritzhausen, Großseifen, Hahn b. Marienberg, Hardt, Hof, Kirburg, Langenbach b. Kirburg, Laut- zenbrücken, Mörlen, Neunkhausen, Nisterau, Nistertal, Norken, Stockhausen-Illfurth, Unnau. Internet: www.bad-marienberg.de · E-Mail: [email protected] Wäller Blättchen 2 Nr. 26/2021 NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE Überfall - Polizei .............................................................. 110 für das Wasserwerk ....................................... 0170/1889930 Notrufnummer der Feuerwehr für das Klärwerk ............................................. 0171/7777972 und Rettungsdienst Notarzt ............................................ 112 Rettungsdienst - Krankentransport (kein Notruf ........ 19222) ■■ Entstördienst bei Notfällen Giftnotzentrale ......................................... Tel.: 06131/19 240 und technischen Störungen -

Schienenersatzverkehr Westerburg – Limburg
RB 90: Brückenbauarbeiten vom 06.05. bis 13.08.2017 Schienenersatzverkehr Westerburg – Limburg Stand: 21. April 2017 s 3LänderBahn RB 90: Brückenbauarbeiten vom 06.05. bis 13.08.2017 Schienenersatzverkehr Westerburg – Limburg Sehr geehrte Damen und Herren, im Zeitraum 06.05. bis 13.08.2017 wird in = Im Abschnitt Hadamar – Westerburg fallen beginnen ihre Fahrt bereits in Nistertal-Bad = Im Abschnitt Westerburg – Altenkir- Hadamar der Eisenbahnviadukt saniert und in sämtliche Züge aus. Es wird ein Schienener- Marienberg und halten zusätzlich in chen (Wester wald)–Siegen kommt es Teilen neu aufgebaut. Aufgrund der histo- satzverkehr mit Bussen eingerichtet, der Rotenhain und Langen hahn. Da der Zug der morgens bei einzelnen Zügen zu Fahrplan- rischen Konstruktion der Brücke, aber auch (mit einer Ausnahme) alle Halte bedient. Linie RB 90 von Altenkirchen mit Ankunft in änderungen, um in Westerburg Anschlüsse wegen der beengten Platzverhältnisse und der Diese Busse beginnen bzw. enden teilweise Westerburg um 7:30 Uhr abweichend vom von / zu den SEV-Bussen von / nach Hadamar Baustellenlogistik ist es leider unvermeidbar, in Hadamar (hier besteht dann Anschluss an Regelverkehr mit einer geringeren Kapazität bzw. Limburg (Lahn) herzustellen. dass es beim Eisenbahnbetrieb auf dieser den verbleibenden Zugverkehr); ein Teil der fahren muss, bitten wir Sie, für Fahrten nach Strecke zu starken Einschränkungen kommt. Busse verkehrt auch weiter von / nach Westerburg auch diese Busse zu nutzen. = Der Abschnitt Altenkirchen (Westerwald) – Limburg (Lahn), sodass auch einige Direkt- Siegen ist nicht betroffen. Die Linie RB 90 erhält daher im Baustellenzeit- verbindungen auf der Relation Westerburg – = Der Abschnitt Altenkirchen (Westerwald) – raum einen Sonderfahrplan, den Sie im Detail Limburg (Lahn) erhalten bleiben. -

Hachenburg an Ab an Ab an Ab an Ab Hinweise Hinweise ➜ Verkehrsbeschränkungen Verkehrsbeschränkungen 270 Wie Samstag
➜ RegioBus: B 270 Hachenburg - Malberg - Elkenroth - Steineroth - Betzdorf V Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag. Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Christi Himmelfahrt und Tel. 02747 912760 Tag nach Fronleichnam Verkehr wie an Ferientagen. Montag - Freitag Verkehrsbeschränkungen SS SFSSS y-vS y-vS Hinweise o0w0 w0 ilw0 Hachenburg Schulzentrum 3 12.40 - Grundschule am Schloss 11.55 12.45 15.34 Hachenburg Markt B 5.14 6.09 7.09 8.04 9.04 10.04 12.03 12.04 12.42 14.04 15.04 - Bahnhof 5.17 6.12 7.12 8.07 9.07 10.07 12.06 12.07 12.48 14.07 15.07 15.37 Nister Dorfwiese 5.20 6.15 7.15 8.10 9.10 10.10 12.10 14.10 15.10 1 - Hammerstr. 12.11 12.53 15.42 Marienstatt Gymnasium 12.30 12.27 14.14 15.40 - Abtei 8.16 9.16 10.16 12.16 12.16 14.16 15.16 Streithausen Hauptstr. 5.25 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 12.20 12.20 12.35 12.58 14.20 15.20 - Nasse Heide 5.25 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 12.20 12.20 12.35 12.58 14.20 15.20 Atzelgift Brunnen 5.27 6.22 7.22 8.22 9.22 10.22 12.22 12.22 12.34 13.00 14.22 15.22 - Landstr. 5.28 6.23 7.23 8.23 9.23 10.23 12.23 12.23 12.35 13.01 14.23 15.23 Luckenbach Dorfplatz 5.29 6.24 7.24 8.24 9.24 10.24 12.24 12.24 12.39 13.02 14.24 15.24 Malberg (Westerw) Steineberg an 5.32 6.27 7.27 8.27 9.27 10.27 12.27 12.27 12.42 14.27 15.27 - Steineberg ab 5.33 6.28 7.28 8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 12.28 13.28 14.28 15.28 Rosenheim (Westerw) Kirchstr. -

Merkblatt Selbsthilfegruppen
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises -Gesundheitsamt Montabaur- Selbsthilfegruppen Peter-Altmeier-Platz 1 56410 Montabaur Sozialpsychiatrischer Dienst Montag Dienstag Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkrankenhilfe bei Alkohol- und Medikamentenproblemen Freundeskreis Westerwald e.V.: Freundeskreis Westerwald e.V.: Tel. 02602-124710 Hachenburg-Altstadt 19.30 Uhr Bad Marienberg 19.00 Uhr Mo. bis Do. 7.30 – 16.30 Uhr Ev. Gemeindehaus Evangelisches Gemeindehaus Freitag 7.30 – 13.00 Uhr Kontakt:Ellen Weyer 02688-620 Kontakt: Lothar Benner 0170-5859743 und nach Vereinbarung 0160-1542340 Achim Schmidt 0171-1854115 Ansprechpartner/innen Ralf Vietze 02602-9493771 ([email protected]) Frau Jung 02602-124722 0151-51696374 Frau Matthey-Blech 02602-124720 ([email protected]) Dierdorf 20.00 Uhr Frau Meuser 02602-124719 Gemeindehaus der ev. Kirche Frau Hambitzer 02602- 124778 Westerburg, Hergenrother Str. 2 20.00 Uhr Am Damm (Diakonisches Werk) Kontakt: Kurt Schmitt 02626-4679178 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Kontakt: Dietmar Krieger 02663-5078 0178-9168326 -Gesundheitsamt Bad Marienberg- Jürgen Geisen 02663-7686 ([email protected]) Triftstraße 1 d [email protected] 56470 Bad Marienberg Wilfried Köther 06435-2106 Tel. 02661-3017 und 3018 [email protected] Sprechzeiten wie Dienststelle Montabaur ([email protected]) Anonyme Alkoholiker (AA): Ansprechpartner/innen Wallmerod 19.00 Uhr Frau Flick, Frau Glöckner und Frau Rech Kath. Pfarrheim, Kirchstraße 14 Blaues Kreuz: Diakonisches -

Patchwork 2/2020
Ausgabe 2 / Herbst 2020 Patch|work Das Magazin der Pfarrei St. Laurentius Nentershausen ...EINFACH ANDERS Veränderung im Pastoralteam Themenbezogene Verantwortlichkeiten Gemeinschaft erleben trotz Distanz So funktioniert‘s in unserer Pfarrei ÜBER UNS Für Sie da Das Team von St. Laurentius Nentershausen Pastoralteam hinten: Pater Jaison, Diakon Meinrad Kreß, Pfr. Jan Gerrit Engelmann, Gemeindereferentin Hildegard Storch, Pastoralreferent Franz Hennemann vorn: Gemeindereferentin ElisabethPfr. Marc Pfeffer, Stenger Pastoralreferentin Verena Ley, es fehlt im Bild: Pater Joshy Joseph Manalel Das Sekretariatsteam Zentrales Pfarrbüro Sankt Laurentius oben:Andrea Weimar-Blösel, Angelika Kraus, Anne Zingel, Anett Herzmann Rosenstraße 13 vorn: Karla Ternes, Beate Malm, Martina Hertzig, Gerlinde Frink, 56412 Nentershausen Antje Bremser Öffnungszeiten: Montag: 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 Uhr Dienstag: 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 Uhr Mittwoch: 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 Uhr Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr Freitag: 9.00 - 12.00 Telefon: 0 64 85 / 88 00 60 Email: [email protected] Titelmotiv: iStock.com / Maksym Belchenko 2 EDITORIAL Willkommen liebe Leserinnen und Leser, Sie halten die zweite Ausgabe unseres Unser Pfarrei-Magazin Patchwork er- Magazins Patchwork in Händen. Wann scheint zweimal im Jahr. Als Redaktion konnte man jemals schon einmal sagen, versuchen wir am Ball zu bleiben und dass sich zwischen zwei Magazinen die von den besonderen Dingen in unserer ganze Welt bis in den letzten Winkel Pfarrei zu berichten. veränderte? Wir fühlen uns „einfach an- ders“ und wollen mit Ihnen ins Gespräch Gerne hören wir dazu auch Ihre An- kommen, z.B. über den „Geist des Auf- sichten. Schreiben Sie uns Meinungen, bruchs“, S.4-5 oder die „Zeit, um den Fragen, Anregungen und Kritiken in den Blick zu weiten“, S. -

Lokalanzeiger 4
LokalAnzeiger 4. Dezember 2019 • Seite 4 Mittwoch, 4. Dezember gional, auf www. modelleisenbahnschau- ter der Bücherei). 19 Uhr: ticket-regional.de, unter der hachenburg.de. Treffen der Schachfreunde ¸ Theater Karten-Hotline q (0651) Montabaur, Lutherkirche. Hachenburg. 97 90 777. 17.30 Uhr: GoIn-Gottes- Höhr-Grenzhausen, Töp- Ransbach-Baumbach, dienst neu erleben unter fermarktplatz. 15 bis 19 Uhr: Stadthalle. 10 Uhr: Aladin ¸ Sonstiges dem Motto „Umtausch aus- Wochenmarkt. und die Wunderlampe. Ti- geschlossen“. Weitere Infos Nistertal, Birkenhof Bren- ckets: Kinder 9€, Kinder- Betzdorf, rund ums Rat- auf www.evki-montabaur.de. nerei. 16 Uhr: Besichtigung, Gruppen 8,50 €, Erwachse- haus. 15-22 Uhr: Weih- Westerburg, Lokschuppen Faszination Brennerei: Of- ne 12 €. Vorverkauf: Stadt- nachtsmarkt. des Erlebnisbahnhofes fene Führungen. Weitere In- hallenbüro q (02623) Hachenburg, Sozialraum Westerwald. 11-17 Uhr: fos auf www.birkenhof- 98 800) oder www.ticket- im Vogtshof (Mittelstr. 2; un- Weihnachtsmarkt mit Mo- brennerei.de. stadthalle.de. ter der Bücherei). 19 Uhr: dellbahnbörse. Rennerod, Bistro der Wes- Treffen der Schachfreunde Willmenrod, Ev. Kirche, 10 terwaldhalle (Westerwaldstr. Donnerstag, 5. Dezember Hachenburg. Uhr: Vorweihnachtlicher 8). 15 bis 16.30 Uhr: Platt- Hachenburg, Neumarkt Gottesdienst unter dem schwätzer-Treff. Infos unter ¸ Sonstiges und Fußgängerzone. 8 bis Motto „Hoffnung sehen“. q (02663) 25 40 oder 16 Uhr: Wochenmarkt. [email protected]. Altenkirchen, Marktplatz. 7 Montabaur, Pauluszentrum Westerburg, Konrad-Ade- bis 13 Uhr: Wochenmarkt. (Peterstorstr.). 15-17 Uhr: Donnerstag, 12. Dezember nauer-Gymnasium. 16 Uhr: Hillscheid, Soziotherapie Offenes Treffen im Trauer- Informationsabend für El- „Zum Euler“ (Am Limes 18). café. Anmeldung nicht er- ¸ Sonstiges tern und Schüler der künf- 15 bis 17 Uhr: Spielnach- forderlich.