3 Die Siedlungsgeschichte Der Stadt Utrecht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bureau Cuypers / Archief
Nummer Toegang: CUBA Bureau Cuypers / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Bureau Cuypers / Archief CUBA CUBA Bureau Cuypers / Archief 3 INHOUDSOPGAVE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF......................................................................5 Aanwijzingen voor de gebruiker.......................................................................6 Citeerinstructie............................................................................................6 Openbaarheidsbeperkingen.........................................................................6 Archiefvorming.................................................................................................7 Geschiedenis van het archiefbeheer............................................................7 Geschiedenis van de archiefvormer.............................................................9 Cuypers, Petrus Josephus Hubertus..........................................................9 Cuypers, Josephus Theodorus Joannes...................................................13 Stuyt, Jan................................................................................................14 Cuypers, Pierre Jean Joseph Michel (jr.)..................................................14 Bereik en inhoud............................................................................................15 Manier van ordenen.......................................................................................16 Bronnen.........................................................................................................22 -

OKW / Oudheidkunde En Natuurbescherming 3
Nummer Toegang: 2.14.73 Inventaris van het archief van de Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming en taakvoorgangers, (1910) 1940-1965 (1981) van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Versie: 09-06-2020 CAS 1108 / PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 This finding aid is written in Dutch. 2.14.73 OKW / Oudheidkunde en Natuurbescherming 3 INHOUDSOPGAVE Beschrijving van het archief......................................................................................7 Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................8 Openbaarheidsbeperkingen.......................................................................................................8 Beperkingen aan het gebruik......................................................................................................8 Materiële beperkingen................................................................................................................8 Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 8 Citeerinstructie............................................................................................................................ 8 Archiefvorming...........................................................................................................................9 Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................9 -

Vierentwintigste Jaargang Januari 2005 No. 1 Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen En Omstreken
vierentwintigste jaargang januari 2005 no. 1 Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken Voorzitter : Dr. H.P. Deys, Rhenen, tel. 0317-612812 Secretaris : Ing. H.B. Gieszen, Bruine Engseweg 40, 3911 CL Rhenen, tel. 0317-616076 Penningmeester : W.H. Strous, Rhenen, tel. 0317-614067, Leden : L.E.G. Bultje- van Dillen, Wageningen, tel. 0317-472129 H.E. Dekhuijzen, Rhenen, tel. 0317-612653 A.J. van Drunen, Rhenen, tel. 0317-617038 Dr A.J. de Jong, Voorthuizen, tel. 0342-471039 Website : www.oudrhenen.nl Betalingen op Postbank 1211163, t.n.v. Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o Redactiecommissie Oud Rhenen: Dr. A.J. de Jong, Voorthuizen, tel. 0342-471039 W.H. Strous, Rhenen, tel. 0317-614067 Inleveren kopij: Bruine Engseweg 25, 3911 CJ Rhenen ISSN-1384-3338 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen dan na schriftelijke, voorafgaande toestemming van de redactie. Omslagfoto: Uitsnede van een aquarel van J. le Blanc Ontwerp en druk: Drukkerij Cunera b.v., Rhenen OUD RHENEN - vierentwintigste jaargang - januari 2005 - no. 1 - blz. 3 O U D R H E N E N Tijdschrift voor de Historie van Rhenen uitgegeven door de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken vierentwintigste jaargang januari 2005 no. 1 OUD RHENEN - vierentwintigste jaargang - januari 2005 - no. 1 - blz. 4 Inhoudsopgave In Memoriam Jhr. mr. L.H.N.F.M. Bosch ridder van Rosenthal dr H.P. Deys ...............................................................................................blz. 5 De ontstaansgeschiedenis van Hotel “Het Wapen van Hardenbroek” te Rhenen Dick en Gerrit Laheij. ................................................................................blz. 8 Allerlei mengelwerk in de moedertaal Lidy Bultje – van Dillen .............................................................................blz. 12 Het Patershuis Hens Dekker ...............................................................................................blz. 15 Militairen en prentbriefkaarten te Rhenen Ad J. -
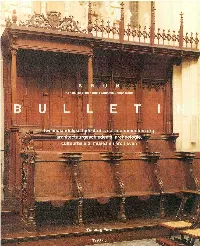
1993 Jaargang 92
f 3 - ..sj s;'* g o o o i 11 i 9 o INHOUD 129 KONINKLIJKE NEDERLANDSE Ester Vink Bosch bouwhout onderweg OUDHEIDKUNDIGE BOND Een historisch onderzoek naar d e herkomst va n Bosch bouwhout i n d e vijftiende e n Opgericht 1 7 januari 1899 zestiende eeuw Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana. 141 Victor M. Schmidt Een verdwenen priestergestoelte uit de Sint- Bulletin Janskathedraal te 's-Hertogenbosch Tweemaandelijks tijdschrift va n d e KNOB, tevens orgaan va n d e 145 Rijksdienst voor de Monumentenzorg R.F. van Dijk en H J. van Nieuwenhoven en d e Rijksdienst voor he t De klokken va n Giessen-Oudekerk e n Oudheidkundig Bodemonderzoek. Oosterwijk 147 Redactie Publikaties prof. dr. M. Bock, A.A.J. Mekking, Torenhoge misverstanden (reactie o p d e recensie va n K . de r Ploeg); prof. drs. H.L. Janssen, C. Boschma-Aarnoudse, Renaissance-raadhuizen dr. E. de Jong, boven het IJ: 'Een huijs om te vergaderen ende prof. dr . A.J.J. Mekking, tgerecht te houden' (recensie: Ronald Sfe/wert); prof. dr. K.A, Ottenheym, (hoofdredacteur) 157 drs. H. Sarfatij Berichten prof. dr . E.R.M. Taverne, Monumentenzorg: prof. dr. ir. C.L. Temminck Groll, M.S. Verweij, Een plan tot overkapping van de eerste binnenplaats in het Prinsenhof te Delft; prof. dr. ir. F.W. van Voorden J. Oosterhoff, Nederlandse bruggen stichting; drs. ing. DJ . d e Vries, Carlo Huijts directeur Vereniging Hendrick de (eindredacteur) Keyser. prof. dr . A va n de r Woud. Archeologie: Bescherming o p maat: Akmarijp, Bouwhistorisch onderzoek Norbertinessenklooster Houthem, Kopij voor he t Bulletin: Nieuw museum Westland, Klooster Gaarne t.a.v. -

Week Van De Beiaard
PROGRAMMA WEEK VAN DE BEIAARD 7 CONCERTEN TER GELEGENHEID VAN HET 25-JARIG BESTAAN VAN DE STICHTING KLOKKENSPEL GRONINGEN 23 T/M 29 JULI 2018 VEENDAM | GRONINGEN | HEILIGERLEE | WINSCHOTEN APPINGEDAM |MIDDELSTUM 1 VOORWOORD Pagina 2 Maandag 23 juli 2018, 19.00 uur Ruim 400 luidklokken, 7 carillons en 25 Concert op de toren van de Grote Kerk automatische klokkenspellen vormen in Veendam. een belangrijk deel van ons provinciaal Paul Maarsen, beiaard en Hans cultureel erfgoed. Vermunt, synthesizer. De omvang van het Groninger 4 Dinsdag 24 juli 2018, 10.00 uur klokkenbezit kent in Nederland zijn Concert op de beiaard van de weerga niet. academietoren Rijksuniversiteit Groningen. Om dit erfgoed te behouden, te Auke de Boer. herstellen, waar mogelijk uit te breiden 6 Woensdag 25 juli 2018, 13.00 uur en het gebruik ervan te bevorderen, is Concert op de beiaard van de 25 jaar geleden de Stichting klokkengieterij Museum Heiligerlee. Klokkenspel Groningen (SKG) Levina Pors. opgericht. In het kader van dit 8 Donderdag 26 juli 2018, 1930 uur jubileum organiseert de SKG, Concert op de beiaard van de Martini- gedurende de maanden mei tot en met toren in Groningen. oktober, een aantal evenementen die Auke de Boer. de doelstellingen van de stichting op 10 Vrijdag 27 juli 2018, 15.00 uur een bijzondere en nadrukkelijke wijze Concert op de beiaard van de toren onder de aandacht wil brengen bij van de Marktpleinkerk (Olle Witte) in bestuurders, (cultuur)professionals en Winschoten. de Groninger bevolking. Adolph Rots. 12 Zaterdag 28 juli 2018, 15.00 uur Een van de evenementen is de ‘Week Concert op de beiaard van de toren van de beiaard’. -

MASTER INFORMATION LISTING for the NETHERLANDS 7-May-21 Page 1
MASTER INFORMATION LISTING for THE NETHERLANDS 7-May-21 Page 1 **************************************** | Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | Almelo, Overijssel, Netherlands * Tower instruments in the country * | LL: N 52.62942, E 4.75019 | LL: N 52.35983, E 6.66476 * of The Netherlands are listed in * | *Remarks: | *Carillonist: * three parts, as follows: * | Made of 21 bells by Melchior de Haze | Frans Haagen * * | (1687/8/9) and 2 by G&J(1928), from | E: [email protected] * Existing carillons (beginning on * | renovation of Waag and St.Lawrence | *Contact: * this page) * | carillons. Drum has 27 tracks, so | Parochiecentrum * Former carillons (i.e., defunct * | four bells have double hammers. | Boddenstraat 76 * instruments which have not * | | 7607 BN Almelo * been replaced) * | ALKMAAR - STL NETHERLANDS | T: 0546 813 298 * Chimes (8 to 22 bells) * | *Location: | E: [email protected] * Former chimes * | Sintlaurenstoren (N.H.Grote Kerk) | *Schedule: * * | Bagijnenstraat at Canadaplein | Thursdays 1030-1130 (45 weeks/year) * Within each part, sites are listed * | Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | *Remarks: * alphabetically by city. * | LL: N 52.63256, E 4.74370 | G&J carillon, installed by Eijsbouts, **************************************** | *Carillonist: | was lost in World War II, though old Telephone country code: 31 | Christiaan Winter | drum survived for use with new bells, ---------------------------------------- | E: [email protected] | and is now reprogrammed twice a year. NOTE: Dutch 'ij' = English 'y' and was | *Schedule: | Became city carillon in 1974. formerly collated as such. Beginning | Friday 1230-1330 | in 2019, the modern Dutch usage is | *Remarks: | ALMERE - C NETHERLANDS followed here instead of the former | Old bells by de Haze, installed by | *Location: substitution of Y for IJ. -

Hoogbouw in De Ruimte
Master Thesis Economische Geografie Hoogbouw in de Ruimte Rinse Gorter Augustus 2008 Studentnr: 1300083 Begeleider: Prof. Dr. P.H. Pellenbarg Opleiding: Economische geografie 2 -2- Voorwoord Voor u ligt het onderzoek dat ik gedaan heb ter afronding van de masteropleiding Economische Geografie aan de RijksUniversiteit te Groningen. In een paar zinnen voorafgaande aan het werkelijke onderzoek wil ik graag alle mensen in mijn omgeving bedanken voor hun bijdrage, hulp en steun. In het bijzonder wil ik mijn vader bedanken voor zijn op- en aanmerkingen die mij vaak verder hielpen in het schrijfproces. Daarnaast wil ik Prof. Dr. P.H. Pellenbarg bedanken die mij begeleid heeft bij het schrijven van mijn masterthesis. Verder wil ik Dhr. A. Edzes bedanken voor het vervullen van de taak als tweede begeleider. Natuurlijk zijn ook vrienden en andere familieleden onmisbaar geweest bij het tot stand komen van dit eindproduct. Rinse Gorter, 10 juli 2008 3 -3- Abstract This thesis, written in the finalizing stage of the master’s degree in Economic Geography at the RijksUniversiteit Groningen, is about high-rise buildings in the Netherlands. The title ‘Hoogbouw in de Ruimte’ would literally be translated in English as ‘High-rise buildings in Space’ but (because mankind is still not able to build on the moon) should be read as ‘high- rise buildings and their environment’. High-rise buildings in the Netherlands are starting to play an increased role in Dutch municipal policy. Because of the lack in national high rise building policy, most of the major cities have developed their own policy on skyscrapers. When we look at the history of the skyscraper in the Netherlands, there has been a shift from public development before the 1980’s to private development after 1990. -

Kopie Van Back-Up Concerten 2014-2018.Xlsx
Concerten Sietze de Vries 2014-2018 Datum Plaats/locatie 23-12-2018 21:00 Groningen, der Aa-Kerk 22-12-2018 21:00 Ede, Concertzaal 16-12-2018 18:00 Groningen, Nieuwe Kerk 15-12-2018 17:00 Veenendaal, Westerkerk 2-11-2018 21:00 Axel, Gereformeerde Kerk (vrijg) 28-10-2018 18:00 Getafe (ESP) Cathedral of Santa Maria Magadalena 27-10-2018 20:00 Colmenar de Oreja (ESP) 20-10-2018 22:00 Farmsum, Dorpskerk 19-10-2018 21:30 Putten, Hersteld Hervormde Kerk 15-10-2018 12:00 Göteborg (SW), Örgryte Kirke e.a. 13-10-2018 22:00 Groningen, Nieuwe Kerk 4-10-2018 02:00 St. Andrews (SCO), University 29-9-2018 22:00 Hasselt, Grote of Stephanuskerk 29-9-2018 19:00 s Hertogenbosch, Grote Kerk 23-9-2018 21:00 Haarlem, Grote of St. Bavokerk 18-9-2018 12:00 Meerdaagse orgelreis Stichting Groningen Orgelland (18-22 september) 16-9-2018 22:00 Nitra (SL), Kathedraal 13-9-2018 22:00 Wijk bij Duurstede, Grote Kerk 9-9-2018 19:00 Groningen, Martinikerk 7-9-2018 22:30 Melsele (B), Onze Lieve Vrouw van Gaverland 31-8-2018 22:30 Campomorone (IT), Chiesa Parrocchiale di S. Bernardo 22-8-2018 12:00 Smarano (IT), Orgelfestival 17-8-2018 21:45 Wels (AT), Pfarre Heilige Familie 15-8-2018 21:00 Frauenberg (AT), Wallfahrtskirche 10-8-2018 22:00 Konstanz (D), Münster 5-8-2018 18:00 Amsterdam, De Duif 2-8-2018 22:00 Altenberg (D), Dom 28-7-2018 22:00 Leens, Petruskerk 26-7-2018 22:00 Ouddorp, Dorpskerk 25-7-2018 22:00 Groningen, Martinikerk 23-7-2018 22:00 Veenhuizen (Dr), Koepelkerk 15-7-2018 12:00 Saint Savin (F), Orgelfestival 14-7-2018 19:30 Veenhuizen (Dr), Grote Kerk 14-7-2018 17:00 Veenhuizen (Dr), Koepelkerk 12-7-2018 22:00 Harderwijk, Grote Kerk 7-7-2018 18:00 Gouda, Grote of St. -

Dit Programmaboekje Wordt U Mede Aangeboden Door Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland En Het BNG Cultuurfonds
Dit programmaboekje wordt u mede aangeboden door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en het BNG Cultuurfonds. Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging Secretariaat: Leo Samama, Goeverneurkade 128, 2274KN Voorburg M: [email protected] 75 klokken vieren 75 jaar vrijheid in 75 steden en dorpen Nationale carillon-estafette start in Maastricht Exact 75 jaar na de bevrijding van Maastricht start op zaterdag 14 september 2019 om 12.00 uur de nationale carillon-estafette met een bespeling van het 350 jaar oude Maastrichtse stadhuiscarillon door beiaardier Philippe Reuser. De Limburgse hoofdstad is de eerste grote Nederlandse stad die werd bevrijd. Aansluitend volgt de carillon-estafette het spoor van de bevrijders door Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland naar het noorden van Nederland. Alle beiaardiers zullen een programma spelen met muziek uit de bevrijdingstijd. In de loop van het jaar zijn er bespelingen in onder meer het Vredespaleis in Den Haag, de Stevenskerk in Nijmegen, de Westertoren in Amsterdam en in de Eusebiuskerk in Arnhem, waarvan de toren inclusief het carillon tijdens de Slag om Arnhem werd verwoest. De meeste bespelingen vinden plaats op of rond de datum waarop de betreffende plaatsen zijn bevrijd. Op Bevrijdingsdag klinken de klokken van de Grote Kerk in Wageningen. In Weert en Heerlen bespeelt stadsbeiaardier Frank Steijns de carillons op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. Van oudsher staan carillons en kerkklokken symbool voor vrede en welvaart. Klokkenroof Circa 9.000 van de Nederlandse carillons en kerkklokken, met een totaalgewicht van 3,5 miljoen kilo klokkenbrons, werden in de oorlogsjaren uit de torens verwijderd om te worden omgesmolten en gebruikt ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie. -

Growing Pains Survey Shows: the Limits Are in Sight | P.12 2 >> Picture
New timetable postponed Vibrating fork Insect girl Student-staff Council votes It won’t really help you Cupboards full of insect snacks in against fast-track launch | p.6| lose weight | p.9| your student room | p.25| RESOURCEFor everyone at Wageningen University & Research no 19 – 1 June 2017 – 11th Volume Growing pains Survey shows: the limits are in sight | p.12 2 >> picture BLOOD WEDDING A young woman leaves her bridegroom standing at the altar and goes off with a former lover. That is the gist of the Spanish play Blood Wedding, performed this week in the Belmonte Arboretum by Pierrot and Columbine, the Ceres Drama Society. Although the play is over 80 years old, it is still relevant today, says student Jelle Leeuw. ‘The men in the play are proud and hardworking, while the women are stuck at home all day. They are not allowed to express their sexuality because that makes them sluts. Exactly what happens nowadays with ‘slut shaming’ of girls in student societies.’ There are more open-air performances of the play on 1,2,3 and 4 June. LvdN, photo: Sven Menschel RESOURCE — 1 June 2017 ILLUSTRATION COVER: PASCAL TIEMAN >>CONTENTS no. 19 – 11th volume >> 10 >> 20 >> 24 SACRED NATURE DISPOSABLE SCIENTISTS PIANO OUT OF THE WINDOW Communication on ‘wilderness’ ‘After footballers, scientists are most A bizarre student house tradition in often has religious overtones often in temporary employment’ the Heerenstraat SUNNY FOR NOW Resource asked all the professors and study coordinators what effect the growth in student numbers is having on their work. -

Jaaroverzicht 2003 Maliebaan 14 Jaaroverzicht 3581 CN Utrecht Postbus 16 3500 AA Utrecht 2003 Telefoon (030) 230 33 00
Zorg & welzijn Natuur & milieu Kunst & cultuur Sport & vrije tijd Stichting VSBfonds Jaaroverzicht 2003 Maliebaan 14 Jaaroverzicht 3581 CN Utrecht Postbus 16 3500 AA Utrecht 2003 Telefoon (030) 230 33 00 Fax (030) 230 33 99 | Stichting VSBfonds [email protected] www.vsbfonds.nl Colofon Uitgave VSBfonds, afdeling Voorlichting & Communicatie Grafische vormgeving Total Identity, Amsterdam Dtp en druk Badoux Drukkerij, Nieuwegein Bindwerk Binderij Pfaff, Woerden Papier Biotop 250 g / 120 g Stichting VSBfonds Opgericht op 17 december 1817 en voortgezet als Stichting VSBfonds op 22 mei 1990. Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer S 17 99 44 Verantwoording bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Het VSBfonds verleent fi nanciële steun aan maatschappelijke initiatieven in Omstreken. Nederland. Dit jaaroverzicht laat de breedte zien van het werkveld waarop Maliebaan 14 het fonds actief is. Zo biedt het onder meer een overzicht van de projecten die 3581 CN Utrecht Postbus 16 het fonds in 2003 mede heeft mogelijk gemaakt. 3500 AA Utrecht Telefoon (030) 230 33 00 Fax (030) 230 33 99 Aan de samenstelling en de teksten van dit jaaroverzicht is de grootst mogelijke [email protected] aandacht besteed. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. www.vsbfonds.nl Zorg & welzijn Natuur & milieu Kunst & cultuur Sport & vrije tijd IInhoudsopgavenhoudsopgave 2 Voorwoord bestuur 4 Directieverslag 1111 Historie 1122 Werkwijze 1144 Samenwerking 1166 Financieel overzicht 1188 Regionale afdelingen 2222 ZZorgorg & welzijnwelzijn -

The Design Practices of the Dutch Architectural Painter Bartholomeus Van Bassen
National Gallery Technical Bulletin Volume 26, 2005 National Gallery Company London Distributed by Yale University Press Series editor Ashok Roy © National Gallery Company Limited 2005 All rights reserved. No part of this publication may be transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher. First published in Great Britain in 2005 by National Gallery Company Limited St Vincent House, 30 Orange Street London wc2h 7hh www.nationalgallery.co.uk British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this journal is available from the British Library isbn 1 85709 341 0 issn 0140 7430 525046 Publisher Kate Bell Project manager Jan Green Editor Diana Davies Designer Tim Harvey Picture research Xenia Corcoran and Kim Klehmet Production Jane Hyne and Penny Le Tissier Printed in Italy by Conti Tipocolor front cover Rubens, The Judgement of Paris (NG 194), detail of plate 1, page 4. title page Joachim Beuckelaer, The Four Elements: Air (NG 6587), detail of serving girl. The Design Practices of the Dutch Architectural Painter Bartholomeus van Bassen axel rüger and rachel billinge artholomeus van bassen (c.1590–1652) was Cunerakerk, Rhenen (plate 1) is the only painting Bthe first Dutch painter to specialise in the genre in the National Gallery that can be reliably attrib- of architectural painting. He is now principally uted to the artist.3 remembered for the pivotal role he played