15014 Eb8804 Pdf Eb8804
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bach: Goldberg Variations
The Choir of King’s College, Cambridge Final Logo Brand Extension Logo 06.27.12 BACH GOLDBERG VARIATIONS Parker Ramsay | harp PARKER RAMSAY Parker Ramsay was the first American to hold the post of Organ Scholar at King’s, from 2010–2013, following a long line of prestigious predecessors. Organ Scholars at King’s are undergraduate students at the College with a range of roles and responsibilities, including playing for choral services in the Chapel, assisting in the training of the probationers and Choristers, and conducting the full choir from time to time. The position of Organ Scholar is held for the duration of the student’s degree course. This is Parker’s first solo harp recording, and the second recording by an Organ Scholar on the College’s own label. 2 BACH GOLDBERG VARIATIONS Parker Ramsay harp 3 CD 78:45 1 Aria 3:23 2 Variatio 1 1:57 3 Variatio 2 1:54 4 Variatio 3 Canone all’Unisono 2:38 5 Variatio 4 1:15 6 Variatio 5 1:43 7 Variatio 6 Canone alla Seconda 1:26 8 Variatio 7 al tempo di Giga 2:24 9 Variatio 8 2:01 10 Variatio 9 Canone alla Terza 1:49 11 Variatio 10 Fughetta 1:45 12 Variatio 11 2:22 13 Variatio 12 Canone alla Quarta in moto contrario 3:21 14 Variatio 13 4:36 15 Variatio 14 2:07 16 Variatio 15 Canone alla Quinta. Andante 3:24 17 Variatio 16 Ouverture 3:26 18 Variatio 17 2:23 19 Variatio 18 Canone alla Sesta 1:58 20 Variatio 19 1:45 21 Variatio 20 3:10 22 Variatio 21 Canone alla Settima 2:31 23 Variatio 22 alla breve 1:42 24 Variatio 23 2:33 25 Variatio 24 Canone all’Ottava 2:30 26 Variatio 25 Adagio 4:31 27 Variatio 26 2:07 28 Variatio 27 Canone alla Nona 2:18 29 Variatio 28 2:29 30 Variatio 29 2:04 31 Variatio 30 Quodlibet 2:38 32 Aria da Capo 2:35 4 AN INTRODUCTION analysis than usual. -

Ausgewählte Werke
Gottfried August Homilius Ausgewählte Werke Reihe 4: Instrumentalwerke Band 2 herausgegeben von Uwe Wolf In Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig Gottfried August Homilius 32 Praeludia zu geistlichen Liedern für zwei Claviere und Pedal Choralvorspiele für Orgel herausgegeben von Uwe Wolf Urtext 37.107 Vorwort […] Im nachmittäglichen Gottesdienste wurden 3 Lieder gesungen, und der seelige Mann hatte es sich zum Gesetz gemacht, allemal drey Gottfried August Homilius wurde am 2. Februar 1714 in Rosenthal verschiedene Vorspiele, auf die er sich den Sonnabend vorher sorgfältig vorbereitete, zu den 3 Liedern zu machen. […] Alle Musikkenner und (Sachsen) als Sohn eines Pastors geboren. Bereits kurz nach seiner Liebhaber versammelten sich Nachmittags in der Kirche, um diese Prälu- Geburt zog die Familie nach Porschendorf bei Pirna, wo Homilius dien zu hören, und Homilius erwarb sich damit den Ruhm eines großen, die ersten Jahre seines Lebens verbrachte.1 Nach dem Tod des Vaters selbst des größten Organisten seiner Zeit, wenn man Erfindung und Ge- wechselte er 1722 – wohl auf Betreiben seiner Mutter – an die von schmack mit in Anschlag bringt.7 deren Bruder geleitete Annenschule nach Dresden. Gegen Ende seiner Schulzeit übernahm Homilius bereits vertretungsweise den Von Daniel Gottlob Türk, einem anderen Schüler Homilius’, erfah- Organistendienst an der Annen-Kirche. ren wir, dass die erwähnte sorgfältige Vorbereitung tatsächlich im Im Mai 1735 wurde Homilius als Jurastudent an der Universität schriftlichen Fixieren der Praeludien bestand, -
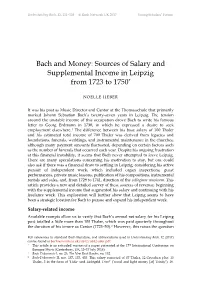
Bach and Money: Sources of Salary and Supplemental Income in Leipzig from 1723 to 1750*
Understanding Bach, 12, 111–125 © Bach Network UK 2017 Young Scholars’ Forum Bach and Money: Sources of Salary and Supplemental Income in Leipzig * from 1723 to 1750 NOELLE HEBER It was his post as Music Director and Cantor at the Thomasschule that primarily marked Johann Sebastian Bach’s twenty-seven years in Leipzig. The tension around the unstable income of this occupation drove Bach to write his famous letter to Georg Erdmann in 1730, in which he expressed a desire to seek employment elsewhere.1 The difference between his base salary of 100 Thaler and his estimated total income of 700 Thaler was derived from legacies and foundations, funerals, weddings, and instrumental maintenance in the churches, although many payment amounts fluctuated, depending on certain factors such as the number of funerals that occurred each year. Despite his ongoing frustration at this financial instability, it seems that Bach never attempted to leave Leipzig. There are many speculations concerning his motivation to stay, but one could also ask if there was a financial draw to settling in Leipzig, considering his active pursuit of independent work, which included organ inspections, guest performances, private music lessons, publication of his compositions, instrumental rentals and sales, and, from 1729 to 1741, direction of the collegium musicum. This article provides a new and detailed survey of these sources of revenue, beginning with the supplemental income that augmented his salary and continuing with his freelance work. This exploration will further show that Leipzig seems to have been a strategic location for Bach to pursue and expand his independent work. -
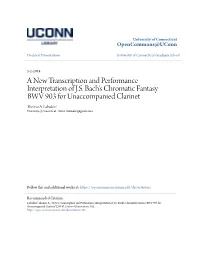
A New Transcription and Performance Interpretation of J.S. Bach's Chromatic Fantasy BWV 903 for Unaccompanied Clarinet Thomas A
University of Connecticut OpenCommons@UConn Doctoral Dissertations University of Connecticut Graduate School 5-2-2014 A New Transcription and Performance Interpretation of J.S. Bach's Chromatic Fantasy BWV 903 for Unaccompanied Clarinet Thomas A. Labadorf University of Connecticut - Storrs, [email protected] Follow this and additional works at: https://opencommons.uconn.edu/dissertations Recommended Citation Labadorf, Thomas A., "A New Transcription and Performance Interpretation of J.S. Bach's Chromatic Fantasy BWV 903 for Unaccompanied Clarinet" (2014). Doctoral Dissertations. 332. https://opencommons.uconn.edu/dissertations/332 A New Transcription and Performance Interpretation of J.S. Bach’s Chromatic Fantasy BWV 903 for Unaccompanied Clarinet Thomas A. Labadorf, D. M. A. University of Connecticut, 2014 A new transcription of Bach’s Chromatic Fantasy is presented to offset limitations of previous transcriptions by other editors. Certain shortcomings of the clarinet are addressed which add to the difficulty of creating an effective transcription for performance: the inability to sustain more than one note at a time, phrase length limited by breath capacity, and a limited pitch range. The clarinet, however, offers qualities not available to the keyboard that can serve to mitigate these shortcomings: voice-like legato to perform sweeping scalar and arpeggiated gestures, the increased ability to sustain melodic lines, use of dynamics to emphasize phrase shapes and highlight background melodies, and the ability to perform large leaps easily. A unique realization of the arpeggiated section takes advantage of the clarinet’s distinctive registers and references early treatises for an authentic wind instrument approach. A linear analysis, prepared by the author, serves as a basis for making decisions on phrase and dynamic placement. -

Inquiry Into J.S. Bach's Method of Reworking in His Composition of the Concerto for Keyboard, Flute and Violin, Bwv 1044, and Its
INQUIRY INTO J.S. BACH'S METHOD OF REWORKING IN HIS COMPOSITION OF THE CONCERTO FOR KEYBOARD, FLUTE AND VIOLIN, BWV 1044, AND ITS CHRONOLOGY by DAVID JAMES DOUGLAS B.A., The University of British Columbia, 1994 A THESIS IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES School of Music We accept this thesis as conforming tjjfe required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA October 1997 © David James Douglas, 1997 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of ZH t/S fC The University of British Columbia Vancouver, Canada Date . DE-6 (2788) Abstract Bach's Concerto for Keyboard, Flute, and Violin with Orchestra in A minor, BWV 1044, is a very interesting and unprecedented case of Bach reworking pre-existing keyboard works into three concerto movements. There are several examples of Bach carrying out the reverse process with his keyboard arrangements of Vivaldi, and other composers' concertos, but the reworking of the Prelude and Fugue in A minor, BWV 894, into the outer movements of BWV 1044, and the second movement of the Organ Sonata in F major, BWV 527, into the middle movement, appears to be unique among Bach's compositional activity. -

Zwei Orgelwerke
Johann Ringk 1717-1778 Zwei Orgelwerke Herausgegeben von Dr. Christoph Albrecht DR. J. BUTZ · MUSIKVERLAG · ST. AUGUSTIN Verl.-Nr. 1733 Vorwort In der Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin befinden sich zwei bisher wenig beachtete Auto- graphe von Johann Ringk, dem ehemaligen Organisten an der Berliner Marienkirche. Es handelt sich um ein Choralvorspiel zu Paul Eberts Silvesterlied aus dem Jahre 1569 „Helft mir, Gott’s Güte prei- sen“ (zu einer anonymen Melodie, die sich erstmals 1563 als Singweise zu „Von Gott will ich nicht lassen“ nachweisen lässt) und – als Erstdruck – um Praeludium und Fuge C–Dur. Sie tragen die Signa- turen Mus. ms. autogr. Ringk 1 und 2. Johann Ringk ist auch Kennern der Orgelmusik kaum ein Begriff. Der 1717 im thüringischen Fran- kenhain Geborene erhielt seine wesentlichen musikalischen Anregungen durch Johann Peter Kellner in Gräfenroda, der ein Schüler Johann Sebastian Bachs gewesen sein soll. Demnach hätten wir es bei Johann Ringk (wie bei Johann Christian Heinrich Rinck) mit einem Enkelschüler Bachs zu tun. Seine Hauptwirkungsstätte war die Berliner St.-Marien–Kirche, an der er von 1755 bis zu seinem Tode im Jahre 1778 Organist war. An der dortigen Joachim-Wagner–Orgel ließ er einer Überlieferung zufolge „fast nichts anderes hören ... als des alten Bach Stücke“. Seinen Zeitgenossen war er als ausgezeichne- ter Fugen–Improvisator ein Begriff. Auch Charles Burney hat er bei seinem Berlin–Besuch 1773 da- mit beeindruckt („M. Ringk ... is much esteemed as a performer of extempore fugues“); andererseits kritisiert Burney dezent Ringks spieltechnische Fähigkeiten, die angeblich denen seines Kollegen an der Petrikirche nachstanden („less brilliancy of finger than the organist of St. -

Baroque and Classical Style in Selected Organ Works of The
BAROQUE AND CLASSICAL STYLE IN SELECTED ORGAN WORKS OF THE BACHSCHULE by DEAN B. McINTYRE, B.A., M.M. A DISSERTATION IN FINE ARTS Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Approved Chairperson of the Committee Accepted Dearri of the Graduate jSchool December, 1998 © Copyright 1998 Dean B. Mclntyre ACKNOWLEDGMENTS I am grateful for the general guidance and specific suggestions offered by members of my dissertation advisory committee: Dr. Paul Cutter and Dr. Thomas Hughes (Music), Dr. John Stinespring (Art), and Dr. Daniel Nathan (Philosophy). Each offered assistance and insight from his own specific area as well as the general field of Fine Arts. I offer special thanks and appreciation to my committee chairperson Dr. Wayne Hobbs (Music), whose oversight and direction were invaluable. I must also acknowledge those individuals and publishers who have granted permission to include copyrighted musical materials in whole or in part: Concordia Publishing House, Lorenz Corporation, C. F. Peters Corporation, Oliver Ditson/Theodore Presser Company, Oxford University Press, Breitkopf & Hartel, and Dr. David Mulbury of the University of Cincinnati. A final offering of thanks goes to my wife, Karen, and our daughter, Noelle. Their unfailing patience and understanding were equalled by their continual spirit of encouragement. 11 TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS ii ABSTRACT ix LIST OF TABLES xi LIST OF FIGURES xii LIST OF MUSICAL EXAMPLES xiii LIST OF ABBREVIATIONS xvi CHAPTER I. INTRODUCTION 1 11. BAROQUE STYLE 12 Greneral Style Characteristics of the Late Baroque 13 Melody 15 Harmony 15 Rhythm 16 Form 17 Texture 18 Dynamics 19 J. -

N Historiese Perspektief Op Musikale Ontlening Met Spesifieke Verwysing Na Tematiek in Die Vrye Orrelwerke Van Buxtehude En Bach
'n Historiese perspektief op musikale ontlening met spesifieke verwysing na tematiek in die vrye orrelwerke van Buxtehude en Bach Henriette van Rensburg (nee De Vries) 10058354 Proefskrif voorgele vir die graad Philosophiae Doctor in Musiek aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit -, ...... Promotor: Prof BM Spies Hulppromotor: Prof D Kruger 2010 c:Betfankjngs mennee my opregte dan/( aan: • Prof(Bertfia Spies vir fiaar uiters 6e/(wame feicfing) fiufp) 6egrip en aanmoecfiging deurentycf; • ProfCDa[een 7(juger vir fiaar rwaardevo[[e insette; • CDr Marietjie :Hefson vir cfie f!urige taa[versorging; • Mev Janie Lamprecfit vir fiaar vriendefif! fiufpvaarcfigfieid deurentycf; • Ofga vir cfie recfigenng van cfie voor6ee[cfe)· • My man) CRyy) vir ry fiejde) 6egrip en ondersteuning; • My !?jnders vir fiu[[e gedu[c!; 6egrip en aanmoecfiging; • Vriende en k,sJ[fegas vir fiu[[e 6e[angste[fing en ondersteuning; • My J{emefse Vader vir Sy genacfe. OPSOMMING 'n Historiese perspektief op musikale ontlening met spesifieke verwysing na tematiek in die vrye orrelwerke van Buxtehude en Bach Musikale ontlening in Westerse musiek is 'n baie wye veld, waarvan die geskiedenis volgens J. Peter Burkholder nog geskryf moet word. Die hoofdoelstelling van hierdie studie is om 'n historiese perspektief op musikale ontlening te verskaf om as agtergrond te dien vir 'n vergelykende studie van die tematiek in die vrye orrelwerke van Buxtehude en Bach. Om 'n wyer perspektief op die verskynsel van musikale ont/en/ng en spore uit die verlede te kan gee, is 'n historiese bewussyn wat verder strek as Bach se onmiddellike verlede egter nodig. 'n Uteratuurstudie is onderneem oor musikale ontlening soos dit in verskillende tydperke in die verlede gemanifesteer het. -

Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV No. 3 in D Major, BWV 1068
PROGRAM NOTES by Phillip Huscher Johann Sebastian Bach Born March 21, 1685, Eisenach, Thuringia, Germany. Died July 28, 1750, Leipzig, Germany. Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068 Although the dating of Bach’s four orchestral suites is uncertain, the third was probably written in 1731. The score calls for two oboes, three trumpets, timpani, and harpsichord, with strings and basso continuo. Performance time is approximately twenty -one minutes. The Chicago Sympho ny Orchestra’s first subscription concert performances of Bach’s Third Orchestral Suite were given at the Auditorium Theatre on October 23 and 24, 1891, with Theodore Thomas conducting. Our most recent subscription concert performances were given on May 15 , 16, 17, and 20, 2003, with Jaime Laredo conducting. The Orchestra first performed the Air and Gavotte from this suite at the Ravinia Festival on June 29, 1941, with Frederick Stock conducting; the complete suite was first performed at Ravinia on August 5 , 1948, with Pierre Monteux conducting, and most recently on August 28, 2000, with Vladimir Feltsman conducting. When the young Mendelssohn played the first movement of Bach’s Third Orchestral Suite on the piano for Goethe, the poet said he could see “a p rocession of elegantly dressed people proceeding down a great staircase.” Bach’s music was nearly forgotten in 1830, and Goethe, never having heard this suite before, can be forgiven for wanting to attach a visual image to such stately and sweeping music. Today it’s hard to imagine a time when Bach’s name meant little to music lovers and when these four orchestral suites weren’t considered landmarks. -

Einleitung 2. Fass. Fußnoten.Qxp 11.11.2010 11:27 Seite 1
Einleitung 2. Fass. Fußnoten.qxp 11.11.2010 11:27 Seite 1 7 Einleitung Die beiden Werkgruppen des vorliegenden Bandes nehmen in Bachs Schaffen einen auch innerhalb der Orgelmusik eine gewisse Tradition aufzuweisen, an die Bach besonderen Platz ein. Sie gehören Gattungen an, die am Anfang des 18. Jahrhunderts anknüpfen konnte. Hier ist in erster Linie an die französische Orgeltradition zu den- der instrumentalen Ensemblemusik zugeordnet wurden und der Tastenmusik im ken, in der eine der wichtigsten Formen – das Trio für zwei Manuale und Pedal – auf Grunde fremd waren. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es sich bei einem wich- dem kammermusikalischen Modell eines langsamen Triosatzes für zwei Violinen und tigen Teil der Stücke um Bearbeitungen handelt: So basieren die Konzerte auf Generalbass beruht. Bachs Kenntnis solcher Sätze ist für die Drucksammlungen von Streicherkonzerten anderer Komponisten, die Sonaten gehen zum Teil auf eigene Boyvin, Du Mage, Grigny und Raison belegt.2 Kammermusikwerke zurück. Weitere verbindende Elemente – natürlich vor dem Innerhalb der mittel- und norddeutschen Orgeltradition vor Bach wurde der Triosatz Hintergrund der Besonderheiten dieser Werkgattungen – sind die Anlage „à 2 Clav. mit obligatem Pedal dagegen fast ausschließlich mit dem choralgebundenen Spiel in e Ped.“ sowie die Dreisätzigkeit. Verbindung gebracht.3 Dabei herrscht jener Satztyp vor, bei dem die Choralmelodie ins Pedal verlegt und als eine Art Generalbasslinie neu interpretiert wird. Choraltrios, Die Sechs Sonaten und einzelne Sonatensätze bei denen die Choralmelodie in einer oder beiden Oberstimmen mehr oder weniger In den sechs Sonaten für Orgel BWV 525–530 verbinden sich verschiedene Merkmale koloriert auftritt und das Pedal eine reine Generalbassfunktion übernimmt, sind viel von Bachs kompositorischem Schaffen der 1720er Jahre. -

1. Die Musikerfamilie Bach Kat. 1: "Ursprung Der Musicalisch-Bachischen Familie", Sog. Genealogie, Wahrscheinlich
Jens Ph. Wilhelm, "Dieß wunderbarste Räthsel aller Zeiten" (R. Wagner): Johann Sebastian Bach 1 Johann Sebastian Bachs Herkunft, Leben, Werk und Nachwirken (Katalogteil) - Auszug aus dem Katalog zu der Mannheimer Ausstellung des Bachhauses Eisenach (25.2.-26.3.2000) - 1. Die Musikerfamilie Bach Kat. 1: "Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie", sog. Genealogie, wahrscheinlich von Johann Sebastian Bach Ende 1735 verfaßt, hier in der Abschrift Anna Carolina Philippina Bachs mit Zusätzen Carl Philipp Emanuel Bachs (sog. Quelle A) [Faksimile (Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz. Musikabteilung mit Mendelssohn- Archiv, Mus. ms. theor. 1215) - Bachhaus Eisenach; Bachdok. I/184] S.u. Dok. 1 mit einem Auszug hieraus. - Die von Bach verfaßte Genealogie ist in drei Abschriften überliefert. Sie umfaßt über einen Zeitraum von mehr als 150 Jahren biographische Angaben zu 53 Mitgliedern der Familie Bach, fast ausnahmslos Musiker. Zusammen mit dem von Bach verwahrten "Alt-Bachischen Archiv" mit Kompositionen seiner Vorfahren und Verwandten (Kat. 5) ist sie Ausdruck seines ausgeprägten Familiensinns. (Die fragmentarische Quelle C der Genealogie befindet sich übrigens im Bachhaus Eisenach [Inv. 3.1.3.5 = R 11 aF].) Kat. 2: Stammbaum der Familie Bach, nach einer Vorlage - wohl aus dem Besitz Carl Philipp Emanuel Bachs - im 18. Jahrhundert angefertigt [Faksimile (Bibliothèque Royale Bruxelles, Sammlung Johann Jacob Heinrich Westphal) - Bachhaus Eisenach] Die Genealogie (Kat. 1) und der nach ihr angefertigte Stammbaum dienten neben dem sog. Nekrolog (Kat. 63) dem ersten Bachbiographen Johann Nikolaus Forkel als Quellen für seine Schrift "Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke" (Kat. 89). Kat. 2a: Stammbaum der Familie Bach, hrsg. vom Böhnerverein zu Gotha [Faksimile Eisenach 1999 (Bachhaus Eisenach) - Privatbesitz] Kat. -

15. Bis 17. Mai 2009
Tage der Mitteldeutschen Barockmusik in Altenburg 15. bis 17. Mai 2009 „daß es gut dauerhafft sey“ Bach, Trost, Krebs Weltklang, Gotteslob und musikalisches Vergnügen Programmheft01.indd 1 05.05.2009 13:11:01 Die Tage der Mitteldeutschen Barockmusik 2009 werden von der Ständigen Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachen-Anhalt und Thüringen e.V. in Kooperation mit der Stadt Altenburg veranstaltet. Schirmherr Der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Dieter Althaus Gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt das Thüringer Kultusministerium Mit freundlicher Unterstützung und Dank für die Zusammenarbeit Residenzschloss Altenburg – Eigenbetrieb der Stadt Altenburg Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg Lindenau-Museum Altenburg MDR Figaro Dr. Felix Friedrich, Altenburg Programmheft01.indd 2 05.05.2009 13:11:01 Tage der Mitteldeutschen Barockmusik in Altenburg 15. bis 17. Mai 2009 „daß es gut dauerhafft sey“ Bach, Trost, Krebs Weltklang, Gotteslob und musikalisches Vergnügen Programmheft01.indd 3 05.05.2009 13:11:07 Das Programm Freitag, 15. Mai 2009, 19.30 Uhr Sonnabend, 16. Mai 2009, 15.00 Uhr Schlosskirche | Residenzschloss Bachsaal | Residenzschloss Orgel & Lesung Wissenschaftliche Lesung aus dem Roman Die Offenbarung Festveranstaltung von Robert Schneider Begrüßung und Einführung: Es erklingen an der Trost-Orgel Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann Werke von Johann Sebastian Bach und Johann Ludwig Krebs Der Bachschüler Johann Ludwig Krebs und die Trost-Orgel in Altenburg | Robert Schneider, Lesung Präsentation des Felix Friedrich, Orgel Krebs-Werkverzeichnisses Dr. Felix Friedrich, Altenburg Zur Geschichte der Residenzstadt Altenburg Dr. Andreas Klinger, Jena Bestände italienischer Renaissancemusik in Thüringen Prof. Dr.