Baunetzwoche#309
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ANNE TYNG: INHABITING GEOMETRY April 15 – June 18, 2011 GRAHAM FOUNDATION
ANNE TYNG: INHABITING GEOMETRY April 15 – June 18, 2011 GRAHAM FOUNDATION Anne Tyng, A Life Chronology By: Ingrid Schaffner, Senior Curator, Institute of Contemporary Art Philadelphia & William Whitaker, Curator and Collections Manager, The Architectural Archives, University of Pennsylvania All quotes: Anne Tyng. 1920 Bauer; classmates include Lawrence Halprin, Philip July 14: born in Jiangxi, China, to Ethel and Walworth Johnson, Eileen Pei, I.M. Pei, and William Wurster. Tyng, American Episcopal Missionaries. The fourth of five children, Tyng lives in China until 1934 with periodic furloughs in the United States. 1944 Graduates Harvard University, MA Architecture. In New York, works briefly in the offices of: Konrad Wachsmann; 1937 Van Doren, Nowland, and Schladermundt; Knoll Graduates St. Mary‘s School, Peekskill, New York. Returns Associates. to China for a family visit; continues to travel with her sister around the world via South Asia and Europe. 1945 Moves to Philadelphia to live with parents (having left as refugees of the Japanese invasion in 1939, they return to 1938 China in 1946). Employed by Stonorov and Kahn. The only Enrolls in Radcliffe College, majoring in fine arts. woman in an office of six, Tyng is involved in residential and city planning projects. 1941 1947 Takes classes at the Smith Graduate School of Architecture Joins Louis I. Kahn in his independent practice; initial and Landscape Architecture (a.k.a The Cambridge School), projects include the Weiss House (1947-50) and Genel the first women‘s school to offer architectural studies in House (1948-51), as well as the Radbill Building and the United States. -

A Biography of the American Architect Louis Kahn
Narrative Section of a Successful Application The attached document contains the grant narrative and selected portions of a previously funded grant application. It is not intended to serve as a model, but to give you a sense of how a successful application may be crafted. Every successful application is different, and each applicant is urged to prepare a proposal that reflects its unique project and aspirations. Prospective applicants should consult the Research Programs application guidelines at https://www.neh.gov/grants/research/public-scholar-program for instructions. Applicants are also strongly encouraged to consult with the NEH Division of Research Programs staff well before a grant deadline. Note: The attachment only contains the grant narrative and selected portions, not the entire funded application. In addition, certain portions may have been redacted to protect the privacy interests of an individual and/or to protect confidential commercial and financial information and/or to protect copyrighted materials. The application format has been changed since this application was submitted. You must follow the guidelines in the currently posted Notice of Funding Opportunity (see above link). Project Title: American Architect Louis Kahn (1901-1974): A Portrait in Light and Shadow Institution: Threepenny Review Project Director: Wendy Lesser Grant Program: Public Scholars 400 Seventh Street, S.W., Washington, D.C. 20506 P 202.606.8200 F 202.606.8204 E [email protected] www.neh.gov Significance and contribution My project will be the first full-length biography of the architect Louis Kahn, and the only book about him to be aimed at a wide general audience. -
![Downloaded by [New York University] at 07:16 16 August 2016 Kahn at Penn](https://docslib.b-cdn.net/cover/8191/downloaded-by-new-york-university-at-07-16-16-august-2016-kahn-at-penn-1248191.webp)
Downloaded by [New York University] at 07:16 16 August 2016 Kahn at Penn
Downloaded by [New York University] at 07:16 16 August 2016 Kahn at Penn Louis I. Kahn is widely known as an architect of powerful buildings. But although much has been said about his buildings, almost nothing has been written about Kahn as an unconventional teacher and philosopher whose influence on his students was far-reaching. Teaching was vitally important for Kahn, and through his Master’s Class at the University of Pennsylvania, he exerted a significant effect on the future course of architectural practice and education. This book is a critical, in-depth study of Kahn’s philosophy of education and his unique pedagogy. It is the first extensive and comprehensive investi- gation of the Kahn Master’s Class as seen through the eyes of his graduate students at Penn. James F. Williamson is a Professor of Architecture at the University of Memphis and has also taught at the University of Pennsylvania, Yale, Drexel University, and Rhodes College. He holds two Master of Architecture degrees from Penn, where he was a student in Louis Kahn’s Master’s Class of 1974. He was later an Associate with Venturi, Scott Brown, and Associates. For over thirty years he practiced as a principal in his own firm in Memphis with special interests in religious and institutional architecture. Williamson was elected to the College of Fellows of the American Institute of Architects in recognition of his contributions in architectural design and education. He is the recipient of the 2014 AIA Edward S. Frey Award for career contribu- tions to religious architecture and support of the allied arts. -

2012 Twenty-Seven Years of Nominees & Winners FILM INDEPENDENT SPIRIT AWARDS
2012 Twenty-Seven Years of Nominees & Winners FILM INDEPENDENT SPIRIT AWARDS BEST FIRST SCREENPLAY 2012 NOMINEES (Winners in bold) *Will Reiser 50/50 BEST FEATURE (Award given to the producer(s)) Mike Cahill & Brit Marling Another Earth *The Artist Thomas Langmann J.C. Chandor Margin Call 50/50 Evan Goldberg, Ben Karlin, Seth Rogen Patrick DeWitt Terri Beginners Miranda de Pencier, Lars Knudsen, Phil Johnston Cedar Rapids Leslie Urdang, Dean Vanech, Jay Van Hoy Drive Michel Litvak, John Palermo, BEST FEMALE LEAD Marc Platt, Gigi Pritzker, Adam Siegel *Michelle Williams My Week with Marilyn Take Shelter Tyler Davidson, Sophia Lin Lauren Ambrose Think of Me The Descendants Jim Burke, Alexander Payne, Jim Taylor Rachael Harris Natural Selection Adepero Oduye Pariah BEST FIRST FEATURE (Award given to the director and producer) Elizabeth Olsen Martha Marcy May Marlene *Margin Call Director: J.C. Chandor Producers: Robert Ogden Barnum, BEST MALE LEAD Michael Benaroya, Neal Dodson, Joe Jenckes, Corey Moosa, Zachary Quinto *Jean Dujardin The Artist Another Earth Director: Mike Cahill Demián Bichir A Better Life Producers: Mike Cahill, Hunter Gray, Brit Marling, Ryan Gosling Drive Nicholas Shumaker Woody Harrelson Rampart In The Family Director: Patrick Wang Michael Shannon Take Shelter Producers: Robert Tonino, Andrew van den Houten, Patrick Wang BEST SUPPORTING FEMALE Martha Marcy May Marlene Director: Sean Durkin Producers: Antonio Campos, Patrick Cunningham, *Shailene Woodley The Descendants Chris Maybach, Josh Mond Jessica Chastain Take Shelter -
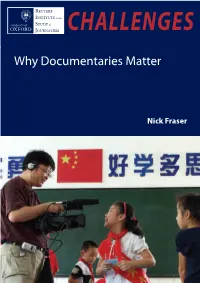
Why Documentaries Matter Recognised As an Innovative Cultural Form
RISJ CHALLENGES CHALLENGES Documentaries have for many decades inhabited the schedules of public Why Documentaries Matter Why broadcasters. They have chronicled the lives and institutions of western democracies. In the past two decades, however, documentaries have become Why Documentaries Matter recognised as an innovative cultural form. Instead of being exclusively funded by television channels, documentaries receive money from a number of sources, including film funds, private investors and foundations. Rather than observing, documentaries are now thought capable of changing the world. Is this what they really do? How do we define a documentary? What does it mean to be the ‘author’ of a film? Nick Fraser has been editor of the BBC’s Storyville series since 1997; here he looks at the history of documentaries, showing how definitions of documentaries have changed – and how fragile is their funding. If we want good documentaries, he concludes, we have to find ways of encouraging their creators. “Nick Fraser writes about documentaries with unique authority. Not only has he made some good ’uns, he has commissioned more than practically anyone else on earth (for the BBC’s Storyville) and - as this book shows - he Nick Fraser has watched docs from their earliest days. His ideas on what the growth of the web and the decline of public service broadcasters mean for doc-makers are informed, imaginative and challenging.” Brian Lapping Chairman and Executive Producer, Brook Lapping “The rise of documentaries over the past two decades owes more to Nick Fraser than to any other single person. For so many of us who make non-fiction films, Nick’s peerless brand of tough love and mischievous curiosity have inspired us to aim higher as we try to promote greater understanding of the major events and issues of our time.” Eugene Jarecki Documentary film maker “This expert lament is beautifully written. -

Hofstra University Film Library Holdings
Hofstra University Film Library Holdings TITLE PUBLICATION INFORMATION NUMBER DATE LANG 1-800-INDIA Mitra Films and Thirteen/WNET New York producer, Anna Cater director, Safina Uberoi. VD-1181 c2006. eng 1 giant leap Palm Pictures. VD-825 2001 und 1 on 1 V-5489 c2002. eng 3 films by Louis Malle Nouvelles Editions de Films written and directed by Louis Malle. VD-1340 2006 fre produced by Argosy Pictures Corporation, a Metro-Goldwyn-Mayer picture [presented by] 3 godfathers John Ford and Merian C. Cooper produced by John Ford and Merian C. Cooper screenplay VD-1348 [2006] eng by Laurence Stallings and Frank S. Nugent directed by John Ford. Lions Gate Films, Inc. producer, Robert Altman writer, Robert Altman director, Robert 3 women VD-1333 [2004] eng Altman. Filmocom Productions with participation of the Russian Federation Ministry of Culture and financial support of the Hubert Balls Fund of the International Filmfestival Rotterdam 4 VD-1704 2006 rus produced by Yelena Yatsura concept and story by Vladimir Sorokin, Ilya Khrzhanovsky screenplay by Vladimir Sorokin directed by Ilya Khrzhanovsky. a film by Kartemquin Educational Films CPB producer/director, Maria Finitzo co- 5 girls V-5767 2001 eng producer/editor, David E. Simpson. / una produzione Cineriz ideato e dirètto da Federico Fellini prodotto da Angelo Rizzoli 8 1/2 soggètto, Federico Fellini, Ennio Flaiano scenegiatura, Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio V-554 c1987. ita Flaiano, Brunello Rondi. / una produzione Cineriz ideato e dirètto da Federico Fellini prodotto da Angelo Rizzoli 8 1/2 soggètto, Federico Fellini, Ennio Flaiano scenegiatura, Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio V-554 c1987. -

The Life and Times of Louis I. Kahn
The Life and Times of Louis I. Kahn September 5-6, 2008 Guangfu Auditorium, Zhongshan Hall Produced by Zuni Icosahedron Creative and Production Team Text Louis I. Kahn Director/ Designer Mathias Woo Special Appearance Kam Kwok Leung Composer / Live Music Performance Jason Choi @PMPS Digital Images / Interactive Programming Tobias Gremmler Digital Images / Live Mixing Lawrence Choi Fong Hiu Tan Technical Director Billy Chan Production Manager Lawrence Lee Lighting Designer Tennison Siu Sound Designer Frankie Hung Production Coordinator / Stage Manager Chow Chun Yin Deputy Stage Manager Carmen Cheng Makeup Lam Alex Workshop Wardrobe Assistant Chan Wai Yee Company Manager (Administration and Programme) Doris Kan Company Manager (Finance) Jacky Chan Creative Coordinator Chan Ho Fung Creative Assistant / Subtitle Operator Pamela Tsui Publicity and Media Coordinator Luka Wong Programme Coordinator Bowie Chow 1 The Art of Multi-Media Zuni Icosahedron (Hong Kong) Zuni Icosahedron, with a history of 26 years, is the premiere of Hong Kong's avant-garde and experimental theatre. It has always stayed on the cutting edge of media technology in presenting the interactive relationship between multi-media and theatre, as well as in probing the possibilities of form and content in 'theatre space' through experimentation and exploration. Zuni has been most inspiring in developing the aesthetics of theatre in Chinese society, with its experimental and subversive nature, and this could be seen in the interactive experiments in the narrative (or rather non-narrative), form and space in their early works. The same spirit could be found in the multi-media design in lights, images, sounds and spaces as in the attempts in the area of cross-media performances, to cross-boundary political and civil area, and to cross-region international cultural exchanges. -

Maquetas: Entre La Representación Y La Simulación / Live of the Models: Between Representation and Simulation
20 16 ● EDITORIAL ● vida DE las Maquetas: ENTRE la REPRESENtaciÓN Y la SIMulaciÓN / LIVE OF THE MODELS: BETWEEN REPRESENTATION AND SIMULATION. Miguel Ángel de la Cova Morillo-Velarde ● ARTÍCULOS MAQUETAS 15 ● LA MAQUETA DE CÁDIZ DE 1779. UTILIDAD MILITAR O METÁFORA DE PODER / THE SCALE MODEL OF CADIZ AÑO VII 1779. MILITARY UTILITY OR POWER METAPHOR. Grabiel Granado Castro; José Antonio Barrera Vera; Joaquín Aguilar Camacho ● RETRATANDO SUEÑOS. FOTOGRAFÍAS DE MAQUETAS DE ARQUITECTURA MODERNA EN ESPAÑA / PORTRAYING 15 DREAMS. PHOTOGRAPHS OF MODERN ARCHITECTURE MODELS IN SPAIN. Iñaki Bergara Serrano ● TRASLACIONES MIESIANAS / MIESIANAS’ TRANSLATIONS. Valentín Trillo-Martínez ● JEAN PROUVÉ Y KONRAD WACHSMANN. DOS FORMAS DE UTILIZAR ARQUITECTURA ARQUITECTURA LA MAQUETA COMO HERRAMIENTA DE PROYECTO / JEAN PROUVÉ AND KONRAD WACHSMANN. TWO WAYS OF USING THE SCALE MODEL AS A TOOL FOR PROJECTING. Ruth Arribas Blanco ● BOCETANDO UNA “SÍNTESIS DE LAS ARTES”. LE CORBUSIER MODELA EN NUEVA YORK / SKETCHING A “SYNTHESIS OF ARTS”. LE CORBUSIER MODELS NEW YORK. Miguel Ángel de la Cova Morillo-Velarde ● LOUIS I. KAHN, EL PAISAJE TELÚRICO Y LAS MAQUETAS DE ARCILLA / LOUIS I. KAHN, THE TELLURIC LANDSCAPE AND CLAY MODELS. José María Jové Sandoval ● LA GENERACIÓN DEL ESTRUCTURALISMO HOLANDÉS A TRAVÉS PROGRESO DE SUS MAQUETAS. EL CASO DE HERMAN HERTZBERGER, 1958-1968 / DUTCH STRUCTURALISM GENERATION THROUGH ITS MODELS. THE CASE OF HERMAN HERTZBERGER, 1958-1968. Víctor Rodríguez Prada ● ENRIC MIRALLES Y LAS MAQUETAS: PENSAMIENTOS OCULTOS ENTRECRUZADOS Y OTRAS INTUICIONES / ENRIC MIRALLES AND MODELS: HIDDEN INTERTWINED THOUGHTS AND OTHER INTUITIONS. Jesús Esquinas Dessy; Isabel Zaragoza de Pedro ● ARQUITECTURAS MINIATURIZADAS Y SU CONTEXTUALIZACIÓN EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO / MINIATURISED ARCHITECTURE AND ITS CONTEXTUALISATION IN CONTEMPORARY ART. -

Architecture Program Report for 2012 NAAB Visit for Continuing Accreditation
Philadelphia University Architecture Program, College of Architecture and the Built Environment Architecture Program Report for 2012 NAAB Visit for Continuing Accreditation Bachelor of Architecture (166-68 credit hours) Year of the Previous Visit: 2006 Current Term of Accreditation: At the March 2007 meeting of the National Architectural Accrediting Board (NAAB), the board reviewed the Visiting Team Report of the Philadelphia University School of Architecture. “The board noted the concern of the visiting team regarding problems with in several areas. As a result, the professional architecture program – Bachelor of Architecture (166 credit hours) – was formally granted a six-year term of accreditation with the stipulation that a focused evaluation be scheduled in two years to look only at the following: Human Resources and Physical Resources and the progress that has been made in those areas. The accreditation term is effective January 1, 2006. The program is scheduled for its next full accreditation visit in 2012. The focused evaluations are scheduled for the calendar year 2009.” Response to 2009 Focused Visit “After reviewing the Focused Evaluation Program Report submitted by the Philadelphia University Department of Architecture and Interiors as part of the focused evaluation of its Bachelor of Architecture program, in conjunction with the Focused Evaluation Team Report, the National Architectural Accrediting Board (NAAB) has found that the changes made or planned by the program to remove the identified deficiencies are satisfactory. “The program will not be required to report on these deficiencies as part of its Annual Report (AR) to the NAAB; however, the program should continue to include a response to any other deficiencies listed in the most recent Visiting Team Report, as well as report on any modifications made in the program that may affect its adherence to the conditions for accreditation. -

Louis Kahn: the Power of Architecture Synagogue (1961-1972, Unbuilt, Philadelphia, USA)
NEWS Louis Kahn: The Power of Architecture Synagogue (1961-1972, unbuilt, Philadelphia, USA). Kahn’s clever use of concrete in each of Exhibition at London Design Museum his projects is well represented in this section through the use of different materials in London, UK, 9 July – 12 October 2014 models and drawings. Apart from the aesthetics of the building, Kahn was also concerned with the elements Louis Kahn: The Power of Architecture is a conse- studies relating the structure of the building that surround every construction, which led quent review and historic summary of Louis to science, with the ultimate result being the us to the “Grounding. Earth, water, wind, I. Kahn’s life, 20 years after the last exhibition project (unbuilt) of the City Tower (designed light” part, where we can find the best rep- about him1. This exhibition, compiling the in collaboration with Anne Tyng, 1952-1957, resentative projects designed by him, related main works and research projects of Kahn, is Philadelphia, USA) whose structure directly to nature. This is seen through his utilization a full experience that allows the public to get evokes the DNA formula. This part ends with of colorful expressive sketches of projects: to know the life of one of the most important the comparison between drawings and the The General Motors Exhibit at the 1964 American architects of the 20th century2. timber models of the Alfred Newton Rich- World’s Fair (1960-1961), the Salk Institute for The starting point of the exhibition is a ards Medical Research and Biology Buildings Biological Studies (1959-1965, La Jolla, USA) chronological list of projects (1926-1974) of (1957-1965, Philadelphia, USA), the Library and the Kimbell Art Museum (1966-1972, Fort Kahn, entailing his works as a design consul- and Dining Hall at Phillips Exeter Academy Worth, USA). -

The Uncharted Kahn: the Visuality of Planning and Promotion in the 1930S and 1940S Andrew M
The Uncharted Kahn: The Visuality of Planning and Promotion in the 1930s and 1940s Andrew M. Shanken An often overlooked change occurred in urban planning arcane and technical languages of urban planning to the lay between the 1920s and the 1940s, one represented in the public. following two images. In the first, the frontispiece of a 1936 Kahn's engagement with diagrams offers an illuminating report on city planning in New York City, the allegorical study of a larger international phenomenon in which an figure of city planning, in her guise as "Enlightment," strides array of graphic techniques drawn from other fields altered down a New York City avenue toppling buildings and eradi- the representational basis of architecture and planning. In cating slums (Fig. 1).1 In her wake emerges a shining, white the 1930s, architects worked extensively with images that one city: the gossamer of her dress sweeps away the human stain. is tempted to call unarchitectural: graphs, charts, diagrams, orga- It is an image of beautification, a term associated with city and the promotional material put out by city planning planning in the first decades of the twentieth century. The nizations, materials that described neither the architectonic qualities of buildings. Naturally, charts and City Beautiful Movement emerged in name and practice nor the spatial planning from this rhetoric, growing out of the French embellisement, a diagrams have played a role in architecture and throughout history. But their use intensified in the 1930s with word used to describe Georges Haussmann's accomplish- the rise of the government as the largest client, the emer- ment in Paris. -

Toward a New Approach to Evaluating Significance in Recent-Past Preservation Planning with a Case Study of 1960S Properties in Philadelphia County Kristin M
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Theses (Historic Preservation) Graduate Program in Historic Preservation 2011 Toward a New Approach to Evaluating Significance in Recent-Past Preservation Planning with a Case Study of 1960s Properties in Philadelphia County Kristin M. Hagar University of Pennsylvania Follow this and additional works at: http://repository.upenn.edu/hp_theses Part of the Historic Preservation and Conservation Commons Hagar, Kristin M., "Toward a New Approach to Evaluating Significance in Recent-Past Preservation Planning with a Case Study of 1960s Properties in Philadelphia County" (2011). Theses (Historic Preservation). 171. http://repository.upenn.edu/hp_theses/171 Suggested Citation: Hagar, Kristin M. (2011). Toward a New Approach to Evaluating Significance in Recent-Past Preservation Planning with a Case Study of 1960s Properties in Philadelphia County. (Masters Thesis). University of Pennsylvania, Philadelphia, PA. This paper is posted at ScholarlyCommons. http://repository.upenn.edu/hp_theses/171 For more information, please contact [email protected]. Toward a New Approach to Evaluating Significance in Recent-Past Preservation Planning with a Case Study of 1960s Properties in Philadelphia County Abstract In evaluating a stock of recent-past buildings, it is important to stay alert to the ways in which recent-past heritage is more difficult to assess, and what we might be prone to do to make it easier to assess. It is not enough to involve numerous people in the process and to articulate our method of analysis. We as preservation professionals must also consciously strive to avoid cognitive shortcuts. We must set evaluative standards and choose priorities, without simply dismissing a great portion of the built environment as “crap” or accepting self-evidence as a measure of significance.