Ehemalige Synagoge Hemsbach Von Rudolf Beringer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Presseinformation 11/07/2016
DATUM PRESSEINFORMATION 11/07/2016 TransnetBW GmbH Pariser Platz Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart TransnetBW informiert Öffentlichkeit im Rhein-Neckar-Kreis zu Fortschritt des Projekts ULTRANET und zur 380-kV-Netzverstärkung Weinheim-Karlsruhe / Einladung zu Infomärkten in Ilvesheim am 21. Juli und in Schwetzingen am 22. Juli / Planungsstand ULTRANET wird vorgestellt / Erstinformation der Bürgerschaft zur Netzverstärkung Stuttgart. TransnetBW bereitet für ihr Netzausbauprojekt ULTRANET den nächsten Planungsschritt vor: Im Herbst 2016 soll der Untersuchungsrahmen für das Leitungsvorhaben abgearbeitet und der Antrag nach § 8 Netzausbaubeschleunigungsgesetz bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden. Das Gleichstromprojekt ULTRANET verbindet Baden- Württemberg mit den erneuerbaren Energiequellen von morgen und ist ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Energiewende. Um die Öffentlichkeit wie bisher über die Planungen auf dem Laufenden zu halten, veranstaltet TransnetBW im Juli zwei Infomärkte im Rhein-Neckar-Kreis in Ilvesheim und Schwetzingen. Bürgerinfomarkt Ilvesheim, 21. Juli 2016, 16:00-20:00 Uhr, Mehrzweckhalle Ilvesheim, Mühlenweg 71, 68549 Ilvesheim Bürgerinfomarkt Schwetzingen, 22. Juli 2016, 16:00-20:00 Uhr, Josefshaus Katholische Kirchengemeinde Schwetzingen, Schlossstraße 8, 68723 Schwetzingen „Der Dialog mit der Öffentlichkeit ist ein elementarer Bestandteil in unserer Projektarbeit“, sagt Projektsprecherin Maria Dehmer. „Mit unseren beiden Veranstaltungen bieten wir allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich individuell über den Projektfortschritt zu informieren und die sie betreffenden Themen mit den Experten der TransnetBW zu erörtern.“ Die Infomärkte dienen auch dazu, die Öffentlichkeit bereits vor der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem aktuellsten Planungsstand vertraut zu machen. Ein weiteres Projekt, das die TransnetBW zu den Infomärkten erstmalig in der allgemeinen Öffentlichkeit präsentiert, ist die 380-kV-Netzverstärkung Weinheim-Karlsruhe. -

20191024 GR Gemeinsamer Gutachterausschuss Mit Weinheim
6. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit Geschäftsstelle in Weinheim mit den benachbarten Gemeinden im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis; Beschluss. Sachverhalt: Wie bereits in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 21. April 2016 vorgestellt, besteht die Absicht zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit den benachbarten Gemeinden und der Kreisstadt Weinheim. Die gesetzlichen Aufgaben der Gutachterausschüsse sind bundesweit im § 192 ff. BauGB geregelt. Neben der Erstattung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechten an Grundstücken gehören dazu insbesondere die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die Ableitung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten wie Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten und Vergleichsfaktoren für verschiedene Grundstücksarten. Um diese gesetzlich geforderten Daten verlässlich ableiten zu können, ist eine ausreichende Anzahl von Kauffällen erforderlich, die in der Kaufpreissammlung gespeichert und ausgewertet werden müssen. Während die Aufgaben der Gutachterausschüsse bundesweit geregelt sind, sind die Einzelheiten bezüglich ihres Zuständigkeitsbereichs und ihrer Zusammensetzung in den Gutachterausschussverordnungen der Länder festgelegt. In Baden-Württemberg sind daher die Gutachterausschüsse bei den Gemeinden zu bilden. Damit unterscheiden sich die hiesigen Strukturen gravierend von denen in anderen Bundesländern, die größere Zuständigkeitsbereiche, z.B. auf Kreisebene, festgelegt -

Baubedingte Fahrplanänderungen Baden-Württemberg Regionalverkehr
Baubedingte Fahrplanänderungen Baden-Württemberg Regionalverkehr Auch als App! Hier klicken und mehr erfahren Herausgeber Kommunikation Infrastruktur der Deutschen Bahn AG https://bauinfos.deutschebahn.com/apps Stand 3.2.2021 Mannheim KBS 650 Frankfurt – Darmstadt Heidelberg – Wiesloch-Walldorf Hockenheim in den Nächten Freitag/Samstag, 5./6. bis Donnerstag/Freitag, 11./12. Februar, jeweils 21.30 – 5.15 Uhr Zugausfall und Ersatzverkehr Frankfurt (Main) Hbf Darmstadt Hbf sowie spätere Fahrtzeiten Mehrere RE- und RB-Züge fallen zwischen Frankfurt (Main) Hbf und Darmstadt Hbf aus. Als Ersatz nutzen Sie bitte die S-Bahnen zwischen Frankfurt (Main) Hbf und Langen (Hess) sowie die Busse zwischen Langen (Hess) und Darmstadt Hbf. Beachten Sie die bis zu 90 Min. frühere Abfahrt/spätere Ankunft in Frankfurt (Main) Hbf bzw. Lan- gen (Hess). Die Mitnahme von Fahrrädern ist im Schienenersatzverkehr ausgeschlossen. Details: https://bauinfos.deutschebahn.com/docs/bw/infos/650_05-12022021_fahrplan.pdf Kontaktdaten: https://bauinfos.deutschebahn.com/kontaktdaten/SBahnRheinMain Grund: Gleiserneuerung Langen (Hess) – Darmstadt Hbf folgende Meldung geändert von Montag, 15. bis Freitag, 19. Februar, jeweils ganztägig Ausfall und Schienenersatzverkehr Bensheim Mannheim Hbf/Heidelberg Hbf (verschie- dene Abschnitte) Die S-Bahnen der Linie S 6 (Mainz – Bensheim) werden zwischen Bensheim und Ladenburg durch Busse ersetzt. Beachten Sie die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse. Hinweis: Einzelne S-Bahnen fallen morgens von Mannheim Hbf bis Bensheim aus. Einzelne RB-Züge fallen auf verschiedenen Abschnitten zwischen Bensheim und Heidelberg Hbf aus. Als Ersatz nutzen Sie bitte die Busse sowie den öffentlichen Personennahverkehr. Beachten Sie die vom Zugverkehr abwei- chenden Fahrzeiten der Busse. Beachten Sie zudem, dass die Busse nicht alle Unterwegshalte bedienen. -

Für Jede Lage Der Richtige Zug... Entlastungszüge Zur Bergsträßer Weinlagenwanderung
Für jede Lage der richtige Zug... Entlastungszüge zur Bergsträßer Weinlagenwanderung Fahrplanauszug Sonderzüge in roter Schrift gültig 01.05.2017 Anreise Abreise RB RB RB RB RB Die nebenstehend in schwarzer 15349 15670 Gleis 38291 Gleis 15351 15672 Gleis Frankfurt (Main) Hbf 9:06 9:34 13 10:06 16:46 Schrift aufgeführten Züge sind wegen Langen (Hess) 9:16 9:44 10:16 16:56 der Anreise zur Bergsträßer Darmstadt Hbf 9:25 9:53 10:25 17:04 Darmstadt Hbf 9:30 9:55 10:30 17:05 Weinlagenwanderung bereits sehr Darmstadt Süd 9:33 9:59 10:33 17:08 gut ausgelastet. Darmstadt - Eberstadt 9:37 10:04 10:37 17:12 Bickenbach (Bergstr) 9:43 10:09 10:47 17:17 Hähnlein-Alsbach 9:46 10:13 10:50 17:20 Damit Sie völlig entspannt an der Zwingenberg (Bergstr) 9:49 10:16 10:53 17:23 Bensheim-Auerbach 9:52 10:20 10:56 17:26 Veranstaltung teilnehmen können, Bensheim 9:54 10:22 10:59 17:28 setzt die Deutsche Bahn an diesem Bensheim 9:55 10:24 10:50 3 10:59 17:29 Heppenheim (Bergstr) 10:00 10:29 10:55 2 11:04 17:33 Tag zwei zusätzliche Zugpaare Laudenbach (Bergstr) 10:03 10:33 2 10:59 1 11:07 17:37 2 zwischen Frankfurt und Hemsbach Hemsbach 10:06 10:37 3 11:02 1 11:10 17:40 2 Weinheim (Bergstr) 10:09 10:42 1 11:06 3 11:13 bzw. Weinheim sowie ein Weinheim (Bergstr) 10:10 11:07 3 11:14 zusätzliches Zugpaar zwischen Weinheim-Lützelsachsen 10:13 11:10 2 11:17 Heddesheim-Hirschberg 10:16 11:13 1 11:20 Mannheim und Bensheim ein. -

Pflegestützpunkte
Pflegestützpunkte Plötzlich kann alles anders sein: Schlaganfall - Unfall - schwere Erkrankung - im Rhein-Neckar-Kreis Fortschreitender Unterstützungsbedarf und Wohnortnahe und vieles mehr können das Leben verändern. neutrale Beratungsstellen Was tun im Pflegefall? Für alle Fragen in diesem Zusammenhang STANDORTE Leistungen der Pflegestützpunkte bieten die Pflegestützpunkte Beratung und VERNETZUNG.. Unterstützung an. Pflegestützpunkte sind Anlaufstellen zu Fragen BERATUNG rund um das Thema Pflege, Alter und Versorgung. Alles rund um Alter und Pflege Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Für eine umfassende Beratung beraten Sie unter Wahrung des Datenschutzes unabhängig, kostenfrei und umfassend. Bei Be- empfehlen wir darf wird die notwendige Hilfe organisiert und eine Terminvereinbarung! umfangreiche Hilfenetzwerke aktiv koordiniert. Viele Fragen entstehen bereits bevor Hilfe be- nötigt wird oder wenn sich Pflegebedürftigkeit Nach Absprache können auch Termine außer- anbahnt, bzw. sich die Pflegesituation verschlim- halb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Weinheim mert: Ilvesheim Bei Bedarf sind auch Hausbesuche möglich. Ladenburg Welche Hilfen gibt es? Wie komme ich an diese Hilfen? Plankstadt Eberbach Was kosten die Angebote? Schwetzingen Wie wird die Pflege finanziert? Träger der Pflegestützpunkte: Neckargemünd Wo beantrage ich welche Leistungen? Wer hilft bei der Antragstellung? Hockenheim Oft genügt eine einfache Auskunft. Manchmal ist Helmstadt- Walldorf Bargen aber eine ausführliche Beratung oder auch die viel- Wiesloch -
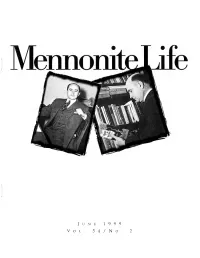
1 9 9 9 V O L . 5 4 / N O
June 1999 VOL. 54/No. 2 2 In this issue we celebrate the contributions of J. Winfield Fretz to the Mennonite community. We wish Winfield well in his 89th year. An article by Leland Harder, retired Mennonite sociologist in North Newton, Kansas, reviews Winfield's life story. Paul Toews, professor of history at Fresno J_L1I n l/fihh LLo looLi s s u J.C e ' placesPacificUniversity' Fretz in the context of Mennonite scholarship in the twentieth century. Calvin Redekop, another retired Mennonite sociologist, of Harrisonburg, Virginia, gives a retrospective review of one of Winfield Fretz's most important books. Pilgrims in Paraguay. Barbara A. Thiesen, co-director of libraries at Bethel College, presents a bibliography of Fretz's writings. This issue also includes the annual Mennonite Bibliography for 1998, an ever-growing list of publications related to Mennonite history, life, and thought. Photo credits: J. Winfield Fretz, p. 6, 7, 8, 14; Mennonite Library and Archives, front cover, p. 4,12,13,18,20, 21,26 M e n n o n i r I-; L i r n 3 History The Personal and Scholarly Pilgrimage of J. Winfield Fretz Contents Leland Harder J. Winfield Fretz and the Early History of Mennonite Sociology Paul Toezus 17 Pilgrims in Paraguay: A Retrospective Review Calvin Redekop 25 J. Winfield Fretz Bibliography Barbara A. Thiesen 28 Mennonite Bibliography, 1998 Barbara A. Thiesen 30 J U N I£ 19 9 9 4 L e I a n d Harder The Personal and Scholarly y Pilgrimage of L&L Winfield Fretz Winfield at Bethel College, ca, l$4 6, with Europear George JpaMdii McCormick Armstrong I’luilo Studio, Wichita, Kansas Wichita, Studio, I’luilo Armstrong McCormick Mennonite Life L e I a n d Harder 5 ? T infield was the ninth of eleven plain dress. -

Impersonal Names Index Listing for the INSCOM Investigative Records Repository, 2010
Description of document: US Army Intelligence and Security Command (INSCOM) Impersonal Names Index Listing for the INSCOM Investigative Records Repository, 2010 Requested date: 07-August-2010 Released date: 15-August-2010 Posted date: 23-August-2010 Title of document Impersonal Names Index Listing Source of document: Commander U.S. Army Intelligence & Security Command Freedom of Information/Privacy Office ATTN: IAMG-C-FOI 4552 Pike Road Fort George G. Meade, MD 20755-5995 Fax: (301) 677-2956 Note: The IMPERSONAL NAMES index represents INSCOM investigative files that are not titled with the name of a person. Each item in the IMPERSONAL NAMES index represents a file in the INSCOM Investigative Records Repository. You can ask for a copy of the file by contacting INSCOM. The governmentattic.org web site (“the site”) is noncommercial and free to the public. The site and materials made available on the site, such as this file, are for reference only. The governmentattic.org web site and its principals have made every effort to make this information as complete and as accurate as possible, however, there may be mistakes and omissions, both typographical and in content. The governmentattic.org web site and its principals shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damage caused, or alleged to have been caused, directly or indirectly, by the information provided on the governmentattic.org web site or in this file. The public records published on the site were obtained from government agencies using proper legal channels. Each document is identified as to the source. -

S Eniorenfonds N Eckar B Ergstraße
AUSKÜNFTE UND SPENDENQUITTUNGEN sind über folgende Adressen erhältlich: DIAKONISCHES WERK WEINHEIM Hauptstraße 72, 69469 Weinheim Tel.: 06201 90290 [email protected] www.dw-rn.de oder CARITASVERBAND FÜR DEN RHEIN-NECKAR-KREIS E.V. Paulstraße 2, 69469 Weinheim Tel.: 06201 99460 [email protected] www.caritas-rhein-neckar.de ergstraße B SPENDENKONTO Kontoinhaber: Diakonisches Werk Weinheim Seniorenfonds Neckar-Bergstraße IBAN: DE58 6709 2300 0005 4066 17 BIC: GENODE61WNM eckar FÖRDERPARTNER ZONTA Club Weinheim e.V. N STÄDTE / GEMEINDEN NECKAR BERGSTRASSE Weinheim Dossenheim Heiligkreuz Edingen Hohensachsen Neckarhausen Lützelsachsen Heddesheim Oberflockenbach Hemsbach Rippenweier Hirschberg-Großsachsen Ritschweier Hirschberg-Leutershausen Rittenweier Ilvesheim Steinklingen Ladenburg Sulzbach Laudenbach Wünschmichelbach Schriesheim, Altenbach UNTERSTÜTZT WIRD DER SENIORENFONDS VON ENIORENFONDS S d[sign Astrid Poß www.asteroi.de Fotos: fotolia www.asteroi.de d[sign Astrid Poß Würdevoll der Alters armut begegnen, ist eine Aufgabe, die nicht so leicht zu bewerkstelligen ist. Reiches Land – ALTE MENSCHEN AUSSEN VOR? WELCHE AUFGABEN ENTSTEHEN IN UNSERER GESELLSCHAFT, WER ÜBERNIMMT VERANTWORTUNG, WIE WOLLEN WIR DER ARMUT BEGEGNEN? Das letzte Drittel des Lebens beginnt etwa mit 60 Jahren. „Alt werden“ hat heute ein neues Gesicht bekommen. Die Definition der Familie hat sich weiter entwickelt, das hat auch Auswirkungen auf das „älter werden“. Der persönliche, finanzielle Spielraum ermöglicht einigen den Alltag zu gestalten, andere haben diesen UNTERSTÜTZUNG KANN ANGEBOTEN WERDEN: Spielraum nicht. Sie sind auf die niedrige Rente oder die Grundsicherung angewiesen, die vom Staat geleistet • Kultur, Bewegung, Teilhabe wird, um die Existenz in Deutschland zu ermöglichen. • Mobilität • Gesundheit und Lebensqualität WAS BEDEUTET GRUNDSICHERUNG IN ZAHLEN: • Anschaffungen, Reparaturen 391,00 € für Alleinstehende. -

Karte Der Erdbebenzonen Und Geologischen Untergrundklassen
Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 350 000 KARTE DER ERDBEBENZONEN UND GEOLOGISCHEN UNTERGRUNDKLASSEN FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 1: für Baden-Württemberg 10° 1 : 350 000 9° BAYERN 8° HESSEN RHEINLAND- PFALZ WÜRZBUR G Die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden- Mainz- Groß- Main-Spessart g Wertheim n Württemberg bezieht sich auf DIN 4149:2005-04 "Bauten in deutschen Darmstadt- li Gerau m Bingen m Main Kitzingen – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Freudenberg Erdbebengebieten Mü Dieburg Ta Hochbauten", herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; ub Kitzingen EIN er Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. RH Alzey-Worms Miltenberg itz Die Erdbebenzonen beruhen auf der Berechnung der Erdbebengefährdung auf Weschn Odenwaldkreis Main dem Niveau einer Nicht-Überschreitenswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb Külsheim Werbach Großrinderfeld Erbach Würzburg von 50 Jahren für nachfolgend angegebene Intensitätswerte (EMS-Skala): Heppenheim Mud Pfrimm Bergst(Bergstraraßeß) e Miltenberg Gebiet außerhalb von Erdbebenzonen Donners- WORMS Tauberbischofsheim Königheim Grünsfeld Wittighausen Gebiet sehr geringer seismischer Gefährdung, in dem gemäß Laudenbach Hardheim des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus rechnerisch die bergkreis Höpfingen Hemsbach Main- Intensität 6 nicht erreicht wird Walldürn zu Golla Bad ch Aisch Lauda- Mergentheim Erdbebenzone 0 Weinheim Königshofen Neustadt Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus Tauber-Kreis Mudau rechnerisch die Intensitäten 6 bis < 6,5 zu erwarten sind FRANKENTHAL Buchen (Odenwald) (Pfalz) Heddes-S a. d. Aisch- Erdbebenzone 1 heim Ahorn RHirschberg zu Igersheim Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus an der Bergstraße Eberbach Bad MANNHEIM Heiligkreuz- S c Ilves- steinach heff Boxberg Mergentheim rechnerisch die Intensitäten 6,5 bis < 7 zu erwarten sind Ladenburg lenz heim Schriesheim Heddesbach Weikersheim Bad Windsheim LUDWIGSHAFEN Eberbach Creglingen Wilhelmsfeld Laxb Rosenberg Erdbebenzone 2 a. -

Information on Visa/ Residence Permit
Visa or Residence Permit Who needs a visa or a residence permit? Students who are citizens of a member state of the EU (European Union) and the EEA (European Economic Area, i.e. Iceland, Liechtenstein, Norway) do not need a visa or residence permit. At the time of enrolment at Heidelberg University you must present a valid passport or national identity card. All international students from outside the EU and the EEA generally need a visa or a residence permit in order to study at Heidelberg University. Either document has to be presented at the time of enrolment. The visa or the residence permit must be valid and generally issued for the respective study programme at Heidelberg University. When do you have to apply for a visa and/or a residence permit? a) Students from Andorra, Australia, Brazil, Canada, El Salvador, Honduras, Israel, Japan, Monaco, New Zealand, San Marino, South Korea, Switzerland and the United States may enter Germany without a visa. If students are planning on staying longer than three months, they will have to apply for a residence/study permit at the local Foreigners’ Registration Office (Ausländerbehörde). You can enrol with a valid passport before you receive the extension of the three-month period for a longer stay. b) Students from all other countries must obtain a visa (for study purposes) before departing for Germany. The application for a visa for study purposes must be made at the German Embassy/Consulate in the student’s home country. After arrival, students have to apply for an extension of their stay in form of a residence permit at the Foreigners’ Registration Office. -

Weinheim Von Norden Um 1930
zu gewinnenTolle ! Die Blühende Bergstraße und der Blütenweg Preise Die Blühende Bergstraße verdankt ihren Namen den vielen Obstbäumen, die zusammen mit dem Wein die Kulturlandschaft prägen. Bereits vor beinahe 400 Jahren rühmte Merian die Bergstraße wegen ihres auserlesenen Weins und 11 den schönen Obstgärten. Weinheim von Norden um 1930 Die Blühende Bergstraße mit dem Blütenweg ist daher schon seit langem ein Begriff bei Wanderern und Erholungsuchenden - und der neue Blütenweg hat sie noch attraktiver gemacht! 12 Hierzu wurde der Weg aus den Ortschaften in die freie Landschaft verlegt und bietet herrliche Aussichtspunkte. Der Anteil breit Wir lassen‘s ausgebauter Wege wurde so gering wie blühen! möglich gehalten. Abschnitte mit schmalen Pfaden, Ausgezeichnetes Projekt im Wettbewerb Graswegen, Landschaft in Bewegung 2016 Hohlwegen, Böschungen, Trockenmauern oder www.ILEK-Bergstrasse.de anstehendem Fels geben dem Weg einen 9 urigen Charakter. Aktuelle Informationen fi nden Sie auf unserer Internetseite. Der neue Blütenweg ist die zentrale Entwicklungsachse des ILEK- Projektes für Landschaftspfl egemaßnahmen. Insbesondere auf BLÜTENWEGFEST Grundstücken am Weg soll das Blüten- und Landschaftserlebnis Bitte benutzen Sie öffentliche durch die Pfl ege der Gärten und begleitende Landschaftspfl ege Verkehrsmittel zur Anreise. gesichert und gefördert werden. Durch solche Sonntag, 23. April 2017 Pfl egemaßnahmen entstehen wieder sonnige ILEK - Geschäftsführung: Abschnitte mit Obstwiesen, Blumenwiesen, Stadtverwaltung Weinheim – Grünfl ächen- und Umweltamt 11-18 Uhr Obertorstr. 9 • 69469 Weinheim • [email protected] Blütensäumen und Trockenrasen, wo sich Weinheim Großsachsen zuvor Verbuschung breit machte. Die vielseitige Fotonachweis: Titelbild: M. Zimmermann, 1-9: R. Robra, Schlosspark Talstraße Landschaft wird wieder erlebbar. 10: G. Röhner, 11: H. Oeser, 12: B. Ullrich, 13: NAFO-Fotodesign Einige der Maßnahmen werden auf dem ILEK und ILEK-Regionalmanagement werden Blütenwegfest vorgestellt. -

Das,,Steinerne Roß" Bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis), Eine
Dietrich Lutz; Das,,Steinerne Roß" bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis), eine karolingische Grenzmarke Denkmäler der Zeit um 800 sind in unserem Land nicht haben, ihn als Grenzzeichen zu verwenden, da er von der eben häufig, noch seltener aber sind gesicherte Grenzmar- Witterung weitgehend unbeeinträchtigt über Jahrhunderte ken aus diesem Zeitraum. Deshalb nimmt es ein wenig hinweg ein sicheres Merkzeichen war. wunder, daß das „Steinerne Roß" bei Hemsbach, bei dem es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um eine derartige So finden wir denn im Nordturm der Heppenheimer Grenzmarkierung handelt, bisher in der landeskundlichen Stadtkirche in Formen des 12. Jahrhunderts auf einem Literatur nur wenig Beachtung gefunden hat. Selbst die querrechteckigen Stein die Wiedergabe einer Urkunde des sonst sehr ausführliche Kreisbeschreibung Heidelberg- Jahres 805, die unter anderem auch das „Steinerne Roß" Mannheim enthält keinen Hinweis auf dieses Geschichts- nennt (Abbildung 3). Es handelt sich dabei um die Festle- dokument. gung der Grenze des Kirchspiels Heppenheim, die Etwa 2 km nordöstlich der Kirche von Hemsbach und 600 m folgenden Wortlaut hat: Hec est terminatio • istius • ecclesie südöstlich des Altares auf dem Kreuzberg am nach • Gadero ■ Rvodhardesloch • Anzen ■ Ha/sal • Hagenbvocha • Südwesten zum Hemsbächle geneigten Hang liegt am svper montem ■ Emminesberc • vsqve ad Ci/lewardes Dorsvl Rande eines Waldweges ein Stein, der mit etwas Phantasie ■ Kecelberc • Rorensolvn • Ahvmenecga/vsqve ■ ad ■ Sihen- als das Abbild eines Pferdes aufgefaßt werden kann (Abbil- bach • a • Sihenbach • super Razen Hagan • a ■ Razen • dungen 1 und 2). Es ist ein abgerundeter, länglicher Granit- Ha/gan ■ vsqve ad Parvvm • Lvdenwisscoz • a ■ Lvdenwisscoz • block von etwa 1,5 m Höhe und annähernd doppelter vsqve • ad/Mitdelecdrvn ■ Richmannesten • vsqve Albenes- Länge, wie er im Kreuzberggebiet verschiedentlich in mehr bach • vna ■ Al/benesbach • hvc • altera • illvc ■ Fronervt • oder minder umfangreichen Blockhalden anzutreffen ist.