Masterarbeit / Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Austrian Ombudsman Board Annual Report 2018 on the Activities of the Austrian National Preventive Mechanism (NPM) Protection & Promotion of Human Rights
Austrian Ombudsman Board Annual Report 2018 on the activities of the Austrian National Preventive Mechanism (NPM) Protection & Promotion of Human Rights Preface This report documents the activities of the National Preventive Mechanism (NPM) in 2018. More than 500 monitoring visits were carried out, most of them in public and private institutions and facilities where the freedom of individuals is restricted. The responsible ministries, supervisory authorities and the affected institutions and facilities were informed about the results of the visits in detail. The NPM also strongly advocated in the year under review that the identified deficits should be rectified as quickly as possible. A large number of presentations and information events were held with the goal of raising public awareness and placing the protection of human rights on a broad basis. International cooperation was further intensified above and beyond these nationwide activities. All of these measures have a common objective: they serve to protect persons from being treated in an inhuman or degrading manner. Human dignity is at considerable risk in places where persons’ liberty is deprived in particular, such as in correctional institutions, police detention centres or retirement and nursing homes. Persons living in such places have little chance to be heard, as they have only limited contact to the outside world. To a large extent, they are at the mercy of the staff of the respective institution or facility or they are, at least, in a dependent position. This inevitably leads to precarious situations. The essence of the preventive mandate is to detect these risks as early as possible and to help in avoiding maladministration before it occurs. -
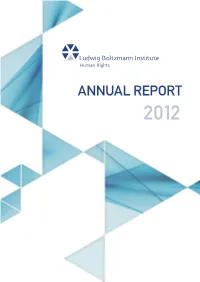
Annual Report 2012
© Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights – LBI and Research Association A-1010 Vienna, Freyung 6 (Schottenhof), Hof 1, Stiege II T +43/1/42 77-274 20, [email protected], http://bim.lbg.ac.at Vienna, April 2013 INHALTSVERZEICHNIS Introduction ........................................................................................................................... 5 20 Years Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights. 20 Years Committed to Human Rights Research. ..................................................................................................... 7 Human Dignity and Public Security .................................................................................... 9 Human Rights in Development Cooperation and Business / Digital Rights ................................................................................................... 11 European Neighbourhood and Integration Policy ........................................................... 14 Anti-Discrimination | Diversity | Asylum .......................................................................... 17 Women‘s Rights | Children‘s Rights | Trafficking in Human Being ............................... 19 Human Rights Education and Education for Democratic Citizenship .......................... 22 Staff ...................................................................................................................................... 25 Finances ............................................................................................................................. -

Erstes Internationales Menschenrechte Symposium 9
ERSTES INTERNATIONALES MENSCHENRECHTE SYMPOSIUM 9. BIS 12. NOVEMBER 2017 IN DER BEWUSSTSEINSREGION MAUTHAUSEN – GUSEN – ST. GEORGEN EDITORIAL EHRENGÄSTE RAHMENPROGRAMM: Mag.a Muna Duzdar Staatssekretärin für Diversität, Kinderbetreuung / Kinderrechteworkshop Öffentlichen Dienst und Digitalisierung Leitung: Team der Kinderfreunde Mühlviertel. Auch die Jüngeren unter uns beschäftigen sich spielerisch und kreativ mit den Kinderrechten. Bei Landesrätin Birgit Gerstorfer der Anmeldung bitte das Alter der Kinder angeben! Landesrätin für Soziales und Gemeinden Konferenz der Kinder: 18. November 2017 – St. Georgen / Gusen Thomas Christian Erich Wahl Internationaler Tag der Kinderrechte: 20. November 2017 Punkenhofer Aufreiter Bürgermeister Heinz Patzelt, Bürgermeister Bürgermeister St. Georgen/Gusen Amnesty International Mauthausen Langenstein Claudia Heimes Theater für die Menschenrechte Assessori, Vinci, Italien Wolfgang Rohm ERSTES INTERNATIONALES Workshop für Jugendliche Bgm. Mirsad Mahmutagic Aufführung im öffentlichen Raum: MENSCHENRECHTESYMPOSIUM Bürgermeister Maglaj, Bosnien & Herzegowina Freitag, 3. November 2017: DONNERSTAG, 9. NOVEMBER BIS 14:00 Parkplatz Unimarkt Langenstein SONNTAG, 12. NOVEMBER 2017 weitere angefragt 16:00 Genussmarkt St.Georgen/Gusen Samstag, 4. November 2017: Mit Freude dürfen wir das Programm des ersten internatio- 10:00 Donaupark Mauthausen nalen Menschenrechtesymposiums der Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen präsentieren. Die Menschenrechte sind der Wertekatalog, in dem ein fried- Poetry Slam -

Meln Körper. Melne Rechte
März 2015 AMNESTYJOURNAL DIE ZEITSCHRIFT FÜR MENSCHENRECHTE MEIN KÖRPER. MEINE RECHTE. INHALT REUTERS/Mohsin Raza STRINGER Iraq / Reuters 4 12 6 3 EDITORIAL jahrzehntelang verbergen musste. 15 ERFOLGE Von Daniel Kreuz 4 IRAK. Der Hölle entkommen 16 MEHR ALS WISSEN Folter und Sex-Sklaverei in Gefangen- 10 BEIJING+20 zÄHLT DIE HALTUNG schaft der IS. Von Corinna Jakob Die Reise in Richtung Silke Ruprechtsberger über ihre Ein- Gleichberechtigung geht weiter drücke vom Islam-Workshop 6 INDIEN der Amnesty-Academy Ein Mädchen großzuziehen, ist wie 11 AKTUELL die Pflanzen im Garten seiner Nach- 18 AKTIV FÜR MENSCHENRECHTE barn zu gießen. Von Marlene Hofstätter 12 DER RUF DES TERRORS NACH ZENSUR. 21 DIE KRONE FÜR 8 ICH ENTSCHEIDE, WER ICH BIN IS-Dschihadisten verbreiten ihre meINE BEMÜHUNGEN Die Norwegerin Jean Jeanette ist eine Gräueltaten ungebremst über soziale Lilian Hofmeister im Portrait von Frau, die ihr wahres Geschlecht Netzwerke. Von Florian Klenk Silke Ruprechtsberger Impressum: Amnesty International. Informationen 02Z033408. Medieninhaberin, Verlegerin, Herausgeberin: Amnesty International Österreich, 1150 Wien, Moering- gasse 10/1. Stock, Tel.: (01) 7 80 08, Fax: (01) 7 80 08-44. E-Mail: [email protected]. Chefredaktion: Christine Newald; Finanz- und Spendenverwaltung: Christian March; Datenschutzbeauftragte: Susanne Bisko; MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Stephanie Geier, Marlene Hofstätter, Corinna Jakob, Florian Klenk, Daniel Kreuz, Christian March, Silke Ruprechtsberger, Daniela Schier, Andrea Strasser-Camagni. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. De- sign: Patricio Handl; Lektorat: Cornelia Schweinberger; Foto Cover: Body Art von Hikaru Cho © Amnesty International. Fotos: Wenn nicht anders vermerkt: (c) AI. Druck: Becker Mail, Philharmonikerstraße 6, 1010 Wien; Amnesty-Spendenkonto: IBAN: AT142011100000316326. -

German Version Below == Ladies and Gentlemen
== German version below == Ladies and gentlemen, dear colleagues, On the occasion of awarding the European Parliament´s Sakharov Prize for Freedom of Thought 2016 to Nadia Murad Basee Taha and Lamya Haji Bashar Taha we would like to cordially invite you to the forthcoming panel discussion and screening of the film Sonita on Friday, 2 December 2016 at 18:30 at Brunnenpassage (Brunnengasse 71, 1160 Vienna). The screening takes place in cooperation with the European Parliament Information Office in Austria and in the frame of the human rights film festival this human world 2016. Nadia Murad Basee Taha and Lamya Haji Bashar Taha are survivors of sexual enslavement by the Islamic State (IS), and are now spokespersons for women afflicted by IS's campaign of sexual violence. On 3 August 2014, IS slaughtered all of the male inhabitants of Kocho, Iraq, the hometown of the two women. Following the massacre, all young women, including Haji Bashar, Murad and their sisters, were kidnapped, exploited and trafficked as sex slaves. Separately from each other, both women eventually managed to escape, finally finding refuge in Europe, where they are devoted to raising awareness about the plight of the Yazidi community, and continue to help victims of IS enslavement and atrocities. The Research Centre Human Rights, the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and the European Parliament Information Office are honoured to announce that the evening will begin with a keynote speech from prize winner Lamya Haji Bashar TAHA herself. A panel discussion on the topic of freedom of thought will follow, where we look forward to a lively exchange between Ilkim ERDOST (Director VHS Ottakring), Ulrike LUNACEK (Vice-president of the European Parliament), Heinz PATZELT (General secretary Amnesty International Austria), Hiba WARDEH (Enabling Voices) and YASMO (Hip-hop artist), to be moderated by Anna MÜLLER-FUNK (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights; Research Centre of Human Rights, University of Vienna). -

4384/AB XX.GP Die Abgeordneten Zum Nationalrat Mmag. Dr
4384/AB XX. GP - Anfragebeantwortung 1 von 12 4384/AB XX.GP Die Abgeordneten zum Nationalrat MMag. Dr. Madeleine Petrovic, Freundinnen und Freunde haben am 17. Juli 1998 unter der Nummer 4776/J - NR/ 1998 eine schriftliche parlamentarische Anfrage an mich gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 1. “Welche Gremien, Beiräte, Kommissionen, Diskussionsgruppen etc. existieren in Ihrem Ressortbereich und wie sieht Ihre aktuelle Zusammensetzung aus? 2. In welcher dieser Einrichtungen gibt es eine Repräsentanz der im Parlament vertretenen Parteien? Sind in diesen Gremien NR -, BR -, Landtags - und/oder GemeinderatsmandatarInnen vertreten? Wenn ja, wer? 3. In welcher dieser Einrichtungen sind Abgeordnete zum NR oder BR nicht als Repräsentanten einer politischen Partei sondern z.B. als Expertinnen vertreten? 4. Auf welcher Grundlage basieren die oben genannten Einrichtungen? 5. In welchen Abständen treten die genannten Einrichtungen zusammen und wann zuletzt? 6. Wer sind die Mitglieder der Gremien und welche Institutionen, Organisationen, Unternehmen oder Personen bestimmen die Mitglieder dieser Gremien? 7. Wie hoch ist der Anteil der Frauen a) unter den Mitgliedern b) unter den Ersatzmitgliedern? 8. Wie hat sich der Frauenanteil in den letzten 3 Jahren entwickelt?" Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich. 2 von 12 4384/AB XX. GP - Anfragebeantwortung Diese Frage beantworte ich wie folgt: Zu Frage 1: In den Ressortbereich des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten fallen folgende Gremien, -

E-HANDBOOK on SOCIETAL SECURITY CRISES and EMERGENCY RESPONSE in EUROPE Case-Studies, Videos and Training Materials Table of Content
page to be finished Irina van der Vet, Ólöf Söebech and Florian Lang (eds.) E-HANDBOOK ON SOCIETAL SECURITY CRISES AND EMERGENCY RESPONSE IN EUROPE Case-studies, videos and training materials Table of content 3 Foreword Part 2. Managing natural disaster crises Part 1. Managing societal crises Sweden 54 Västmanland 2014 forest fire. Austria Authors: Ann-Sofie Stenérus Dover and Malin Östensson 5 Refugee Crisis in Austria in 2015. Authors: Reinhard Kreissl, Norbert Leonhardmair and Spain Michaela Scheriau (with contribution of Nina Woduschek) 68 Development and evolution of the municipal flood plan in Pamplona. Sweden Authors: Erlantz Loizaga, Judit Gómez Bengoa 21 Husby Riots in 2013. and F. Javier Herrera Authors: Ann-Sofie Stenérus Dover and Malin Östensson Spain Belgium 77 The role of volunteer agencies during 43 The 2016 Brussels terror attacks. the storm surge at the Bay of Biscay. Authors: Klaudia Tani, Eva Kyriakou, Ólöf Söebech and Authors: Erlantz Loizaga, Judit Gómez Bengoa Elodie Reuge and F. Javier Herrera Ed. by Florian Lang and Irina Van der Vet 90 Solutions to assignments PLEASE NOTE For best viewing experience, according to your operation system and browser, we suggest to use Adobe Acrobat Reader (free) fullscreen. In order to display the videos, within the document, an active internet connection is needed. 2 Foreword In today’s world where fear and insecurity are a explored in an involving manner. All six case-studies ual looking to enhance their knowledge of specific part of our everyday reality, we increasingly rely on are built upon the analysis of real events that oc- cases of societal security. -

AIDS – the End of Dogma and Taboo!
AIDS – The End of Dogma and Taboo! What we realize ...and what is hidden. Nothing is harder and needs more character, As to be in open dissent with your time and to say: No! (Kurt Tucholsky, German writer, 1890-1935) Content: Why I want to write this book ………………………………………………….…3 Violation of Human Rights: The Unbelievable Story of the Seebald Family in Austria…………………….…… 5 Introduction…………………………………………………………………….….. 11 1. Progress and Errors in Science and Medicine…………………………………..13 2. The Conflict of Gallo and Montagnier………………………………………….33 1 3. HIV-Tests: Cui bono? (Whose profit?)………………………………………….38 4. What is AIDS? Does a Virus exist?......................................................................44 5. Retrovirus, Research, Revision…………………………………………………..49 6. The Human Genome Project and HIV…………………………………………..53 7. Gene Expression instead of HIV: Epigenetics and RNA……………………….60 8. Pregnancy, Nursing and Positive Testing……………………………………….63 9. The Immune System and AIDS………………………………………….……...71 10. Stress and Disease……………………………………………………………….75 11. Medication and Vaccination…………………………………………………….81 12. AIDS – Latest Findings, that should not be kept secret…………………………86 13. AIDS-“Dissidents”................................................................................................90 14. Epigenetics: About Environmental Influence on the Genome ………………….95 15. Media and the Freedom of Expression……………………………..…………....99 16. Forces that Suppress the Truth …………………………………………………124 17. Consciousness, Freedom and Responsibility……………………………………138 18. -
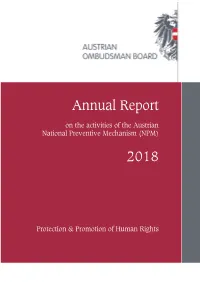
Austrian National Preventive Mechanism (NPM)
Annual Report on the activities of the Austrian National Preventive Mechanism (NPM) 2018 Protection & Promotion of Human Rights Annual Report 2018 on the Activities of the Austrian National Preventive Mechanism (NPM) Protection & Promotion of Human Rights Preface This report documents the activities of the National Preventive Mechanism (NPM) in 2018. More than 500 monitoring visits were carried out, most of them in public and private institutions and facilities where the freedom of individuals is restricted. The responsible ministries, supervisory authorities and the affected institutions and facilities were informed about the results of the visits in detail. The NPM also strongly advocated in the year under review that the identified deficits should be rectified as quickly as possible. A large number of presentations and information events were held with the goal of raising public awareness and placing the protection of human rights on a broad basis. International cooperation was further intensified above and beyond these nationwide activities. All of these measures have a common objective: they serve to protect persons from being treated in an inhuman or degrading manner. Human dignity is at considerable risk in places where persons’ liberty is deprived in particular, such as in correctional institutions, police detention centres or retirement and nursing homes. Persons living in such places have little chance to be heard, as they have only limited contact to the outside world. To a large extent, they are at the mercy of the staff of the respective institution or facility or they are, at least, in a dependent position. This inevitably leads to precarious situations. -

Foreign Nationals, Enemy Penology and the Criminal Justice System
ISSN 1463 9696 Autumn 2009 • Bulletin No 69 EUROPEAN RACE BULLETIN Foreign nationals, enemy penology and the criminal justice system By Liz Fekete and Frances Webber Contents Foreign nationals, enemy penology and the criminal justice system 2 Election focus 18 Scaremongering, hate and the Swiss referendum on minarets 27 Review: The crime of solidarity 29 This bulletin is part of a European Race Audit supported by the Joseph Rowntree Charitable Trust. The Institute of Race Relations is precluded from expressing a corporate view: any opinions expressed here are therefore those of the contributors. Please acknowledge IRR’s European Race Audit Project in any use of this work. An ‘Alternative Voices on Integration’ project is also being carried out by the IRR and funded by the Network of European Foundations (European Programme on Integration and Migration). For further information contact Liz Fekete at the Institute of Race Relations, 2-6 Leeke Street, London WC1X 9HS. Email: [email protected] © Institute of Race Relations 2009 Foreign nationals, enemy penology and the criminal justice system By Liz Fekete and and Frances Webber Sensationalist headlines about foreign criminals – from dark and swarthy Middle-Eastern terrorists, Albanian rapists, sexual predators from Africa, to the Roma swindlers and tricksters from eastern and central Europe – now dominate European newspapers. In response to such stories, politicians have set targets for the removal of foreign national prisoners and the belief has grown that deportation is a rea- sonable and proportionate way to guarantee public security against a foreign enemy. But behind the media stories lies another reality – a hidden reality which relates to the lives of those ‘foreigners’ who are increasingly being swept up in Europe’s deportation drive. -

Internationales Krisen- Und Konfliktmanagement 2.0 Konfliktmanagement Und Krisen- Internationales
Band 1 / 2014 Band 1 / 2014 Dieser Band legt die Ergebnisse des LVAk-Symposions 2013 dar. Erstmals wurden zwei der sieben Arbeits- gruppen extern geleitet, wodurch Aspekte der interdis- ziplinären Forschung und des gesamtstaatlichen Vor- Internationales Krisen- und gehens besonders hervortreten. Der breite Ansatz zu zukünftigen sicherheitspolitischen bzw. strategischen Konfliktmanagement 2.0 Herausforderungen für externe Engagements kleine- rer Staaten manifestiert sich durch Beiträge nationaler und internationaler Experten unterschiedlicher Hinter- Gesamtstaatliche Herausforderungen für gründe. Dadurch werden ein breites Interessenspekt- kleinere Akteure rum abgedeckt und Entscheidungsgrundlagen für alle mit internationalen Einsätzen befassten Dienststellen und Organisationen verfügbar gemacht. Internationales Krisen- und Konfliktmanagement 2.0 Konfliktmanagement und Krisen- Internationales ISBN: 978-3-902944-37-5 Markus Gauster und Benedikt Hensellek (Hrsg.) 1/14 Symposion der Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie 2013 Gauster, (Hrsg.)Hensellek Landesverteidigungsakademie Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Markus Gauster, Benedikt Hensellek (Hrsg.) Internationales Krisen- und Konfliktmanagement 2.0 Gesamtstaatliche Herausforderungen für kleinere Akteure 1/2014 Wien, April 2014 Impressum: Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber: Republik Österreich / Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport Rossauer Lände 1 1090 Wien Redaktion: Landesverteidigungsakademie Kommando Stiftgasse 2a 1070 Wien Schriftenreihe der -

Können Sie Das Gesamte Heft Als Pdf Herunter Laden
P.b.b. Verlagspostamt 1010 Wien · Plus.Zeitung 08Z037896 P Einzelpreis € 2.90 · Dezember 2010/Jänner 2011 ILLUSTRIERTE GEGRÜNDET 1897 VON THEODOR HERZL AUS DEM INHALT Der Holocaust in der arabischen Welt 5 Lachen gegen Putin 7 Friedenspreis für David Grossmann 9 Der unvergängliche Zauber von „Kawana“ und hohem „C“ 10 Der israelische Kibbuz feiert 100 Jahre 12 „Il Postino“ im Theater an der Wien 18 Frida Kahlo und ihre jüdischen Förderer 19 Unser Titelbild von Jakov Bararon trägt den Titel Massada. Massada wurde zu einem Symbol der Entschlossenheit eines Volkes, in seinem eigenen Lande frei zu sein. Nach zweitausend Jahren bleibt das Opfer Eleazar ben-Ya'irs und seiner Kameraden für die jüdische Nation heute genau so wichtig wie es in jener vergangenen Zeit war. Viele Generationen hin- durch wurde die Geschichte von Massada als eine halb legendäre Erzählung betrachtet. Im Jahre 1963 wurde Massada von einer großen internationalen Expedition unter der Leitung von Prof. Yigael Yadin ausgegraben. Die zweijährigen Grabungsarbeiten forderten die „Legende" ans Licht der Geschichte und enthüllten bis dahin unbekannte Einzelheiten. Der in Belgrad geborene und seit 1992 in Wien lebende Künstler ist stark mit alten jüdischen Traditio- nen verwurzelt, seine Werke sind geprägt von romanti- scher Nostalgie und lebendiger Gegenwart. ch weiß nicht, ob es passend und richtig Die erste Frage geht an die Verhandlungs- ihrem unabhängigen Staat das Territorium kann es selbstverständlich multiple Identitä- war, im Rahmen der Friedensverhand- führer der Palästinenser. Ich hoffe, dass trotz des Staates Israel weiter als „besetzte Ge- ten geben (wer wüsste das besser als die Ju- Ilungen von den Palästinensern zu for- aller Hindernisse am Ende ein unabhängiger biete" betrachten, die zur palästinensischen den), aber die Sache ist doch alles andere als dern, Israel als den jüdischen Nationalstaat palästinensischer Staat an der Seite des Heimat gehören, wird dies den gegenseitigen einfach.