Masterarbeit/Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hardy Herbaceous & Alpine Plants : Wholesale Catalog, Spring 1928
Historic, Archive Document Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices. 5^ IIIBP A I n«f«nrin|| l * FEB 2 5 $2r -* Hardy Herbaceous 6-' Alpine Plants i:w REG'D U. S. PAT. OFF. 9fce WAYSIDE GARDENS CO. Mentor. Ohio Wholesale Catalog Spring 1928 N presenting this catalog of HARDY PLANTS and ROCK PLANTS, we do so with the kindest regards to you who have favored us heretofore with your orders, and by continuing the To the excellence of our products and efficiency of serv¬ ice, we hope to merit your future patronage. Trade From those unacquainted with us we solicit a trial, and feel assured that the quality of our plants will prove to meet your most exacting demands. No order is too large for us to handle or too small to receive careful attention. Quality of plants and attention to every detail you entrust to us is assured. We have spared neither trouble nor expense in the production of the plants enumerated in this catalog and we offer them with the fullest con¬ fidence as to their general excellence, reliability, and ability to create a perfect garden within an exceptionally short space of time. Terms of business will be found on page 79, and a complete index to this catalog on page 80, the use of which will facilitate the study of its contents. The Wayside Gardens Co. Mentor, Ohio February first, 1928 E. H. SCHULTZ, President J. J. GRULLEMANS, Sec’y-Treas. Cardin cm ; k VV YORK CHICAGO BOSTON TORONTO SANTA BARBARA THE WORLD 8 WORK COUNTRY LIFE «Advertising CARDEN * HQME BUILDER ThECOUNTRYLIFE-PRESS ‘"Department RADIO BROADCAST GARDEN-CITY'"NEW-YORK. -

Syntaxonomical Revision of Quercetalia Pubescenti-Petraeae in the Italian Peninsula
Fitosociologia 41 (1): 87-164, 2004 87 Syntaxonomical revision of Quercetalia pubescenti-petraeae in the Italian Peninsula Blasi C.1, Di Pietro R.1 & Filesi L.2 1 Dipartimento di Biologia vegetale Università “La Sapienza” di Roma, P.le Aldo Moro 5, I-00185 Roma; e-mail: [email protected] 2 Dipartimento di Pianificazione, Università IUAV di Venezia, Cà Tron, Santa Croce 1957, I-30135 Venezia Abstract This paper presents a new sintaxonomical scheme for Quercetalia pubescenti-petraeae woodlands in peninsular Italy updated at the rank of sub- alliance. On the basis of bioclimatic, biogeographic and coenological diagnosis the Quercetalia pubescenti-petraeae order occurs in the study area in the form of five alliances: Quercion pubescenti-petraeae (suball.: Buxo-Quercenion pubescentis), Carpinion orientalis (suball.: Campanulo-Ostryenion, Laburno-Ostryenion stat. nov.; Lauro-Quercenion pubescentis and Cytiso-Quercenion pubescentis), Teucrio siculi-Quercion cerridis nom. conserv. propos. (suball.: Teucrio-Quercenion cerridis suball. nov., Ptilostemo-Quercenion cerridis); Pino-Quercion congestae (suball.: Pino-Quercenion congestae suball. nov., Quercenion virgilianae suball. nov.) and Erythronio-Quercion petraeae. The Quercion pubescenti-petraeae is a sintaxon with a sub-continental character and within the Italian Peninsula it is restricted to Ligurian-Piedmontese Apennine in the form of the sub-alliance Buxo- Quercenion pubescentis. Carpinion orientalis is a sintaxon with oceanic/suboceanic features, which is widely distributed along the entire Italian Peninsula. It occurs mainly on limestone substrates forming woodlands which can be potential vegetation types and also woods of secondary origin and evolution. The Teucrio-Quercion cerridis is an alliance which is widely distributed within central and southern Italy, where it finds its coenological optimum on acid, subacid or neutral substrates such as volcanic outcrops, flysch, sandstones or clayey-arenaceous sediments. -

The Pyrenees
The Pyrenees A Greentours Holiday for the Alpine Garden Society 10th to 23rd June 2011 Led by Paul Cardy Trip Report and Systematic Lists by Paul Cardy Day 1 Friday 10 th June Arrival and Transfer to Formigueres Having driven from the south western Alps and reached Carcassonne the previous evening, I continued to Toulouse to meet the group at the airport. I was unexpectedly delayed by French customs who stopped me at the toll booth entering the city. There followed a lengthy questioning, as I had to unpack the contents of my suspiciously empty Italian mini-bus and show them my two large boxes of books, suitcase full of clothes, picnic supplies, etc., to convince them my purpose was a botanical tour to the Pyrenees. Now a little late I arrived breathlessly at Toulouse airport and rushed to the gate to meet Margaret, and the New Zealand contingent of Chris, Monica, Archie and Lynsie, hurriedly explaining the delay. Anyway we were soon back on the motorway and heading south towards Foix. White Storks in a field on route was a surprise. We made a picnic stop at a functional aire where there were tables, and a selection of weedy plants. Black Kite soared overhead. Once past Foix and Ax-les- Thermes the scenery became ever more interesting as we wound our way up to a misty Col de Puymorens. There a short stop yielded Pulsatilla vernalis in fruit and Trumpet Gentians. Roadside cliffs had Rock Soapwort, Saxifraga paniculata , and Elder-flowered Orchids became numerous. Now in the Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, a fascinating route down into the valley took us through Saillagouse and Mont-Louis before heading up a minor road to the village of Formigueres, our base for the first three nights. -

Federico Selvi a Critical Checklist of the Vascular Flora of Tuscan Maremma
Federico Selvi A critical checklist of the vascular flora of Tuscan Maremma (Grosseto province, Italy) Abstract Selvi, F.: A critical checklist of the vascular flora of Tuscan Maremma (Grosseto province, Italy). — Fl. Medit. 20: 47-139. 2010. — ISSN 1120-4052. The Tuscan Maremma is a historical region of central western Italy of remarkable ecological and landscape value, with a surface of about 4.420 km2 largely corresponding to the province of Grosseto. A critical inventory of the native and naturalized vascular plant species growing in this territory is here presented, based on over twenty years of author's collections and study of relevant herbarium materials and literature. The checklist includes 2.056 species and subspecies (excluding orchid hybrids), of which, however, 49 should be excluded, 67 need confirmation and 15 have most probably desappeared during the last century. Considering the 1.925 con- firmed taxa only, this area is home of about 25% of the Italian flora though representing only 1.5% of the national surface. The main phytogeographical features in terms of life-form distri- bution, chorological types, endemic species and taxa of particular conservation relevance are presented. Species not previously recorded from Tuscany are: Anthoxanthum ovatum Lag., Cardamine amporitana Sennen & Pau, Hieracium glaucinum Jord., H. maranzae (Murr & Zahn) Prain (H. neoplatyphyllum Gottschl.), H. murorum subsp. tenuiflorum (A.-T.) Schinz & R. Keller, H. vasconicum Martrin-Donos, Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Typha domingensis (Pers.) Steud., Vicia loiseleurii (M. Bieb) Litv. and the exotic Oenothera speciosa Nutt. Key words: Flora, Phytogeography, Taxonomy, Tuscan Maremma. Introduction Inhabited by man since millennia and cradle of the Etruscan civilization, Maremma is a historical region of central-western Italy that stretches, in its broadest sense, from south- ern Tuscany to northern Latium in the provinces of Pisa, Livorno, Grosseto and Viterbo. -
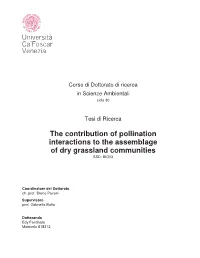
The Contribution of Pollination Interactions to the Assemblage of Dry Grassland Communities SSD: BIO03
Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali ciclo 30 Tesi di Ricerca The contribution of pollination interactions to the assemblage of dry grassland communities SSD: BIO03 Coordinatore del Dottorato ch. prof. Bruno Pavoni Supervisore prof. Gabriella Buffa Dottorando Edy Fantinato Matricola 818312 Contents Abstract Introduction and study framework Chapter 1. Does flowering synchrony contribute to the sustainment of dry grassland biodiversity? Chapter 2. New insights into plants coexistence in species-rich communities: the pollination interaction perspective Chapter 3. The resilience of pollination interactions: importance of temporal phases Chapter 4. Co-occurring grassland communities: the functional role of exclusive and shared species in the pollination network organization Chapter 5. Are food-deceptive orchid species really functionally specialized for pollinators? Chapter 6. Altitudinal patterns of floral morphologies in dry calcareous grasslands Conclusions and further research perspectives Appendix S1_Chapter 2 Appendix ESM1_Chapter 3 1 Abstract Temperate semi-natural dry grasslands are known for the high biodiversity they host. Several studies attempted to pinpoint principles to explain the assembly rules of local communities and disentangle the coexistence mechanisms that ensure the persistence of a high species richness. In this study we examined the influence of pollination interactions on the assemblage of dry grassland communities and in the maintenance of the biodiversity they host. The issue has been addressed from many different perspectives. We found that similarly to habitat filtering and interspecific interactions for abiotic resources, in dry grassland communities interactions for pollination contribute to influence plant species assemblage. We found entomophilous species flowering synchrony to be a key characteristic, which may favour the long lasting maintenance of rare species populations within the community. -

Paolo Romagnoli & Bruno Foggi Vascular Flora of the Upper
Paolo Romagnoli & Bruno Foggi Vascular Flora of the upper Sestaione Valley (NW-Tuscany, Italy) Abstract Romagnoli, P. & Foggi B.: Vascular Flora of the upper Sestaione Valley (NW-Tuscany, Italy). — Fl. Medit. 15: 225-305. 2005. — ISSN 1120-4052. The vascular flora of the Upper Sestaione valley is here examined. The check-list reported con- sists of 580 species, from which 8 must be excluded (excludendae) and 27 considered doubtful. The checked flora totals 545 species: 99 of these were not found during our researches and can- not be confirmed. The actual flora consists of 446 species, 61 of these are new records for the Upper Sestaione Valley. The biological spectrum shows a clear dominance of hemicryptophytes (67.26 %) and geophytes (14.13 %); the growth form spectrum reveals the occurrence of 368 herbs, 53 woody species and 22 pteridophytes. From phytogeographical analysis it appears there is a significant prevalence of elements of the Boreal subkingdom (258 species), including the Orohypsophyle element (103 species). However the "linkage groups" between the Boreal subkingdom and Tethyan subkingdom are well represented (113 species). Endemics are very important from the phyto-geographical point of view: Festuca riccerii, exclusive to the Tuscan- Emilian Apennine and Murbeckiella zanonii exclusive of the Northern Apennine; Saxifraga aspera subsp. etrusca and Globularia incanescens are endemic to the Tuscan-Emilian Apennine and Apuan Alps whilst Festuca violacea subsp. puccinellii is endemic to the north- ern Apennines and Apuan Alps. The Apennine endemics total 11 species. A clear relationship with the Alpine area is evident from 13 Alpine-Apennine species. The Tuscan-Emilian Apennine marks the southern distribution limit of several alpine and northern-central European entities. -

Pucciniomycotina: Microbotryum) Reflect Phylogenetic Patterns of Their Caryophyllaceous Hosts
Org Divers Evol (2013) 13:111–126 DOI 10.1007/s13127-012-0115-1 ORIGINAL ARTICLE Contrasting phylogenetic patterns of anther smuts (Pucciniomycotina: Microbotryum) reflect phylogenetic patterns of their caryophyllaceous hosts Martin Kemler & María P. Martín & M. Teresa Telleria & Angela M. Schäfer & Andrey Yurkov & Dominik Begerow Received: 29 December 2011 /Accepted: 2 October 2012 /Published online: 6 November 2012 # Gesellschaft für Biologische Systematik 2012 Abstract Anther smuts in the genus Microbotryum often is a factor that should be taken into consideration in delimitat- show very high host specificity toward their caryophyllaceous ing species. Parasites on Dianthus showed mainly an arbitrary hosts, but some of the larger host groups such as Dianthus are distribution on Dianthus hosts, whereas parasites on other crucially undersampled for these parasites so that the question Caryophyllaceae formed well-supported monophyletic clades of host specificity cannot be answered conclusively. In this that corresponded to restricted host groups. The same pattern study we sequenced the internal transcribed spacer (ITS) was observed in the Caryophyllaceae studied: morphological- region of members of the Microbotryum dianthorum species ly described Dianthus species did not correspond well with complex as well as their Dianthus hosts. We compared phy- monophyletic clades based on molecular data, whereas other logenetic trees of these parasites including sequences of anther Caryophyllaceae mainly did. We suggest that these different smuts from other Caryophyllaceae, mainly Silene,withphy- patterns primarily result from different breeding systems and logenies of Caryophyllaceae that are known to harbor anther speciation times between different host groups as well as smuts. Additionally we tested whether observed patterns in difficulties in species delimitations in the genus Dianthus. -

Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27 Is a Scientific Reference Document
INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS EUR 27 July 2007 EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONMENT Nature and biodiversity The Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27 is a scientific reference document. It is based on the version for EUR15, which was adopted by the Habitats Committee on 4. October 1999 and consolidated with the new and amended habitat types for the 10 accession countries as adopted by the Habitats Committee on 14 March 2002 with additional changes for the accession of Bulgaria and Romania as adopted by the Habitats Committee on 13 April 2007 and for marine habitats to follow the descriptions given in “Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine environment. Application of the Habitats and Birds Directives” published in May 2007 by the Commission services. A small amendment to Habitat type 91D0 was adopted by the Habitats Committee in its meeting on 14th October 2003. TABLE OF CONTENTS WHY THIS MANUAL? 3 HISTORICAL REVIEW 3 THE MANUAL 4 THE EUR15 VERSION 5 THE EUR25 VERSION 5 THE EUR27 VERSION 6 EXPLANATORY NOTES 7 COASTAL AND HALOPHYTIC HABITATS 8 OPEN SEA AND TIDAL AREAS 8 SEA CLIFFS AND SHINGLE OR STONY BEACHES 17 ATLANTIC AND CONTINENTAL SALT MARSHES AND SALT MEADOWS 20 MEDITERRANEAN AND THERMO-ATLANTIC SALTMARSHES AND SALT MEADOWS 22 SALT AND GYPSUM INLAND STEPPES 24 BOREAL BALTIC ARCHIPELAGO, COASTAL AND LANDUPHEAVAL AREAS 26 COASTAL SAND DUNES AND INLAND DUNES 29 SEA DUNES OF THE ATLANTIC, NORTH SEA AND BALTIC COASTS 29 SEA DUNES OF THE MEDITERRANEAN COAST 35 INLAND -

Čebele in Rastline Bees and Plants
ČEBELE IN RASTLINE BEES AND PLANTS HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS LABACENSIS, SLOVENIA ČEBELE IN RASTLINE BEES AND PLANTS Recenzenti / Reviewers: Dr. sc. Sanja Kovačić, stručna savjetnica Botanički vrt Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu muz. svet./ museum councilor/ dr. Nada Praprotnik Naslovnica / Front cover: Allium ericetorum Foto / Photo: J. Bavcon Foto / Photo: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak Urednika / Editors: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak Tehnični urednik / Tehnical editor: D. Bavcon Prevod / Translation: GRENS-TIM d.o.o. Elektronska izdaja / E-version Leto izdaje / Year of publication: 2020 Kraj izdaje / Place of publication: Ljubljana Izdal / Published by: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL Ižanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386(0) 1 427-12-80, www.botanicni-vrt.si, [email protected] Zanj: znan. svet. dr. Jože Bavcon Botanični vrt je del mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov © Botanični vrt Univerze v Ljubljani / University Botanic Gardens Ljubljana ----------------------------------- Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID=15995395 ISBN 978-961-6822-60-2 (pdf) ----------------------------------- 1 KAZALO / INDEX Čebele in rastline......................................................................... 7 Izvleček ................................................................................... 7 Ključne besede ....................................................................... -

Identification and Functional Characterization of Effectors from an Anther Smut Fungus, Microbotryum Lychnidis-Dioicae
University of Louisville ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository Electronic Theses and Dissertations 12-2018 Identification and functional characterization of effectors from an anther smut fungus, Microbotryum lychnidis-dioicae. Venkata Swathi Kuppireddy University of Louisville Follow this and additional works at: https://ir.library.louisville.edu/etd Part of the Molecular Genetics Commons Recommended Citation Kuppireddy, Venkata Swathi, "Identification and functional characterization of effectors from an anther smut fungus, Microbotryum lychnidis-dioicae." (2018). Electronic Theses and Dissertations. Paper 3078. https://doi.org/10.18297/etd/3078 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository. This title appears here courtesy of the author, who has retained all other copyrights. For more information, please contact [email protected]. IDENTIFICATION AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF EFFECTORS FROM AN ANTHER SMUT FUNGUS, MICROBOTRYUM LYCHNIDIS-DIOICAE By Venkata Swathi Kuppireddy M.Sc., Biology, University of Louisville, 2016 A Dissertation Submitted to the Faculty of the College of Arts and Sciences of the University of Louisville in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Biology Department of Biology, Division of Molecular, Cellular and Developmental Biology, University of Louisville Louisville, Kentucky December 2018 Copyright 2018 by Venkata Swathi Kuppireddy © All rights reserved IDENTIFICATION AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF EFFECTORS FROM AN ANTHER SMUT FUNGUS, MICROBOTRYUM LYCHNIDIS-DIOICAE By Venkata Swathi Kuppireddy M.Sc., Biology, University of Louisville, 2016 A Dissertation Approved on November 14, 2018 By the following Dissertation Committee: _________________________________________ Dr. -
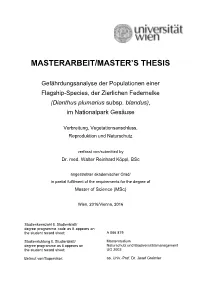
Masterarbeit/Master's Thesis
MASTERARBEIT/MASTER’S THESIS Gefährdungsanalyse der Populationen einer Flagship-Species, der Zierlichen Federnelke (Dianthus plumarius subsp. blandus), im Nationalpark Gesäuse Verbreitung, Vegetationsanschluss, Reproduktion und Naturschutz verfasst von/submitted by Dr. med. Walter Reinhard Köppl, BSc angestrebter akademischer Grad/ in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science (MSc) Wien, 2016/Vienna, 2016 Studienkennzahl lt. Studienblatt/ degree programme code as it appears on the student record sheet: A 066 879 Studienrichtung lt. Studienblatt/ Masterstudium degree programme as it appears on Naturschutz und Biodiversitätsmanagement the student record sheet: UG 2002 Betreut von/Supervisor: ao. Univ.-Prof. Dr. Josef Greimler 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................ 5 1.1 Dianthus plumarius subsp. blandus in seinem Kontext .................................... 5 1.2 Forschungsfragen und Zielsetzungen .............................................................. 6 2 Material und Methoden ........................................................................................... 9 2.1 Untersuchungsgebiet ....................................................................................... 9 2.2 Standorte und Populationen ........................................................................... 10 2.3 Vegetationsanschluss ................................................................................... -

Alpine Garden Club of British Columbia Seed Exchange 2015
Alpine GArden Club of british ColumbiA seed exChAnGe 2015 We are very grateful to all those members who have made our Seed Exchange possible through donating seeds, and to those living locally who volunteer so much time and effort to packaging and filling orders. We especially appreciate those donors who made an extra effort in this difficult summer. We have fewer donors but still a good list and that is thanks to them. Read the following instructions carefully before filling out the seed request form. PLEASE KEEP YOUR SEED LIST, packets will be marked by number only. Please send the Seed Exchange Request Form (last page of booklet) by mail as soon as possible, but no later than DECEMBER 10. You can request your seeds on-line (see back page) and the complete seed list is available on the website for reference. This year you will find a special list of plants at the end of the ‘Native to North America’ section, of plants wild collected on Pink Mountain in northern BC. Please see the accompanying note in the November Bulletin. The Club would appreciate it if anyone who raises plants from these seeds and obtains seed from them would let us know. Those seeds may be useful in the future for revegetation projects. Allocation: Donors may receive up to 60 packets and non-donors 30 packets, limit of one packet of each selection. Donors receive preference for seeds in short supply. (USDA will permit no more than 50 packets for those living in the USA.) List first choices by number only, in strict numerical order, from left to right on the order form.