Klaus Bästlein Erich Mielke
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Publikationen Zeitschriften
Publikationen: Zeitschriften - nach Titeln sortiert - Abschied von der DEFA : DEFA ade. Zwei Umfragen 1965/1992 Ost und West In: Film und Fernsehen 20. Jg. 92/2. - S. 33-41 Appell von Dokumentarfilmern aus der BRD und DDR In: epd Film 7. Jg. 90/4. - S. 43 [HUB]: Alles im Plan? : der Verkauf von Progress; die Privatisierung des ehemaligen DDR-Verleihs In: Filmecho/Filmwoche 95/28. - S. 6 Armin Müller-Stahl: Seine Filme - sein Leben : Rezension zur Heyne Filmbibliothek, Band 169 In: Filmdienst 46. Jg. 93/ 2. - S. 33 Aufbruch in der DDR : 12. Nationales Dokumentarfilmfestival d. DDR In: epd Film 6. Jg. 89/12. - S.39 Anmerkungen: „Spur der Steine“ v. Frank Beyer; Walter Janka - Generaldirektor d. DEFA (bis 1951); Rede v. Joachim Tschirner a. d. Großkundgebung a. d. Beliner Alexanderplatz; Filmemacher Konrad Weiß Ausverkauf der DDR : Deutscher Filmtag, 31.3.-1.4. 90 in der HFF „Konrad Wolf“ In: Filmdienst 43. Jg. 90/8. - S. 564 Babelsberg-Konzept steht: 17 Atelierhallen und jährlich 10 Produktionen angepeilt; Lob für Studiochef Schlöndorff In: Filmecho/Filmwoche 94/29. - S. 3 Babelsberg-Medienstadt In: Filmfaust 93/87. - S. ( ) Schlagwort: Babelsberg Betrifft DEFA-Filmstock: 2 Erklärungen zur Gründung einer Stiftung In: Film und Fernsehen 20. Jg. 92/3. - S. 49 [O.S.]: Babelsberg hebt ab: Ufa und Paramount drehen Pilotfilm; Babelsberg wird immer attraktiver für internationale Produktionen In: Filmecho/Filmwoche 95/9. - S. 11 [TTR]: Babelsberg lud zum Betriebsfest: abgewickeltes Dokfilm-Studio In: Filmecho/Filmwoche 96/20. - S. 7 [TTR]: Babelsberger Dokfilm-Studio verkauft: Kölner Video Company erhält den Zuschlag In: Filmecho/Filmwoche 97/29. -

Morina on Forner, 'German Intellectuals and the Challenge of Democratic Renewal: Culture and Politics After 1945'
H-German Morina on Forner, 'German Intellectuals and the Challenge of Democratic Renewal: Culture and Politics after 1945' Review published on Monday, April 18, 2016 Sean A. Forner. German Intellectuals and the Challenge of Democratic Renewal: Culture and Politics after 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. xii +383 pp. $125.00 (cloth), ISBN 978-1-107-04957-4. Reviewed by Christina Morina (Friedrich-Schiller Universität Jena) Published on H-German (April, 2016) Commissioned by Nathan N. Orgill Envisioning Democracy: German Intellectuals and the Quest for Democratic Renewal in Postwar German As historians of twentieth-century Germany continue to explore the causes and consequences of National Socialism, Sean Forner’s book on a group of unlikely affiliates within the intellectual elite of postwar Germany offers a timely and original insight into the history of the prolonged “zero hour.” Tracing the connections and discussions amongst about two dozen opponents of Nazism, Forner explores the contours of a vibrant debate on the democratization, (self-) representation, and reeducation of Germans as envisioned by a handful of restless, self-perceived champions of the “other Germany.” He calls this loosely connected intellectual group a network of “engaged democrats,” a concept which aims to capture the broad “left” political spectrum they represented--from Catholic socialism to Leninist communism--as well as the relative openness and contingent nature of the intellectual exchange over the political “renewal” of Germany during a time when fixed “East” and “West” ideological fault lines were not quite yet in place. Forner enriches the already burgeoning historiography on postwar German democratization and the role of intellectuals with a profoundly integrative analysis of Eastern and Western perspectives. -

REFORM, RESISTANCE and REVOLUTION in the OTHER GERMANY By
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Birmingham Research Archive, E-theses Repository RETHINKING THE GDR OPPOSITION: REFORM, RESISTANCE AND REVOLUTION IN THE OTHER GERMANY by ALEXANDER D. BROWN A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Modern Languages School of Languages, Cultures, Art History and Music University of Birmingham January 2019 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract The following thesis looks at the subject of communist-oriented opposition in the GDR. More specifically, it considers how this phenomenon has been reconstructed in the state-mandated memory landscape of the Federal Republic of Germany since unification in 1990. It does so by presenting three case studies of particular representative value. The first looks at the former member of the Politbüro Paul Merker and how his entanglement in questions surrounding antifascism and antisemitism in the 1950s has become a significant trope in narratives of national (de-)legitimisation since 1990. The second delves into the phenomenon of the dissident through the aperture of prominent singer-songwriter, Wolf Biermann, who was famously exiled in 1976. -

German History Reflected
The Detlev Rohwedder Building German history reflected GFE = 1/2 Formathöhe The Detlev Rohwedder Building German history reflected Contents 3 Introduction 44 Reunification and Change 46 The euphoria of unity 4 The Reich Aviation Ministry 48 A tainted place 50 The Treuhandanstalt 6 Inception 53 The architecture of reunification 10 The nerve centre of power 56 In conversation with 14 Courage to resist: the Rote Kapelle Hans-Michael Meyer-Sebastian 18 Architecture under the Nazis 58 The Federal Ministry of Finance 22 The House of Ministries 60 A living place today 24 The changing face of a colossus 64 Experiencing and creating history 28 The government clashes with the people 66 How do you feel about working in this building? 32 Socialist aspirations meet social reality 69 A stroll along Wilhelmstrasse 34 Isolation and separation 36 Escape from the state 38 New paths and a dead-end 72 Chronicle of the Detlev Rohwedder Building 40 Architecture after the war – 77 Further reading a building is transformed 79 Imprint 42 In conversation with Jürgen Dröse 2 Contents Introduction The Detlev Rohwedder Building, home to Germany’s the House of Ministries, foreshadowing the country- Federal Ministry of Finance since 1999, bears wide uprising on 17 June. Eight years later, the Berlin witness to the upheavals of recent German history Wall began to cast its shadow just a few steps away. like almost no other structure. After reunification, the Treuhandanstalt, the body Constructed as the Reich Aviation Ministry, the charged with the GDR’s financial liquidation, moved vast site was the nerve centre of power under into the building. -

The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals In
Writing in Red: The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 Thomas William Goldstein A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2010 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher Browning Chad Bryant Karen Hagemann Lloyd Kramer ©2010 Thomas William Goldstein ALL RIGHTS RESERVED ii Abstract Thomas William Goldstein Writing in Red The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 (Under the direction of Konrad H. Jarausch) Since its creation in 1950 as a subsidiary of the Cultural League, the East German Writers Union embodied a fundamental tension, one that was never resolved during the course of its forty-year existence. The union served two masters – the state and its members – and as such, often found it difficult fulfilling the expectations of both. In this way, the union was an expression of a basic contradiction in the relationship between writers and the state: the ruling Socialist Unity Party (SED) demanded ideological compliance, yet these writers also claimed to be critical, engaged intellectuals. This dissertation examines how literary intellectuals and SED cultural officials contested and debated the differing and sometimes contradictory functions of the Writers Union and how each utilized it to shape relationships and identities within the literary community and beyond it. The union was a crucial site for constructing a group image for writers, both in terms of external characteristics (values and goals for participation in wider society) and internal characteristics (norms and acceptable behavioral patterns guiding interactions with other union members). -

Katalog FR En Web.Pdf
» WE ARE THE PEOPLE! « EXHIBITION MAGAZINE PEACEFUL REVOLUTION 1989/90 Published as part of the theme year “20 Years since the Fall of the Wall” by Kulturprojekte Berlin GmbH CONTENTS 7 | OPENING ADDRESS | KLAUS WOWEREIT 8 | OPENING ADDRESS | BERND NEUMANN 10 | 28 YEARS OF THE WALL 100 | TIMELINE 106 | HISTORY WITH A DOMINO EFFECT 108 | PHOTO CREDITS 110 | MASTHEAD 2 CONTENTS 14 | AWAKENING 38 | REVOLUTION 78 | UNITY 16 | AGAINST THE DICTATORSHIP 40 | MORE AND MORE EAST GERMANS 80 | NO EXPERIMENTS 18 | THE PEACE AND ENVIRONMENTAL WANT OUT 84 | ON THE ROAD TO UNITY MOVEMENT IN THE GDR 44 | GRASSROOTS ORGANISATIONS 88 | GERMAN UNITY AND WORLD POLITICS 22 | it‘s not this countrY – 48 | REVOLTS ALONG THE RAILWAY LINE 90 | FREE WITHOUT BORDERS yOUTH CULTURES 50 | ANNIVERSARY PROTESTS 96 | THE COMPLETION OF UNITY 24 | SUBCULTURE 7 OCTOBER 1989 26 | THE OPPOSITION GOES PUBLIC 54 | EAST BErlin‘s gETHSEMANE CHURCH 30 | ARRESTS AND EXPULSIONS 56 | WE ARE THE PEOPLE! 34 | FIRST STEPS TO REVOLUTION 60 | THE SEd‘s nEW TACTIC 62 | THE CRUMBLING SYSTEM 66 | 4 NOVEMBER 1989 70 | 9 NOVEMBEr 1989 – THE FALL OF THE WALL 74 | THE BATTLE FOR POWER CONTENTS 3 4 IMPRESSIONS OF THE EXHIBITION INSTALLATION © SERGEJ HOROVITZ 5 6 IMPRESSIONS OF THE EXHIBITION INSTALLATION OPENING ADDRESS For Berlin, 2009 is a year of commemorations of the moving Central and Eastern European countries and Mikhail Gorbachev’s events of 20 years ago, when the Peaceful Revolution finally policy of glasnost and perestroika had laid the ground for change. toppled the Berlin Wall. The exhibition presented on Alexander- And across all the decades since the airlift 60 years ago, Berlin platz by the Robert Havemann Society is one of the highlights of was able to depend on the unprecedented solidarity of the Ameri cans, the theme year “20 Years since the Fall of the Wall”. -
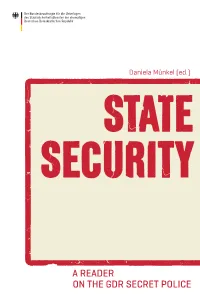
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann -

Nonviolent Struggle and the Revolution in East Germany
Nonviolent Struggle and the Revolution in East Germany Nonviolent Struggle and the Revolution in East Germany Roland Bleiker Monograph Series Number 6 The Albert Einstein Institution Copyright 01993 by Roland Bleiker Printed in the United States of America. Printed on Recycled Paper. The Albert Einstein Institution 1430 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 ISSN 1052-1054 ISBN 1-880813-07-6 CONTENTS Acknowledgments ................... .... ... .. .... ........... .. .. .................. .. .. ... vii Introduction ..............................................................................................1 Chapter 1 A BRIEF HISTORY OF DOMINATION, OPPOSITION, AND REVOLUTION IN EAST GERMANY .............................................. 5 Repression and Dissent before the 1980s...................................... 6 Mass Protests and the Revolution of 1989 .................................... 7 Chapter 2 THE POWER-DEVOLVING POTENTIAL OF NONVIOLENT S"I'RUGGLE................................................................ 10 Draining the System's Energy: The Role of "Exit" ...................... 10 Displaying the Will for Change: The Role of "Voice" ................ 13 Voluntary Servitude and the Power of Agency: Some Theoretical Reflections ..................................................15 Chapter 3 THE MEDIATION OF NONVIOLENT STRUGGLE: COMPLEX POWER RELATIONSHIPS AND THE ENGINEERING OF HEGEMONIC CONSENT ................................21 The Multiple Faces of the SED Power Base ..................................21 Defending Civil -

Anti-Fascism, Anti-Communism, and Memorial Cultures: a Global
ANTI-FASCISM, ANTI-COMMUNISM, AND MEMORIAL CULTURES: A GLOBAL STUDY OF INTERNATIONAL BRIGADE VETERANS by Jacob Todd Bernhardt A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in History Boise State University May 2021 © 2021 Jacob Todd Bernhardt ALL RIGHTS RESERVED BOISE STATE UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE DEFENSE COMMITTEE AND FINAL READING APPROVALS of the thesis submitted by Jacob Todd Bernhardt Thesis Title: Anti-Fascism, Anti-Communism, and Memorial Cultures: A Global Study of International Brigade Veterans Date of Final Oral Examination: 08 March 2021 The following individuals read and discussed the thesis submitted by student Jacob Todd Bernhardt, and they evaluated the student’s presentation and response to questions during the final oral examination. They found that the student passed the final oral examination. John P. Bieter, Ph.D. Chair, Supervisory Committee Shaun S. Nichols, Ph.D. Member, Supervisory Committee Peter N. Carroll, Ph.D. Member, Supervisory Committee The final reading approval of the thesis was granted by John P. Bieter, Ph.D., Chair of the Supervisory Committee. The thesis was approved by the Graduate College. DEDICATION For my dear Libby, who believed in me every step of the way. iv ACKNOWLEDGMENTS Throughout the writing of this thesis, I have received a great deal of support and assistance. I would first like to thank my Committee Chair, Professor John Bieter, whose advice was invaluable in broadening the scope of my research. Your insightful feedback pushed me to sharpen my thinking and brought my work to a higher level. I would like to thank Professor Shaun Nichols, whose suggestions helped me improve the organization of my thesis and the power of my argument. -

Introduction
INTRODUCTION “Can we Europeans still entertain? Can we think in the dimensions of a global culture? . The fi rst who has a vision of the fi lm of the future, to him belongs BABELSBERG!”1 With this bold statement in 1992, Volker Schlöndorff, an acclaimed cineaste born in West Germany (the Federal Republic of Germany, or FRG; hereafter West Germany or FRG), invited European artists to take over the studios near Berlin. The same stu- dios had housed the now defunct East German state-run fi lm company, Deutsche Film-Aktiengesellschaft (DEFA; 1946–92) and before that, one of the largest motion picture industries on the continent, Universum Film-Aktiengesellschaft (UFA; 1917–45). As Babelsberg’s managing di- rector (1992–97), Schlöndorff had avowed earlier in his statement: “To me, the name DEFA has no color or odor. Like the name UFA, it belongs to history and to an era that is not mine. It should continue to live in history as a name.”2 This text and later interviews stirred a larger de- bate about the dismantling of DEFA right after the collapse of East Ger- many (the German Democratic Republic, or GDR; hereafter either East Germany or GDR)—a controversy in which hundreds of fi lmmakers and crew members were dismissed from their job because they were viewed as obsolete in a newly transformed industry. In what became known as the public battle for Babelsberg, former DEFA employees largely decried Schlöndorff’s failure to recognize how much they had in common with their Western counterparts, particularly in regard to their contribution to -

Bulletin 10-Final Cover
COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN 10 61 “This Is Not A Politburo, But A Madhouse”1 The Post-Stalin Succession Struggle, Soviet Deutschlandpolitik and the SED: New Evidence from Russian, German, and Hungarian Archives Introduced and annotated by Christian F. Ostermann I. ince the opening of the former Communist bloc East German relations as Ulbricht seemed to have used the archives it has become evident that the crisis in East uprising to turn weakness into strength. On the height of S Germany in the spring and summer of 1953 was one the crisis in East Berlin, for reasons that are not yet of the key moments in the history of the Cold War. The entirely clear, the Soviet leadership committed itself to the East German Communist regime was much closer to the political survival of Ulbricht and his East German state. brink of collapse, the popular revolt much more wide- Unlike his fellow Stalinist leader, Hungary’s Matyas spread and prolonged, the resentment of SED leader Rakosi, who was quickly demoted when he embraced the Walter Ulbricht by the East German population much more New Course less enthusiastically than expected, Ulbricht, intense than many in the West had come to believe.2 The equally unenthusiastic and stubborn — and with one foot uprising also had profound, long-term effects on the over the brink —somehow managed to regain support in internal and international development of the GDR. By Moscow. The commitment to his survival would in due renouncing the industrial norm increase that had sparked course become costly for the Soviets who were faced with the demonstrations and riots, regime and labor had found Ulbricht’s ever increasing, ever more aggressive demands an uneasy, implicit compromise that production could rise for economic and political support. -

Separation After Unification? the Crisis of National Identity in Eastern Germany
Separation After Unification? The Crisis of National Identity in Eastern Germany Andreas Staab Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy London School of Economics and Political Science University of London December 1996 i UMI Number: U615798 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615798 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 I S F 7379 OF POLITICAL AND S&uutZ Acknowledgements I would like to express my thanks to George Schopflin for having taken the time and patience to supervise my work. His professional advice have been of immense assistance. I have also greatly benefited from the support and knowledge of Brendan O’Leary, Jens Bastian, Nelson Gonzalez, Abigail Innes, Adam Steinhouse and Richard Heffeman. I am also grateful to Dieter Roth for granting me access to the data of the ‘Forschungsgruppe Wahlen ’. Heidi Dorn at the ‘Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung ’in Cologne deserves special thanks for her ready co-operation and cracking sense of humour. I have also been very fortunate to have received advice from Colm O’Muircheartaigh from the LSE’s Methodology Institute.