Bundesfeier Gansingen – Dienstag, 01
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ranglisten 70. Bezirksverbandschiessen 2017
Ranglisten 70. Bezirksverbandschiessen 2017 19./20./25./26. August 2017 SG Wölflinswil, Schiessanlage "Weidli" Statistik Vereinsrangliste Vereinseinzelrangliste Gesamteinzelrangliste Gruppenwettkampf Jung & Alt 70. Bezirksverbandschiessen 2017 Schützengesellschaft Wölflinswil Statistik Vereinswettkampf Waffen, Teilnehmer, Alterskategorien / Armes, Participants, Catégories Waffe / Arme U17 U21 E/S V SV Total Freigw 0 0 0 7 2 9 Kar 0 0 8 7 11 26 Stagw 0 0 34 3 0 37 Stgw-57/02 0 0 13 19 14 46 Stgw-57/03 1 0 53 31 27 112 Stgw-90 30 28 170 31 17 276 Total 31 28 278 98 71 506 Total Doppelgelder Fr. / Total des taxes Fr. 9943.00 Kränze / Médailles Waffe / Arme U17 U21 E/S V SV Total Freigw 0 0 0 0 0 0 Kar 0 0 1 0 0 1 Stagw 0 0 0 0 0 0 Stgw-57/02 0 0 1 3 0 4 Stgw-57/03 0 0 2 2 0 4 Stgw-90 12 11 42 4 1 70 Total 12 11 46 9 1 79 Kranzkarten / Cartes couronnes Waffe / Arme U17 U21 E/S V SV Total Freigw 0 0 0 7 2 9 Kar 0 0 3 5 10 18 Stagw 0 0 31 2 0 33 Stgw-57/02 0 0 3 7 4 14 Stgw-57/03 0 0 37 23 19 79 Stgw-90 2 1 78 18 8 107 Total 2 1 152 62 43 260 Auszeichungen gesamthaft / Distinctions total Waffe / Arme U17 U21 E/S V SV Total Freigw 0 0 0 7 2 9 Kar 0 0 4 5 10 19 Stagw 0 0 31 2 0 33 Stgw-57/02 0 0 4 10 4 18 Stgw-57/03 0 0 39 25 19 83 Stgw-90 14 12 120 22 9 177 Total 14 12 198 71 44 339 Kranzquoten / Distinctions en % Waffe / Arme U17 U21 E/S V SV Total Freigw 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 Kar 0.0 0.0 50.0 71.4 90.9 73.1 Stagw 0.0 0.0 91.2 66.7 0.0 89.2 Stgw-57/02 0.0 0.0 30.8 52.6 28.6 39.1 Stgw-57/03 0.0 0.0 73.6 80.6 70.4 74.1 Stgw-90 46.7 42.9 70.6 71.0 52.9 64.1 Total 45.2 42.9 71.2 72.4 62.0 67.0 Vereinsrangliste 70. -

Brass Bands of the World a Historical Directory
Brass Bands of the World a historical directory Kurow Haka Brass Band, New Zealand, 1901 Gavin Holman January 2019 Introduction Contents Introduction ........................................................................................................................ 6 Angola................................................................................................................................ 12 Australia – Australian Capital Territory ......................................................................... 13 Australia – New South Wales .......................................................................................... 14 Australia – Northern Territory ....................................................................................... 42 Australia – Queensland ................................................................................................... 43 Australia – South Australia ............................................................................................. 58 Australia – Tasmania ....................................................................................................... 68 Australia – Victoria .......................................................................................................... 73 Australia – Western Australia ....................................................................................... 101 Australia – other ............................................................................................................. 105 Austria ............................................................................................................................ -

Landschaftsqualitätsprojekt Regionalplanungsverband Fricktal Regio
DEPARTEMENT DEPARTEMENT BAU VERKEHR UMWELT FINANZEN UND RESSOURCEN Abteilung Landschaft und Gewässer Landwirtschaft Aargau Trägerschaft: Planungsverband Fricktal Regio Landschaftsqualitätsprojekt Regionalplanungsverband Fricktal Regio Projektbericht Version 18.03.2016 Bearbeitung: Bauernverband Aargau, Im Roos 5, 5630 Muri Impressum Impressum Kontakt Trägerschaft: Planungsverband Fricktal Regio Judith Arpagaus, Laufenplatz 145, 5080 Laufenburg 062 874 47 40; [email protected] Kontakt Kanton: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Landschaft und Gewässer ALG, Sektion Natur und Landschaft Sebastian Meyer, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau 062 835 34 91; [email protected] Departement Finanzen und Ressourcen Landwirtschaft Aargau, Direktzahlungen & Beiträge Louis Schneider, Tellistrasse 67, 5001 Aarau 062 835 27 50; [email protected] Fachperson Landschaft / Projektverfasser: Bauernverband Aargau BVA Sabrina Bütler, Selina Hulst, Ralf Bucher Im Roos 5, 5630 Muri AG 056 460 50 55; [email protected] Titelbild: Sicht auf Oeschgen und Frick. Quelle: Fricktal Regio Planungsverband 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen .................................................................................................................................................... 5 Abbildungen ..................................................................................................................................................... 5 Tabellen .......................................................................................................................................................... -

Rangliste Stich 2
35. Frickbergschiessen 2019 FSG Eiken Einzelrangliste Auszahlungsstich Rang Schütze Resultat Jahrgang Ausz. Waffe Verein 1 Welte Erhard 386 1957 V 58 25.00 Freigw Oeschgen Schützengesellschaft 2 Hünenberger Frédéric 379 1960 S 61 18.00 Stagw Münchenstein Schützengesellschaft 3 Bieli Franz 378 1954 V 55 18.00 Freigw Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen 4 Leubin Othmar 377 1955 V 56 25.00 Stgw-57/03 Eiken Feldschützen 5 Mitterhuber Thomas 377 1964 S 65 18.00 Stagw Oeschgen Schützengesellschaft 6 Chenaux Claude 376 1976 E 77 25.00 Stgw-57/03 Gansingen Schiessverein 7 Deiss Kurt 374 1950 V 51 35.00 Kar Herznach Feldschützen 8 Bräm Hans 372 1954 V 55 18.00 Stagw Fislisbach Schützengesellschaft 9 Hüsler René 372 1962 S 63 25.00 Stgw-57/03 Gansingen Schiessverein 10 Müller Daniela 370 1962 S 63 14.00 Stagw Münchenstein Schützengesellschaft 11 Scholer Jürg 369 1975 E 76 14.00 Stagw Wenslingen Feldschützengesellschaft 12 Kneuss Alfred 368 1960 S 61 14.00 Stagw Büblikon Freischützen 13 Blunschi Rainer 366 1956 V 57 14.00 Stagw Fislisbach Schützengesellschaft 14 Welte Hans 366 1958 V 59 14.00 Stagw Oeschgen Schützengesellschaft 15 Zumsteg Sepp 366 1964 S 65 17.00 Stgw-57/03 Gansingen Schiessverein 16 Hafner Beda 365 1948 SV 49 17.00 Stgw-57/03 Tennwil Feldschützen 17 Häsler Peter 365 1957 V 58 14.00 Stagw Stein-Münchwilen Schützengesellschaft 18 Alpiger Beat 365 1963 S 64 14.00 Stagw Fislisbach Schützengesellschaft 19 Füglister Ivan 365 1997 E 98 14.00 Stagw Döttingen Schützengesellschaft 20 Köppel Gregor 363 1943 SV 44 17.00 Stgw-57/03 -

Polizeireglement Der Gemeinden (Gültig Ab 1
Polizeireglement der Gemeinden (gültig ab 1. Mai 2010) Bözen Densbüren Effingen Eiken Elfingen Frick Gansingen Gipf-Oberfrick Herznach Hornussen Kaisten Laufenburg Mettauertal Oberhof Oeschgen Schwaderloch Sisseln Ueken Wittnau Wölflinswil Zeihen Polizeireglement Oberes Fricktal der Gemeinden Bözen, Densbüren, Effingen, Eiken, Elfingen, Frick, Gansingen, Gipf-Oberfrick, Herznach, Hornus- sen, Kaisten, Laufenburg, Mettauertal, Oberhof, Oeschgen, Schwaderloch, Sisseln, Ueken, Wittnau, Wölflinswil, Zeihen Inhaltsverzeichnis Seite I. Allgemeine Bestimmungen § 1 Zweck 4 § 2 Geltungsbereich 4 § 3 Polizeiorgane 4 § 4 Regionalpolizei Oberes Fricktal 4 § 5 Anordnungen und Vorladungen 4 § 6 Störung der polizeilichen Tätigkeit 5 II. Besondere Bestimmungen A. Immissionsschutz § 7 Grundsätze 5 § 8 Lärmschutz, Mittags- und Nachtruhe 5 § 9 Lautsprecher 5 § 10 Himmelsstrahler 5 B. Schutz der öffentlichen Sachen § 11 Grundsatz 6 § 12 Reinigungspflicht, Littering 6 § 13 Plakate, Reklamen 6 § 14 Ausbringen von Hofdünger 6 C. Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit § 15 Grundsatz 7 § 16 Schiessen, Waffen 7 § 17 Parkieren 7 § 18 Feuerwerk, Feuern im Freien 7 D. Schutz der öffentlichen Sittlichkeit § 19 Grundsatz 7 § 20 Verrichten der Notdurft 7 E. Wirtschafts- und Gewerbepolizei § 21 Grundsatz 8 § 22 Betteln, Sammlungen 8 F. Tierhaltung § 23 Grundsatz 8 § 24 Hundehaltung 8 § 25 Pferdehaltung 8 8 -2- Polizeireglement Oberes Fricktal der Gemeinden Bözen, Densbüren, Effingen, Eiken, Elfingen, Frick, Gansingen, Gipf-Oberfrick, Herznach, Hornus- sen, Kaisten, -

Dä Schnällscht Fricktaler / Di Schnällscht Fricktaleri 28. April 2018
Dä schnällscht Fricktaler / Di schnällscht Fricktaleri 28. April 2018 Rangliste Mädchen Jahrgang 11 Rang E Name Vorname JG Riege Serie Bahnen Vorlauf (8) Halbfinal (4) Final 1 Acklin Larissa 2011 Herznach 7 1 11.19 11.03 11.12 2 Epp Seraphina 2011 Stein 8 2 11.53 11.44 11.45 3 Stocker Svea 2011 Möhlin 8 4 12.06 11.70 11.83 4 * Isch Elin 2011 Hellikon 5 3 11.90 11.85 11.92 5 * Sucular Elif 2011 Sulz Jugend 5 2 11.47 12.01 6 * Schäppi Cheyenne 2012 Sulz Kinderturnen- Jugend2 4 12.05 12.13 7 * Schwaller Mia 2012 Herznach 4 4 12.21 12.14 8 * Schäppi Alisha 2012 Sulz Kinderturnen- Jugend2 3 12.15 12.68 9 * Hort Zoé 2012 Wölflinswil Jugi 5 1 12.34 9 * Fluck Lena 2011 Stein 7 2 12.34 11 * Schifferle Ellen 2011 Herznach 5 4 12.46 12 Picallo Leonia 2011 Sulz Jugend 7 4 12.76 13 Pfister Emma 2012 Zeihen Kids 3 2 12.82 13 Wilhelm Michèle 2011 Herznach 8 1 12.82 15 Abdel-Latif Soraya 2011 Zeihen Kids 8 3 12.92 16 Kleeb Giulia 2012 Sulz Kinderturnen- Jugend3 3 12.96 17 Weiss Luisa 2012 Sulz Kinderturnen- Jugend4 3 12.97 17 Lagler Lena 2011 Sulz Jugend 7 3 12.97 19 Prinz Erin 2011 Möhlin 6 2 13.35 20 Scaglia Laura 2012 Wallbach Jugi 4 2 13.64 21 Amsler Juli 2012 Wölflinswil Jugi 4 1 13.71 22 Kalt Dana 2012 Sulz Kinderturnen- Jugend3 1 13.96 23 Saeed Lana 2011 Möhlin 6 4 14.14 24 Aeschbacher Alina 2012 Herznach 2 1 14.44 25 Käser Alina 2012 Stein 2 2 14.52 26 Galbier Emely 2011 Stein 6 1 14.71 27 Meier Amelia 2013 Stein 1 1 14.80 28 Fuchs Félicia 2011 Sulz Kinderturnen- Jugend6 3 14.82 29 Schmid Fiona 2013 Stein 1 3 15.01 30 Meier Elina 2013 Sulz Kinderturnen- Jugend1 2 15.51 31 Saridis Lea 2013 Stein 1 4 16.87 Männerriege / Frauenturnverein 4333 Münchwilen 28.04.18 17:02 Dä schnällscht Fricktaler / Di schnällscht Fricktaleri 28. -

Agreement Between the European Community and The
L 114/132 EN Official Journal of the European Communities 30.4.2002 AGREEMENT between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the ‘Community’, and THE SWISS CONFEDERATION, hereinafter referred to as ‘Switzerland’, together referred to hereinafter as ‘the Parties’, RESOLVED gradually to eliminate the barriers affecting the bulk of their trade in accordance with the provisions on the establishment of free-trade areas in the Agreement establishing the World Trade Organisation, Whereas, in Article 15 of the Free Trade Agreement of 22 July 1972, the Parties declared their readiness to foster, so far as their agricultural policies allow, the harmonious development of trade in agricultural products to which that Agreement does not apply, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 2. Without prejudice to the concessions set out in Annex 3, the tariff concessions granted by the Community to Switzer- land shall be as listed in Annex 2 hereto. Objective 1. The objective of this Agreement shall be to strengthen Article 3 the free-trade relations between the Parties by improving the access of each to the market in agricultural products of the Concessions regarding cheese other. The specific provisions applicable to trade in cheeses shall be 2. ‘Agricultural products’ means the products listed in as set out in Annex 3 hereto. Chapters 1 to 24 of the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System. For the purposes of applying Annexes 1, 2 and 3 to this Agree- Article 4 ment, the products falling under Chapter 3 and headings 16.04 and 16.05 of the Harmonised System and the products covered Rules on origin by CN codes 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 and 2301 20 00 shall be excluded. -
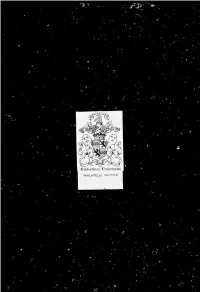
Dated Stamps Or Post Marks
THE POSTAGE STAMPS OF SWITZERLAND P. MIRABAUD - A. DE REUTERSKIOLD THE POSTAGE STAMPS OF SWITZERLAND 1843 - 1862 PARIS LIBRAIRIES-IMPRIMERIES REUNIES MOTTEHOZ, Directeur 7, rue Saint-Benott, 7 1899 TME FOLLOWING NUMBER OF COPIES HAVE BEEN PRINTED OF THIS WORK 1 NO copies in English numbered from / to i5o *200 copies in French numbered from t to joo 150 copies in German numbered from i to tdo C opy N ° 127 PREFACE In the year 1840, England, turning to account the invention of Sir Rowland Hill, was the lirst to introduce prepayment of letters by the employment of postage-stamps. Scarcely half a century has elapsed since this revolution took place, which, modest as it seemed, has been nevertheless so fruitful in its effects, that it would now be diflicull to calculate the mar vellous advantages gained by the civilized world in the circulation of these tiny pictures. If the man of business is now enabled, at a trifling cost, to keep himself in constant communication with his agents dispersed throughout the most distant lands: ifit is easy for the scholar to exchange thoughts with those who in far-off countries are interested in the same studies as himself; if the poorest people can, without any great sacrifice, converse by letter with relations and friends from whom fate has severed them, — it is to the immense facilities afforded to correspondence by the employment of postage-stamps that these benefits are due. Most people, it is true, prolit by these numerous advan tages without considering the source from whence they flow. -

Fricktaler Höhenweg 06.06.14 13:07 Seite 1
Broschüre_Fricktaler_Höhenweg_V7_Fricktaler Höhenweg 06.06.14 13:07 Seite 1 Fricktaler Höhenweg Broschüre_Fricktaler_Höhenweg_V7_Fricktaler Höhenweg 06.06.14 13:07 Seite 2 Aktiv Mit uns sind Sie stets gut unterwegs. Das sichere Gefühl. Broschüre_Fricktaler_Höhenweg_V7_Fricktaler Höhenweg 06.06.14 13:07 Seite 3 Der Fricktaler Höhenweg Entlang des Fricktaler Höhenwegs erleben Sie das Fricktal von seiner schönsten Seite. Wenn Kirschblüten blühen, Wiesen in gelb erstrahlen und die Rast an der Grillstelle oder im Restaurant so gemütlich ist, dass man am liebsten immer verweilen möchte, wenn im Herbst die farbigen Blätter den Waldweg bedecken und in win- terklarer Luft die Höhen des Fricktals, des Schwarzwalds und des Baselbiets in Weiss in den Himmel ragen. Max Mahrer, Möhlin, initiierte 1988 und unterhält auch heute noch den Fricktaler Höhenweg, der heute gut ausgeschildert mit einer Gesamtlänge von ca. 60 Kilometern von der Zähringerstadt Rheinfelden über die Höhen des Tafeljuras, nach Frick und weiter bis ins Weindorf Mettau führt. Die Wegstrecken sind mit blauen Wanderwegtafeln ausgeschildert, gekennzeichnet mit dem Frick - taler Lindenblatt. Wir freuen uns, Ihnen einen Wanderführer zu bieten, der Ihnen, lie- ber Fricktal-Kenner und -Entdecker, ein Begleiter für genussreiche Wanderungen in einer herrlichen Region sein soll. Tourismus Rheinfelden, Jurapark Aargau Rheinfelden – Zeiningen Etappe 1 Zeiningen – Wegenstetten Etappe 2 Wegenstetten – Frick Etappe 3 Frick – Mettau Etappe 4 Erklärung Piktogramme: Unterkunft Restaurant Postauto Bahnanschluss Broschüre_Fricktaler_Höhenweg_V7_Fricktaler Höhenweg 06.06.14 13:07 Seite 4 1 Rheinfelden – Zeiningen Rheinfelden Rheinfelden, die älteste Zähringerstadt der Schweiz, blickt auf eine reiche Vergangenheit zurück. Die unzähligen Sehenswürdigkeiten der Altstadt lassen nicht nur auf eine reiche und spannende Geschichte schliessen, sondern erzählen auch viele Kuriositäten. -

Die Pfarrei Oeschgen
Die Pfarrei Oeschgen Autor(en): Boner, Georg Objekttyp: Article Zeitschrift: Vom Jura zum Schwarzwald : Blätter für Heimatkunde und Heimatschutz Band (Jahr): 43-45 (1969-1971) PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-747099 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Die Pfarrei Oeschgen von -

Pastoralraum Frick Seelsorgeverband Tierstein Oeschgen Kosmas Und
Dienstag, 10. März Spaghetti-Essen im Schlösslikeller Pastoralraum 18.45 Rosenkranz Spaghetti-Essen im Schlösslikeller, zu Gunsten von Fas- 4. Fastensonntag tenopfer und Brot für alle, am Palmsonntag, 29. März, Frick Samstag, 14. März - Vorabend ab 11 Uhr. 18.45 Pfarreigottesdienst, Eucharistiefeier Minis: Celine, Helena «Lachen befreit» Kollekte: Krebsliga Aargau Die Guggenmusik Chinzhaldeschränzer aus Eiken er- Seelsorgeverband Donnerstag, 19. März öffnete den Gottesdienst am Fasnachtssonntag wie 15.00 Krankensalbungsfeier, anschliessend Zvieri gewohnt mit fetziger Musik. In der Predigt erzählte Tierstein 5. Fastensonntag Bernhard Lindner, dass ein Lachen uns befreien kann Sonntag, 22. März und gesund macht. Jedoch auch über Glocken, die Silja Walter: Stadt .Ohne Tod 9.00 Pfarreigottesdienst, Eucharistiefeier scheinbar stören, bekamen wir so einiges zu hören. So Einführung ins Theaterstück Minis: Patrick, Anita zum Beispiel ein «Telefonanruf von Frau Nancy Hol- Sa., 21. März, 19.15 Uhr, Kirche, Gipf-Oberfrick Kollekte: Fastenopfer ten» in der Predigt, wo die «Kuh Almut» und auch die Vor der Aufführung des Theater 58 um 20.00 Uhr steht Lärm-Emission der Kuh- beziehungsweise Kirchenglo- die Person der Schweizer Ordensfrau Silja Walter und cken das Thema waren. Es war rührend, wie sich die ihr Werk im Mittelpunkt. MITTEILUNGEN Frau Holten aus Gipf-Oberfrick um das Wohl anderer engagierte. Die «Kuh Almut“ versicherte ihr, dass Glo- kirchen im kino «Weniger ist mehr» cken wie Musik für sie sei gegenüber des Lärms der ein ökumenisches Begegnungs- und Filmprojekt Am Sonntag, 8. März, 10 Uhr, feiern wir einen Famili- Autos und Rasenmäher und so wünschte sie Frau Hol- Seien Sie mit uns Gäste im Kinosaal des Fricks Monti, engottesdienst zum diesjährigen Fastenopfer-Thema ten einen «KUHTEN» Tag. -

Ortsbürger-Gemeindeversammlung Am Freitag, 11
1 EINLADUNG ZUR Ortsbürger-Gemeindeversammlung am Freitag, 11. Juni 2021, 19:30 Uhr in der Turnhalle Münchwilen & Einwohner-Gemeindeversammlung am Freitag, 11. Juni 2021, 20:00 Uhr in der Turnhalle Münchwilen Ortsbürger-Gemeindeversammlung • 11. Juni 2021 • Münchwilen Einwohner-Gemeindeversammlung • 11. Juni 2021 • Münchwilen Gemeindeverwaltung Münchwilen Öffnungszeiten 3 Alte Rebenstrasse 6, 4333 Münchwilen Montag – Freitag 08.30 – 11.30 Uhr Tel.: +41 62 866 60 30 Dienstagnachmittag 14.00 – 18.00 Uhr Mail: [email protected] Web: www.muenchwilen-ag.ch ALLGEMEINES Einladung zur Gemeindeversammlung Zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom Freitag, 11. Juni 2021 sind alle Stimmberechtigten von Münchwilen ganz herzlich eingeladen. Der Gemeinderat hofft, dass die Geschäfte der Gemeindeversammlung Ihr Interesse wecken und Sie an der Entscheidungsfindung mitwirken. Aktenauflage Die Akten zu den Traktanden der Ortsbürger- / Einwohnergemeindeversammlung liegen vom 28. Mai 2021 bis 11. Juni 2021 während den ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Die Aktenauflage kann direkt über diesen QR-Code abgerufen werden: Stimmrechtsausweise für die Teilnahme an den Gemeindeversammlungen Der Stimmrechtsausweis ist auf der Rückseite der Gemeindeversammlungsbroschüre abgedruckt. Dieser ist abzutrennen und am Eingang zum Versammlungslokal den Stimmenzählern abzugeben. Aufnahmen Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Versammlungsablauf aufgenommen wird. Die Aufnahmen stellen eine wesentliche Erleichterung für