Süddeutsche Hofkapellen Im 18. Jahrhundert
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abstracts Papers Read
ABSTRACTS of- PAPERS READ at the THIRTY-FIFTH ANNUAL MEETING of the AMERICAN MUSICOLOGICAL SOCIETY SAINT LOUIS, MISSOURI DECEMBER 27-29, 1969 Contents Introductory Notes ix Opera The Role of the Neapolitan Intermezzo in the Evolution of the Symphonic Idiom Gordana Lazarevich Barnard College The Cabaletta Principle Philip Gossett · University of Chicago 2 Gluck's Treasure Chest-The Opera Telemacco Karl Geiringer · University of California, Santa Barbara 3 Liturgical Chant-East and West The Degrees of Stability in the Transmission of the Byzantine Melodies Milos Velimirovic · University of Wisconsin, Madison 5 An 8th-Century(?) Tale of the Dissemination of Musico Liturgical Practice: the Ratio decursus qui fuerunt ex auctores Lawrence A. Gushee · University of Wisconsin, Madison 6 A Byzantine Ars nova: The 14th-Century Reforms of John Koukouzeles in the Chanting of the Great Vespers Edward V. Williams . University of Kansas 7 iii Unpublished Antiphons and Antiphon Series Found in the Dodecaphony Gradual of St. Yrieix Some Notes on the Prehist Clyde W. Brockett, Jr. · University of Wisconsin, Milwaukee 9 Mark DeVoto · Unive Ist es genug? A Considerat Criticism and Stylistic Analysis-Aims, Similarities, and Differences PeterS. Odegard · Uni· Some Concrete Suggestions for More Comprehensive Style Analysis The Variation Structure in Jan LaRue · New York University 11 Philip Friedheim · Stat Binghamton An Analysis of the Beginning of the First Movement of Beethoven's Piano Sonata, Op. 8la Serialism in Latin America Leonard B. Meyer · University of Chicago 12 Juan A. Orrego-Salas · Renaissance Topics Problems in Classic Music A Severed Head: Notes on a Lost English Caput Mass Larger Formal Structures 1 Johann Christian Bach Thomas Walker · State University of New York, Buffalo 14 Marie Ann Heiberg Vos Piracy on the Italian Main-Gardane vs. -
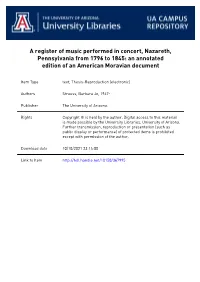
A Register of Music Performed in Concert, Nazareth, Pennsylvania from 1796 to 1845: an Annotated Edition of an American Moravian Document
A register of music performed in concert, Nazareth, Pennsylvania from 1796 to 1845: an annotated edition of an American Moravian document Item Type text; Thesis-Reproduction (electronic) Authors Strauss, Barbara Jo, 1947- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 23:14:00 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/347995 A REGISTER OF MUSIC PERFORMED IN CONCERT, NAZARETH., PENNSYLVANIA FROM 1796 TO 181+52 AN ANNOTATED EDITION OF AN AMERICAN.MORAVIAN DOCUMENT by Barbara Jo Strauss A Thesis Submitted to the Faculty of the SCHOOL OF MUSIC In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF MUSIC WITH A MAJOR IN MUSIC HISTORY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 1 9 7 6 Copyright 1976 Barbara Jo Strauss STATEMENT BY AUTHOR This thesis has been submitted in partial fulfill ment of requirements for an advanced degree at The Univer sity of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this thesis are allowable without special permission, provided that accurate ac knowledgment of source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manu script in whole or in part may -

JV Stich-Punto
Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda J. V. Stich-Punto: historie a současnost jeho díla a odkazu pro budoucí generace Bakalářská diplomová práce Drahoš Kopečný Vedoucí práce: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. Brno 2019 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Podpis: Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu této práce prof. PhDr. Lubomíru Spurnému, Ph.D., za odborné vedení. Dále patří poděkování autora práce paní ředitelce Mgr. Yvettě Zemanové a profesorům Pražské konzervatoře za poskytnutí studijních materiálů a také děkuji PhDr. Janě Mančálové za ochotnou spolupráci při vyhledávání souvislostí v dějinách Žehušic a v životě a díle J. V. Sticha. V neposlední řadě chci též poděkovat Mgr. Janě Svobodové a paní kurátorce Petře Michalové z Městského muzea a knihovny v Čáslavi. Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 7 1. Osobnost Jana Václava Sticha-Punta ............................................................................................... 8 1.1. Stich-Punto skladatelem .......................................................................................................... 8 1.2. Punto – virtuos a jeho technika hry ........................................................................................ 9 1.3. Vliv Sticha-Punta na Mozarta a Beethovena ........................................................................ -

Giovanni Punto'nun 6 No'lu Korno Konçertosu' Nun
Sahne ve Müzik Eğitim - Araştırma e-Dergisi ISSN: 2149-7079 4. Sayı [email protected] Ocak/2017 GIOVANNI PUNTO'NUN 6 NO'LU KORNO KONÇERTOSU’ NUN İCRA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ * Bahadır ÇOKAMAY Başvuru Tarihi 25.11.2016; Kabul Tarihi: 06.01.2017 ÖZ Korno’nun birçok üflemeli çalgının doğmasına neden olduğu bilinmektedir. 18.yüzyıl boyunca valf ve perde sistemi olmadan solo olarak orkestrada kullanılmıştır. Çalgı icrasında virtüözite anlayışı çerçevesinde örnek olarak, kemanda Paganini, piyanoda Liszt ne ise 18.yüzyılda kornoda da Giovanni Punto olarak kabul edilmiş, ve birçok müzik otoritesinin üst düzey olumlu yorumlarını almıştır. Punto’nun korno icrasına getirdiği yeniliklerin yanında korno edebiyatı için bestelediği eserler, Türkiye’de çok tanınmamasına rağmen Avrupa’da ve dünyanın birçok ülkesinde korno icracılarının repertuarına girmiştir. Bu araştırmada Barok, Klasik ve Romantik Dönemi bir arada barındıran 18.yüzyılın ünlü korno virtüözü Giovanni Punto’nun korno edebiyatının zor eserlerinden biri olan 6 No’lu Korno Konçertosu, sözü edilen yüzyıl içindeki gelişmeler ışığında incelenmiştir. Anahtar Sözcükler : Korno, Konçerto, Giovanni Punto, Form A STUDY OF HORN CONCERTO NO.6 by GIOVANNI PUNTO ACCORDING PERFORMANCE ABSTRACT The horn is known as the first brass instrument and the leader of them. Secondly it is used as solo in orchestras without valve and ventil system in 18th century. Giovanni Punto is accepted in horn in 18th century as same as Paganini in violin or Liszt in piano acc to the virtuosity understanding in playin instrument and also was honored with positive comments of authorities. Punto’s innovations in playing horn and in lots of countries in the world, in the literature of corn really well known in European countries and also took its place even if they are not known enough in Turkey. -

Copyright by Denise Parr-Scanlin 2005
Copyright by Denise Parr-Scanlin 2005 The Treatise Committee for Denise Parr-Scanlin Certifies that this is the approved version of the following treatise: Beethoven as Pianist: A View Through the Early Chamber Music Committee: K.M. Knittel, Supervisor Anton Nel, Co-Supervisor Nancy Garrett Robert Mollenauer David Neumeyer David Renner Beethoven as Pianist: A View Through the Early Chamber Music by Denise Parr-Scanlin, B.M., M.F.A. Treatise Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Musical Arts The University of Texas at Austin December, 2005 Dedication To my mother and first piano teacher, Daisy Elizabeth Liles Parr Acknowledgements I wish to acknowledge the kind assistance of my treatise committee, Dr. Kay Knittel, Dr. Anton Nel, Professor Nancy Garrett, Dr. Robert Mollenauer, Dr. David Neumeyer, and Professor David Renner. I especially thank Dr. Kay Knittel for her expert guidance throughout the project. I also thank Janet Lanier for her assistance with the music examples and my husband, Paul Scanlin, for his constant support and encouragement v Beethoven as Pianist: A View Through the Early Chamber Music Publication No._____________ Denise Parr-Scanlin, D.M.A. The University of Texas at Austin, 2005 Supervisors: K.M. Knittel, Anton Nel Our inability to reconstruct what Ludwig van Beethoven must have sounded like as a pianist is one of the more vexing questions of music history. Unreliable sources and his short performing career, in addition to a lack of virtuoso public pieces, have contributed to this situation. -
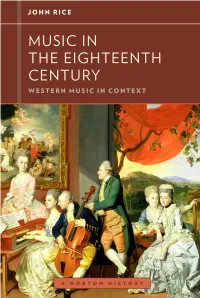
MUSIC in the EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: a Norton History Walter Frisch Series Editor
MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: A Norton History Walter Frisch series editor Music in the Medieval West, by Margot Fassler Music in the Renaissance, by Richard Freedman Music in the Baroque, by Wendy Heller Music in the Eighteenth Century, by John Rice Music in the Nineteenth Century, by Walter Frisch Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries, by Joseph Auner MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY John Rice n W. W. NORTON AND COMPANY NEW YORK ē LONDON W. W. Norton & Company has been independent since its founding in 1923, when William Warder Norton and Mary D. Herter Norton first published lectures delivered at the People’s Institute, the adult education division of New York City’s Cooper Union. The firm soon expanded its program beyond the Institute, publishing books by celebrated academics from America and abroad. By midcentury, the two major pillars of Norton’s publishing program— trade books and college texts—were firmly established. In the 1950s, the Norton family transferred control of the company to its employees, and today—with a staff of four hundred and a comparable number of trade, college, and professional titles published each year—W. W. Norton & Company stands as the largest and oldest publishing house owned wholly by its employees. Copyright © 2013 by W. W. Norton & Company, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America Editor: Maribeth Payne Associate Editor: Justin Hoffman Assistant Editor: Ariella Foss Developmental Editor: Harry Haskell Manuscript Editor: JoAnn Simony Project Editor: Jack Borrebach Electronic Media Editor: Steve Hoge Marketing Manager, Music: Amy Parkin Production Manager: Ashley Horna Photo Editor: Stephanie Romeo Permissions Manager: Megan Jackson Text Design: Jillian Burr Composition: CM Preparé Manufacturing: Quad/Graphics—Fairfield, PA Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rice, John A. -
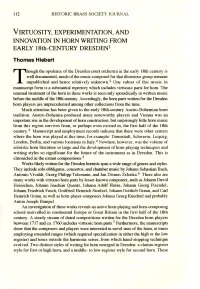
VIRTUOSITY, EXPERIMENTATION, and INNOVATION in HORN WRITING from EARLY 18Th-CENTURY DRESDEN1
112 HISTORIC BRASS SOCIETY JOURNAL VIRTUOSITY, EXPERIMENTATION, AND INNOVATION IN HORN WRITING FROM EARLY 18th-CENTURY DRESDEN1 Thomas Hiebert hough the opulence of the Dresden court orchestra in the early 18th century is well documented, much of the music composed for that illustrious group remains T unpublished and hence relatively unknown.2 One subset of this music in manuscript form is a substantial repertory which includes virtuosic parts for horn. The unusual treatment of the horn in these works is seen only sporadically in written music before the middle of the 18th century. Accordingly, the horn parts written for the Dresden horn players are unprecedented among other collections from the time. Much attention has been given to the early 18th-century Austro-Bohemian horn tradition. Austro-Bohemia produced many noteworthy players and Vienna was an important site in the development of horn construction, but surprisingly little horn music from this region survives from, or perhaps even existed in, the first half of the 18th century.3 Manuscript and employment records indicate that there were other centers where the horn was played at this time, for example: Darmstadt, Schwerin, Leipzig, London, Berlin, and various locations in Italy.4 Nowhere, however, was the volume of soloistic horn literature so large and the development of horn playing techniques and writing styles so significant for the future of the instrument as in Dresden. This is chronicled in the extant compositions.5 Works likely written for the Dresden homists span a wide -

Music Migration in the Early Modern Age
Music Migration in the Early Modern Age Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence Advisory Board Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Alina Żórawska-Witkowska Published within the Project HERA (Humanities in the European Research Area) – JRP (Joint Research Programme) Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West, and South (MusMig) Music Migration in the Early Modern Age Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence Jolanta Guzy-Pasiak, Aneta Markuszewska, Eds. Warsaw 2016 Liber Pro Arte English Language Editor Shane McMahon Cover and Layout Design Wojciech Markiewicz Typesetting Katarzyna Płońska Studio Perfectsoft ISBN 978-83-65631-06-0 Copyright by Liber Pro Arte Editor Liber Pro Arte ul. Długa 26/28 00-950 Warsaw CONTENTS Jolanta Guzy-Pasiak, Aneta Markuszewska Preface 7 Reinhard Strohm The Wanderings of Music through Space and Time 17 Alina Żórawska-Witkowska Eighteenth-Century Warsaw: Periphery, Keystone, (and) Centre of European Musical Culture 33 Harry White ‘Attending His Majesty’s State in Ireland’: English, German and Italian Musicians in Dublin, 1700–1762 53 Berthold Over Düsseldorf – Zweibrücken – Munich. Musicians’ Migrations in the Wittelsbach Dynasty 65 Gesa zur Nieden Music and the Establishment of French Huguenots in Northern Germany during the Eighteenth Century 87 Szymon Paczkowski Christoph August von Wackerbarth (1662–1734) and His ‘Cammer-Musique’ 109 Vjera Katalinić Giovanni Giornovichi / Ivan Jarnović in Stockholm: A Centre or a Periphery? 127 Katarina Trček Marušič Seventeenth- and Eighteenth-Century Migration Flows in the Territory of Today’s Slovenia 139 Maja Milošević From the Periphery to the Centre and Back: The Case of Giuseppe Raffaelli (1767–1843) from Hvar 151 Barbara Przybyszewska-Jarmińska Music Repertory in the Seventeenth-Century Commonwealth of Poland and Lithuania. -

Florida State University Libraries
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2018 The Influences of Mannheim Style in W.A. Mozart's Concerto for Oboe, K. 314 (285D) and Jacques-Christian-Michel Widerkehr's Duo Sonata for Oboe and Piano Scott D. Erickson Follow this and additional works at the DigiNole: FSU's Digital Repository. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC THE INFLUENCES OF MANNHEIM STYLE IN W.A. MOZART’S CONCERTO FOR OBOE, K. 314 (285D) AND JACQUES-CHRISTIAN-MICHEL WIDERKEHR’S DUO SONATA FOR OBOE AND PIANO By SCOTT D. ERICKSON A Treatise submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music 2018 Scott Erickson defended this treatise on March 5, 2018. The members of the supervisory committee were: Eric Ohlsson Professor Directing Treatise Richard Clary University Representative Jeffery Keesecker Committee Member Deborah Bish Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the treatise has been approved in accordance with university requirements. ii ACKNOWLEDGMENTS I am forever grateful to everyone who has helped me along this journey. I am particularly indebted to Dr. Eric Ohlsson, whose passion for teaching and performing has changed the course of my life and career. I am thankful for the immeasurable academic guidance and musical instruction I have received from my supervisory committee: Dr. Deborah Bish, Professor Jeffrey Keesecker, and Professor Richard Clary. Finally, I would never have fulfilled this dream without the constant support and encouragement from my wonderful family. -

CONTENTS 1. 1640–1670: the Transition from Shawm to Hautboy
TEOA01 6/5/01 11:51 AM Page xv CONTENTS List of Illustrations xviii List of Figures xxii List of Tables xxiii List of Musical Examples xxiv Mechanics xxv Abbreviations xxvii Introduction 1 1. 1640–1670: The Transition from Shawm to Hautboy in France 12 A. The Renaissance Shawm and the Protomorphic Hautboy 12 B. Related Instruments 37 C. Hautboy Players at the French Court and the Grande Écurie 49 D. The Development of the New Hautboy, 1664–1670 56 E. Music Played in the Formative Period 59 2. The Physical Characteristics of the Hautboy 62 A. Surviving Original Hautboys 62 B. The Hautboy’s External Form 65 C. Bores and Tone-holes 90 D. Hautboy Pitch 93 E. ‘L’anche, qui donne la vie’: Reeds 99 3. 1670–1700: The Spread of the ‘French Hoboye’ 121 A. France 124 B. Italy 132 C. Germany 134 D. England and ‘Babtist’s vein’ 145 E. Other Areas 152 F. The Hautboy Band 158 G. Questions of Instrumentation 168 H. The Shawm after 1670 173 4. Playing the Hautboy 175 A. Training, Tutors, and Methods 176 B. Holding the Instrument and Body Carriage 179 TEOA01 6/5/01 11:51 AM Page xvi xvi Contents C. Breathing 184 D. Embouchure 187 E. The Sound of the Hautboy 191 F. Range 196 G. Fingerings 201 H. Choice of Key 213 I. The Speaking Phrase Compared with the Romantic ‘Long-line’ 223 J. Paired Tonguing 236 K. Vibrato 250 L. Hautboy Intonation and Keyboard Temperaments 266 M. Technical Limitations 271 5. 1700–1730: The International Hautboy 275 A. -

CM0012005 Booklet:CM0012005 Booklet
Antonio Rosetti (ca.1750 – 1792) BOHEMIAN MUTINEER PRATUM INTEGRUM ORCHESTRA Sinfonie D-dur (Murray A21) Symphony in D major (Murray A21) 1. Largo. Allegro assai . [7:39] 2. Andante scherzante. [6:22] 3. Menuetto fresco . [3:43] 4. Allegro moderato . [5:24] Konzert d-moll für Horn und Orchester (Murray C38) Concerto for horn and orchestra in D minor (Murray C38) 5. Allegro molto . [9:38] Total 6. Adagio (cadenza by H. MacDougall) . [5:27] Time 7. Rondo. Allegro . [5:12] [81:00] Konzert d-moll für Violine und Orchester (Murray C9) Concerto for violin and orchestra in D minor (Murray C9) 8. Allegro maestoso (cadenza by A. Rosetti) . [9:05] 9. Adagio (cadenza by A. Rosetti) . [6:26] 10. Rondo. Moderato (cadenza by D. Sinkovsky). [5:56] Sinfonie g-moll (Murray A42) Symphony in G minor (Murray A42) 11. Vivace. [6:45] 12. Menuetto fresco . [2:31] 13. Andante ma Allegretto. [3:41] BOHEMIAN MUTINEER 14. Capriccio. Allegretto scherzante . [2:47] Antonio Rosetti (ca. 1750 – 1792), born in Bohemia, spent the best years of his life in Germany, in small principalities, far 4 removed from the music capitals of his age. However, the English ENGLISH music historian Charles Burney, who undertook extensive travels in Europe, ranked him among the most outstanding musicians of his time and as the equal of Haydn and Mozart. The public loved Rosetti – and there is plenty of documentary evidence to show that his works were often played throughout Europe. By the end of the 1790s, at least half of those of Rosetti’s compositions that have come down to us had been published, some of them, more- over, by very well-established music publishers. -

University Microrilms International O H L S S O N , E Ric Pa U L
INFORMATION TO USERS This was produced from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or notations which may appear on this reproduction. 1.TIie sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “Missing Page(s)”. If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages, ihis ntay have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure you of complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark it is an indication that the film inspector noticed either blurred copy because of movement during exposure, or duplicate copy. Unless we meant to delete i copyrighted materials that should not have been filmed, you will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photo graphed the photographer has followed a definite method in “sectioning” the material. It is customary to begin filming at the upper left hand comer of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again—beginning below the first row and continuing on until complete. 4. For any illustrations that cannot be reproduced satisfactorily by xerography, photographic prints can be purchased at additional cost and tipped into your xerographic copy.