Bericht DE ISEK Teil 1.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

NGA – Breitbandausbau in Der Gemeinde Freden (Leine) Und Der Gemeinde Holle
NGA – Breitbandausbau In der Gemeinde Freden (Leine) und der Gemeinde Holle Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrages Seite 1 von 16 Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n) Gemeinde Freden (Leine) Herr Thomas Münnecke Am Schillerplatz 4 31084 Freden (Leine) Tel: +49 5184 790 36 Fax: +49 5184 790 40 Email: [email protected] Internet-Adresse(n): Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.freden.de Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannte Kontaktstelle Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerb- lichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) zu verschicken an: die oben genannte Kontaktstelle Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannte Kontaktstelle I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Lokalbehörde I.3) Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung I.4) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: Nein Seite 2 von 16 Abschnitt II: Auftragsgegenstand II.1) Beschreibung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber: Ausschreibung der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Investitionsbeihilfen zum Zwecke der Errichtung und des Betriebs einer Breitbandinfrastruktur sowie des Angebots breitbandiger Telekommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten der Gemeinde Freden (Leine) und der Gemeinde Holle. Ziel der Ausschreibung ist die wirtschaftliche und technologische -
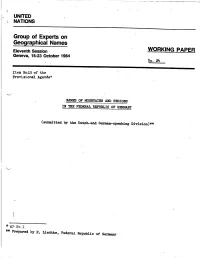
Group of Experts on Geographical Names Z Te^ WORKING PAPER
UNITED NATIONS Group of Experts on Geographical Names ZElevent Teh Sessio^ n WORKING PAPER Geneva, 15-23 October 1984 No. 2U Item NoJ.5 of the Provisional Agenda* . NAMES OF MQUITTAINS AND REGIONS IH THE FEDERAL REPUBLIC OP GERMAHY (submitted by the Butciv-and German-speaking Division)** •* W? Ifo. I ** Prepared by H. Liedtke, Federal Republic of Germany - 2 - GEOGRAPHICAL NAMES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ACCORDING TO THE OFFICIAL GENERAL MAP (UBERSICHTSKARTE) 1:500,000, WORLD MAP SERIE 1404. Compiled by the Permanent Committee on Geographical -Names in the Federal Republic of Germany and prepared for publication by its chairman Prof. Dr. Herbert Liedtke, Geography Department, Ruhr-University, Bochum. Frankfurt am Main May 1984 Adresses; Standiger AusschuB fur Geographische Namen (Permanent Committee on Geographical Names) Institut fiir Angewandte Geodasie Richard-StrauB-Allee 11 D 6000 Frankfurt am Main Prof. Dr. H. Liedtke Ruhr-Universitac Bochum Geographisches Institut Postfach 102148 D 4630 Bochum HOW TO USE THE LIST OF GEOGRAPHICAL NAMES Alphabetical order; A a, A a H h Q o, 6 o U u, U ii B b I i Pp V v Co" J j Q q W w Dd Kk R r • X x Ee LI S s Y y F f . Mm T t Z z G g N n Annotation: A a, Q a £ U ii are handled as a, o & u. 3 can be handled as ss. Examples;_ Breisgau; Underlined names are printed in the Ubersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:500 000. Abteiland: Names not underlined are not printed in the above-mentioned map but are hereby recommended for consideration in a new edition. -

Holle EB 2011
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim Az.: 14-82-30 EB 2011 Bericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Holle zum 01.01.2011 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Hildesheim ___________________________________________________________________________ Inhaltsverzeichnis I. Vorwort......................................................................................................... 3 II. Allgemein ..................................................................................................... 4 III. Durchführung der Prüfung ......................................................................... 5 IV. Aktiva ........................................................................................................... 6 1. Immaterielle Vermögensgegenstände ....................................................... 7 2. Sachvermögen ............................................................................................ 9 3. Finanzvermögen .........................................................................................14 4. Liquide Mittel ..............................................................................................15 5. Aktive Rechnungsabgrenzung ..................................................................15 V. Passiva ....................................................................................................... 16 1. Nettoposition ..............................................................................................18 2. Schulden .....................................................................................................20 -

Landschaftsästhetisches Gutachten
Werkstatt für Landschafts- u. Freiraumentwicklung, Dr. W. Nohl, 85551 Kirchheim b. München Werkstatt für Landschafts- Stockäckerring 17 und Freiraumentwicklung 85551 Kirchheim Dr. Werner Nohl Tel (089) 903 83 46 Honorarprofessor (TU München) Fax (089) 904 58 05 Landschaftsästhetische Auswirkungen der geplanten Windfarm im Büntetal auf den Landschaftsraum der Mittleren Innerste Gutachten Werner Nohl Kirchheim, im Juni 2003 Werkstatt für Landschafts- u. Freiraumentwicklung, Dr. W. Nohl, 85551 Kirchheim b. München Landschaftsästhetische Auswirkungen der geplanten Windfarm im Büntetal auf den Land- schaftsraum der Mittleren Innerste Gutachten Werner Nohl Im Auftrag der Bürgerinitiative „Rettet die Bünte“ e.V., Bad Salzdetfurth Kirchheim, im Juni 2003 Werkstatt für Landschafts- und Stockäckerring 17 Freiraumentwicklung D-85551 Kirchheim bei München Dr. Werner Nohl Tel. (089) 903 83 46 Honorarprofessor (TU München) Fax (089) 904 58 05 [email protected] www.landschaftswerkstatt.de Werkstatt für Landschafts- u. Freiraumentwicklung, Dr. W. Nohl, 85551 Kirchheim b. München GLIEDERUNG Seite 1. Anlass des Gutachtens und Vorgehensweise 1 1.1 Anlass 1 1.2 Vorgehensweise 1 2. Beschreibung der geplanten Windfarm und möglicher land- schaftsästhetischer Auswirkungen 2 2.1 Beschreibung wichtiger Gestaltaspekte 2 2.2 Mögliche landschaftsästhetische Auswirkungen 2 3. Der landschaftsästhetische Wirkraum der geplanten Windfarm im Büntetal – Unterteilung und Abgrenzungen 4 3.1 Abgrenzung des psychologischen Wirkraums 4 3.2 Abgrenzung des visuellen Wirkraums 4 4. Naturschutzrechtlich besonders geschützte Bereiche im landschafts- ästhetischen Wirkraum 6 5. Beurteilung der ästhetischen Qualität der Landschaft in den beiden Wirkräumen 8 5.1 Hinweise zum Landschaftsbild im psychologischen Wirkraum 8 5.2 Ästhetische Bewertung der Landschaft im psychologischen Wirkraum 11 5.3 Hinweise zum Landschaftsbild im visuellen Wirkraums 12 5.4 Ästhetische Bewertung der Landschaft im visuellen Wirkraum 15 6. -

Dorfentwicklungsplan Dorfregion Holle
Dorfentwicklungsplan Dorfregion Holle Landkreis Hildesheim, Gemeinde Holle endgültige Planfassung Stand: 20.12.2016 „Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete“ Gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IMPRESSUM: Auftraggeber: Gemeinde Holle Der Bürgermeister Am Thie 1 31188 Holle Auftragnehmer: planungsgruppe puche gmbh Häuserstr. 1 37154 Northeim [email protected] Projektleitung: Stadtplaner Dipl.-Ing. Wolfgang Pehle Dipl.-Geogr. Tanja Klein Mitarbeit: Dipl.-Geogr. Thomas Fatscher Bianka von Roden, M. A. Dipl.-Ing Stadtplanung Mathias Flörke, M.Sc. Technische Zeichnerin Elke Wirthwein Betreuung: Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser Geschäftsstelle Hildesheim Bahnhofsplatz 2-4 31134 Hildesheim DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HOLLE INHALTSVERZEICHNIS I INHALTSVERZEICHNIS SEITE 1 Zusammenfassung 1 2 Anlass und Ziele des Dorfentwicklungsplanes 8 3 Räumliche Abgrenzung und Kurzbeschreibung der Region 9 4 Abstimmung mit übergeordneten Planungen 11 4.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Hildesheim 11 4.2 Regionale Handlungsstrategie Leine-Weser 2014-2020 12 4.3 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Region nette innerste 13 5 Ausgangslage 14 5.1 Wirtschaftliche Situation 14 5.2 Daseinsvorsorge 15 5.2.1 Infrastruktureinrichtungen 15 5.2.2 Gemeinschaft / (Sozio)Kultur 15 5.2.3 Kommunikationsstrukturen 16 5.2.4 Ver- und Entsorgungsanlagen, Energieversorgung 17 -

Wissenswertes Rund Um Die Gemeinde Söhlde
WissensWertes rund um die Gemeinde söhlde BETTRUM · FELDBERGEN · GROSS HIMSTEDT · HOHENEGGELSEN · KLEIN HIMSTEDT · MÖLME · NETTLINGEN · SÖHLDE · STEINBRÜCK in der Leben GemeindeLde Söh • Hohes Maß an persönlichem Service • Kompetente Pflege und Betreuung • Teilpflege zuhause • Vollstationäre Pflege • Hohes Maß an persönlichem Service • Intensivpflege: Alternative zum • Urlaubsbetreuung, Kurzzeitpflege • Umfassende persönliche und Heimaufenthalt •• Hohes•Hohes Hauseigene MaßMaß anan Küche persönlichempersönlichem ServiceService •• Kompetente Kompetentetelefonische PflegePflege Beratung undund BetreuungBetreuung •• Teilpflege•Teilpflege Versorgung zuhausezuhause mit Mahlzeitem •• Vollstationäre•Vollstationäre Kompetente PflegePflege und Betreuung •• Hohes•Hohes Betreuung MaßMaß anan demenziell persönlichempersönlichem Erkrankter ServiceService •• Intensivpflege:•Intensivpflege: Hauswirtschaftliche AlternativeAlternative Hilfe zumzum •• Urlaubsbetreuung, Urlaubsbetreuung,in familiärer Atmosphäre KurzzeitpflegeKurzzeitpflege •• Umfassende• Umfassende Hochwertig persönlichepersönliche ausgestattete undund Zimmer Heimaufenthalt•Heimaufenthalt 24 Stunden Notrufbereitschaft •• Hauseigene• Hauseigene Umfassende KücheKüche persönliche telefonische•telefonische Parkanlage BeratungBeratungmit Sonnenterrasse •• Versorgung•Versorgung Betreuung mit mitrund MahlzeitemMahlzeitem um einen •• Kompetente Kompetenteund telefonische PflegePflege Beratung undund BetreuungBetreuung •• Betreuung• Betreuung Hauseigene demenzielldemenziell Küche und ErkrankterErkrankter -

Begründung Regionalen Raumordnungsprogramm 2016
Regionales Raumordnungsprogramm 2016, Begründung Seite 39 Begründung zum Regionalen Raumordnungsprogramm 2016 Seite 40 Regionales Raumordnungsprogramm 2016, Begründung Regionales Raumordnungsprogramm 2016, Begründung Seite 41 1 Gesamträumliche Entwicklung des Landes und seiner Teilräume 1.1. Entwicklung der räumlichen Struktur 01 Gemäß § 1 (1) des Raumordnungsgesetzes des Bundes (ROG) ist der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume durch zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Raumordnungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzu- stimmen, die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen und Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raumes zu treffen. In seiner ersten Festlegung definiert der Landkreis Hildesheim daher die Prinzipien, nach denen sich seine räumliche Entwicklung vollziehen soll. Diese lassen sich zu zwei Leitbildern zusammenfassen: 1.) Nachhaltigkeit Der Begriff der Nachhaltigkeit besitzt seinen Ursprung in der Forstwirtschaft und beschreibt dabei den Umstand, dass nicht mehr Holz eingeschlagen werden darf, als in einem bestimm- ten Zeitraum wieder nachwächst. Inzwischen hat der Begriff Eingang in die politische und strategische Diskussion bis hin zur Gesetzgebung (u.a. ROG, BauGB) gefunden. Entspre- chend existiert eine Vielzahl von Interpretationen dieses Begriffs, wobei es keine -

A7-Sanierung: Die Ersten Brücken Werden Abgerissen
A7-Sanierung: Die ersten Brücken werden abgerissen – 16 IN ZAHLEN Hildesheimer das kommt jetzt auf Anwohner und Autofahrer zu 9,5 Kilometer beträgt der Umwegfür Lastwagen Allgemeine Vom19. bis 29.Oktober wird aus RichtungSüden, Umleitung: Hier rollen die Lastwagen LUTTRUM 7 wenn sie über Wester- K5 DasNadelöhr: die A7 bei Holle zur L linde und die B6bei 4 7 LKWinWesterlinde 4 Grasdorf fahren müssen. Großbaustelle –mit einigen WESTERLINDE Westerlinde wird zum Nadelöhrund Zeitung Wendehammer für Lastwagen. Die Umleitungen. Wasdann sollendortvon derAutobahn abfah- 52 ren, dannunter der Fernstraße hin- MillionenEuro soll das geschieht, istaber nur die durch rollenund sofort wieder rechts Gesamtprojekt A7/ Umleitung abbiegen zur Auffahrt in dieGegen- A39inden nächsten Ouvertürezueinem richtung.InWesterlinde müssen An- für Lastwagen Jahrenverschlingen. Vorholz lieger sich deshalb ebenfallsauf eine Dazugehört neben der mehrjährigen Riesenprojekt. deutlichhöhere Lärmbelastung ein- Erneuerung derBrücken K stellen,dadie Lastwagen nicht hinter 7 beiHolle auch der 6 der Lärmschutzwand derAutobahn, sechsspurige Ausbau sonderndirektamDorfrandunter- Text und Fotos: A7 derAutobahn in dem Söhlder wegs sind, dortbremsen,anfahren TarekAbu Ajamieh E45 Abschnitt sowie dieEin- Wald und sich einen Anstieghinaufquälen GRASDORF richtung eines„echten“ A39 müssen. Autobahndreiecks an derAusfahrt Salzgitter. Der B6-Abschnittbei K Die Baustelle: 3 B6 Grasdorfsoll dann nicht 0 WARTJENSTEDT Zwei neue Brücken 7 mehr alsVerbindung zwischen A7undA39 THEMA OELBER AM DieLandesbehörde für Straßenbau dienen undauf eine und Verkehrlässt auf der Autobahn 7 B6 WEISSEN WEGE Spur je Richtung zu- zwischenden Anschlussstellen Derne- rückgebaut werden.Ins- burgund Salzgitter zwei Brücken er- AS Baddeckenstedt gesamt dürftedas drei neuern –die über dieStraße Am Ro- AS Derneburg Ausfahrt in Richtung bisvier Jahredauern. lande in Holle und dieübereinen na- Auffahrt Derneburg Hildesheim gesperrt B6 hen Feldweg. -

Übersichtskarte Maßstab
Protokoll 1 Projekt / AG C030 ILE Region nette innerste Gesprächspartner Siehe Teilnehmerliste Datum / Uhrzeit / 30.08.2017 / 10-11 Uhr / Sportheim Bornum Ort Betreff 3. Sitzung AG Tourismus Info an AG Tourismus, Frau Jarzembinski ERGEBNISPROTOKOLL • Frau Roswitha Hoppe wird zukünftig die ILE Region nette innerste im Netzwerk Kulturtourismus des LK Hildesheim (Kulturbüro) und Netzwerk Kultur und Heimat Hildesheimer Land e.V. vertreten. Frau von Roden bittet Frau Krauss um Auf- nahme von Frau Hoppe in den Mailverteiler. • Herr Ganzkow berichtet vom erfolgreichen Förderantrag der Gemeinde Holle eine Freizeitkarte entwickeln zu können. Bis Anfang 2018 müsse die Wegeführung rechtlich abgesichert sein. Anders als in der ersten Freizeitkarte (nicht herausgege- ben) wird sich die Wegeführung auf einen Rundweg beschränken. • Die Arbeitsgruppe verständigt sich darauf gemeinsam zu beschließen welche Se- henswürdigkeiten und allgemein wichtige Orte/Institutionen etc. (bspw. Bank, Spielplatz, Arzt) ausgewiesen werden soll. Weiterhin wird gemeinsam über den Maßstab, das Grundlayout und etc. entschieden. Ziel soll sein, dass die Karte der Gemeinde Holle komplett integrierbar ist in eine Regionskarte. • Entlang der geplanten Wegeführung müssen zunächst alle Eigentümer gelistet werden. • Es besteht die Idee Gruppenverträge zu entwickeln, z.B. Landwirtschaft, private Eigentümer, Feldmarkinteressentenschaft, Forst. Diese Verträge müssen notariell geprüft werden. Übernommen aus dem Protokoll der 2. AG Tourismus Sitzung (14.06.2017) • Als Radwege, die diskutiert und geprüft werden sollen, werden vorgeschlagen: o Königsdahlum – Hary – Störy – Gr. Ilde – Kl. Ilde o Derneburg – Wöhle • Als Wanderwege werden vorgeschlagen: o Holle: Rundwanderweg mit Anschluss an R5 in Bad Salzdetfurth o Bockenem: Wegeführung entlang der Innerste, Henneckenrode – Bockenem – auf Königsweg führend o Schellerten: Ottbergen (Kapellenberg) – Derneburg durch das Vorholz führend C030 2017-08-30 Protokoll AG Tourismus.docx 2 Protokoll Aufgaben- und Maßnahmenkatalog Nr. -

Dorfsteckbrief Luttrum
Gemeinde HOLLE - Antrag zur Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm PLANUNGSBÜRO SRL WEBER DORFSTECKBRIEF LUTTRUM Abb. : Auszug AK 25.000 / M. 70 % Abb. : Annenkirche, Kirchplatz - Luttrum war bereits Gegenstand einer Dorferneuerung Einwohnerzahl: 361 (31.01.2014) allgemeine Lage: Nordöstliches Gemeindegebiet. Östlich des Vorholzes (bewaldeter Bergrücken) gelegen, in Waldnä- he, eingebettet in landwirtschaftlich genutzte Flächen nach Süden und Osten. Der Asselgraben (aus dem Vorholz) durchläuft das Dorf und fließt der Flote (nicht Innerste !) zu. Einzellage. Verkehr: Über die K 213, mit Anschluss an die B 444 nach Grasdorf zur B 6. Von da aus Anschluss an Auto- bahn A 7 über Abfahrt Derneburg / Salzgitter (Westen) und Autobahn A 39 über Abfahrt Badde- ckenstedt bzw. Westerlinde. Zum Hauptort Holle ca. 6 km entfernt (dort Bahnhaltepunkt). Trotz Ein- zellage gut an das übergeordnete Verkehrsnetz (z.B. Richtung Hildesheim) angebunden. Eine Nah- verkehrsanbindung Richtung Salzgitter / Braunschweig existiert nicht. Ortslage: Die Ortslage hat sich in leichter Hanglage des Bergrückens des Vorholzes entwickelt. Die Besonder- heit liegt in der runden Dorfform mit zentralem Kirchplatz, in deren Mitte eine hübsche Fachwerkka- pelle steht (idealtypisch). Die Wege führen radial auf den Kirchplatz. Die weitere Erschließung er- folgt über einen äußeren Ring. Das Ortsbild des kleinen Dorf ist weiterhin stark ländlich ausgerich- tet, mit landwirtschaftlichen Gebäuden in regionaltypischen Fachwerk bzw. in Ziegelbauweise. Bevölkerungsentwicklung (letzte 50 Jahre; jeweils zum 31.06.) 1963 502 EW 1989 312 EW (Tiefststand) 2000 343 EW 2007 382 EW (Höchststand) 2010 362 EW 2012 354 EW 2013 364 EW 1 PLANUNGSBÜRO SRL WEBER Gemeinde HOLLE - Antrag zur Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm Luttrum ist, bedingt durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, seit 1963 kleiner geworden, hat aber zwischenzeitlich wieder etwas Bewohner gewonnen und liegt seit einigen Jahren stabil bei rd. -

Read PDF > Geographie (Niedersachsen)
ANYEY6QJSUM9 > Book Geographie (Niedersachsen) Geograph ie (Niedersach sen) Filesize: 1.65 MB Reviews It in a single of the most popular ebook. Indeed, it can be play, still an interesting and amazing literature. I am quickly will get a satisfaction of reading a created pdf. (Lennie Renner) DISCLAIMER | DMCA AMRUWA0O9FCZ Doc \\ Geographie (Niedersachsen) GEOGRAPHIE (NIEDERSACHSEN) To download Geographie (Niedersachsen) eBook, you should access the link below and save the document or get access to other information that are have conjunction with GEOGRAPHIE (NIEDERSACHSEN) book. Reference Series Books LLC Jan 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 246x192x10 mm. Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten: 115. Kapitel: Ostfriesische Inseln, Wattenmeer, Vogler, Solling, Elm, Krummhörn, Liste der geographischen Namen der Deutschen Bucht, Papenteich, Münsterländer Kiessandzug, Salzgitter-Höhenzug, Liste der Verwaltungseinheiten in Niedersachsen, Land Hadeln, Ith, Deister, Asse, Land Wursten, Süntel, Butjadingen, Hümmling, Drawehn, Deisterpforte, Dammer Berge, Göttinger Wald, Eggetal, Heber, Bramwald, Selter, Eichsfelder Becken, Nordwald, Rotenberg, Liste der Ober- und Mittelzentren in Niedersachsen, Sackwald, Osterwald, Kleiner Deister, Dümmer-Geestniederung, Weper, Rehburger Berge, Umschwang, Ankumer Höhe, Osterholzer Geest, Hildesheimer Wald, Burgberg, Weserniederung, Vorberge, Wesermünder Geest, Kerstlingeröder Feld, Sauberge, Holzberg, Hube, Großes Moor, Vorholz, Helleberg, Nesselberg, Kiesabbau Mittelweser, Amtsberge, Hainberg, Elfas, -

Informationsbroschüre Der Gemeinde Söhlde 3
lde Söh schüre der Gemeinde tionsbro rma nfo I 2 Herzlich willkommen in der Gemeinde Söhlde typopartner.de | 090519ti typopartner.de Einfach Sympathisch Informationsbroschüre der Gemeinde Söhlde 3 Grußwort des Bürgermeisters Alle Reparaturen für Heizungen und sanitäre Anlagen Herzlich willkommen in unserer Gemeinde Söhlde! Im Namen von Rat und Verwaltung begrüße ich Sie sehr herzlich. JÖRG BOKELMANN Die neun Ortschaften der Gemeinde Söhlde • Brennwerttechnik • Kesselreinigung liegen mit verschiedenen Landschaftsschutz- • Brennereinmessung • Regenwassernutzung gebieten reizvoll in der Hildesheimer Börde und • Solaranlagen • Badsanierung in einer Hand bieten Ruhe und Entspannung. Die Gemeinde • Tag und Nacht Störungsdienst ist als Wohnstandort mit zahlreichen öffent- lichen Einrichtungen gut ausgestattet. Oel- und Gas-Heizungsanlagen • Ihr Bad vom Fachmann Teichstraße 16 · 31174 Ottbergen · Telefon (0 51 23) 78 00 · Fax 47 98 Dank leistungsstarker Vereine gibt es ein interessantes und viel- TÜV-zugelassener Fachbetrieb § 19L, WHG • Vertragspartner der E.ON AVACON fältiges Freizeitangebot. Mit dieser Informationsbroschüre erhalten Sie als neue Einwoh- nerin oder neuer Einwohner sowie als Gast einen Überblick und ab 12 Bokelmann 50-2.indd 1 14.12.2006 9:26:20 Uhr lernen unsere Gemeinde schnell besser kennen. Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Ansprechpartner und Daten über die öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Ärzte, Vereine und Verbände Geschichte · Zahlen · Fakten und vieles andere. Am 1. März 1974 ist die Gemeinde Söhlde aus den Ortschaften Bettrum, Sollten Sie diesen Wegweiser als langjährige Einwohnerin oder Feldbergen, Groß und Klein Himstedt, Hoheneggelsen, Mölme, Nettlin- Einwohner der Gemeinde Söhlde in die Hand bekommen, so hoffe gen, Söhlde und Steinbrück gebildet worden, die einst im Gau Astvale ich, dass er auch Ihnen noch Neues und Wissenswertes über Ihre lagen und hier zu Go Eggelsen gehörten.