DEGEM – Mitteilungen 21
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gardner • Even Orpheus Needs a Synthi Edit No Proof
James Gardner Even Orpheus Needs a Synthi Since his return to active service a few years ago1, Peter Zinovieff has appeared quite frequently in interviews in the mainstream press and online outlets2 talking not only about his recent sonic art projects but also about the work he did in the 1960s and 70s at his own pioneering computer electronic music studio in Putney. And no such interview would be complete without referring to EMS, the synthesiser company he co-founded in 1969, or namechecking the many rock celebrities who used its products, such as the VCS3 and Synthi AKS synthesisers. Before this Indian summer (he is now 82) there had been a gap of some 30 years in his compositional activity since the demise of his studio. I say ‘compositional’ activity, but in the 60s and 70s he saw himself as more animateur than composer and it is perhaps in that capacity that his unique contribution to British electronic music during those two decades is best understood. In this article I will discuss just some of the work that was done at Zinovieff’s studio during its relatively brief existence and consider two recent contributions to the documentation and contextualization of that work: Tom Hall’s chapter3 on Harrison Birtwistle’s electronic music collaborations with Zinovieff; and the double CD Electronic Calendar: The EMS Tapes,4 which presents a substantial sampling of the studio’s output between 1966 and 1979. Electronic Calendar, a handsome package to be sure, consists of two CDs and a lavishly-illustrated booklet with lengthy texts. -

Computer Music
THE OXFORD HANDBOOK OF COMPUTER MUSIC Edited by ROGER T. DEAN OXFORD UNIVERSITY PRESS OXFORD UNIVERSITY PRESS Oxford University Press, Inc., publishes works that further Oxford University's objective of excellence in research, scholarship, and education. Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Copyright © 2009 by Oxford University Press, Inc. First published as an Oxford University Press paperback ion Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The Oxford handbook of computer music / edited by Roger T. Dean. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-19-979103-0 (alk. paper) i. Computer music—History and criticism. I. Dean, R. T. MI T 1.80.09 1009 i 1008046594 789.99 OXF tin Printed in the United Stares of America on acid-free paper CHAPTER 12 SENSOR-BASED MUSICAL INSTRUMENTS AND INTERACTIVE MUSIC ATAU TANAKA MUSICIANS, composers, and instrument builders have been fascinated by the expres- sive potential of electrical and electronic technologies since the advent of electricity itself. -

Raesonanz Pressemappe Muen
PRESSEMAPPE räsonanz – Stifterkonzert München 2017 INHALT ZUR INITIATIVE Leitbild räsonanz – Stifterkonzerte Ernst von Siemens Musikstiftung Pressemitteilung Interview mit Michael Roßnagl, Michael Haefliger und Winrich Hopp von Max Nyffeler Interview mit Bettina und Peter von Siemens über Stiftungsgründer Ernst von Siemens Vorschau Luzern 2017 und München 2018 räsonanz – STIFTERKONZERT MÜNCHEN 2017 Programm Luciano Berio über Coro Claude Vivier über Lonely Child Claude Vivier im Gespräch mit Susan Frykberg BIOGRAFIEN Biografien der Komponisten – Luciano Berio – György Ligeti – Claude Vivier Biografien der Interpreten – Sophia Burgos – Teodor Currentzis – MusicAeterna Choir – Mahler Chamber Orchestra BILDMATERIAL musica viva DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS UND LUCERNE FESTIVAL ZUR INITIATIVE räsonanz Stifterkonzerte Mit der Stifterkonzertreihe räsonanz kommt die Ernst von Siemens Musikstiftung ihrer Verantwortung für die zeitgenössische Musik auf ganz besondere Weise nach. Gemeinsam mit ihren Partnern LUCERNE FESTIVAL und musica viva des Bayerischen Rundfunks ermöglicht sie jedes Jahr ein Konzert in München und Luzern: Werke der Gegenwart werden von internationalen Spitzenorchestern und namhaften Solisten zur Aufführung gebracht. Die Ernst von Siemens Musikstiftung bringt so den Stiftergedanken zum Klingen: Ernst von Siemens steht für unternehmerische Vernunft und einzigartigen Weitblick, für gesellschaftliche Verantwortung und anspruchsvolle Förderung von Wissenschaft und Kunst. Gesellschaftliche Relevanz und künstlerischer Anspruch, wagemutige -

Lombardo Et Al 2009 a Virtua
Vincenzo Lombardo,∗ Andrea Valle,∗ John Fitch,† Kees Tazelaar,∗∗ A Virtual-Reality Stefan Weinzierl,†† and Reconstruction of Poeme` Wojciech Borczyk§ ´ ∗Centro Interdipartimentale di Ricerca Electronique Based on Sulla Multimedialita` e l’Audiovisivo Universita` di Torino Philological Research Virtual Reality and Multi Media Park ViaS.Ottavio20 10123 Torino, Italy [email protected]; [email protected] †Department of Computer Science University of Bath BA2 7AY, Bath, United Kingdom [email protected] ∗∗Institute of Sonology Royal Conservatory Juliana v. Stolberglaan 1 2595CA Den Haag, The Netherlands [email protected] ††Fachgebiet Audiokommunikation Technische Universitat¨ Berlin Einsteinufer 17c D-10587 Berlin, Germany [email protected] §Instytut Informatyki Wydzial Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Slaskiej´ Akademicka 16 44-100 Gliwice, Poland [email protected] “The last word is imagination” [Le dernier mot est Electronique´ (1958). This seminal work was Varese’s` imagination] (Edgard Varese,` in Charbonnier 1970, only purely electroacoustic work (apart from the p. 79): with this statement, Varese` replies to George very short La Procession de Verges` of 1955; Bernard Charbonnier, closing a 1955 interview about the 1987, p. 238), and also, to the best of our knowledge, aesthetic postulates of his long but difficult career. the first electroacoustic work in the history of While speaking about the relationship between music to be structurally integrated in an audiovisual music and image, Varese` declares—somewhat context (cf. Chadabe 1997). surprisingly—that he would like to see a film based The history of Poeme` Electronique´ , as docu- on his last completed orchestral work, Deserts´ mented by Petit (1958) and Treib (1996), goes back (1954). -

Concert Programme
PROGRAMA nomádes... (ciclo internacional de obras audiovisuales y obras - Nahe zu fern (1987) 13’54’’ Dirk Reith electroacústicas) Obra electroacústica acusmatica Curado por Claudia Robles Angel - TRAVELOG #1 – Nuit Bleue - (2008) 10’ Claudia Robles A Obra audiovisual Invitado especial: Prof. Dirk Reith -Ambi-Schlagfluss (2005) 3’ Joachim Heintz Obra electroacústica acusmatica 11.04 2013 - REFRACTION (2010) 7’ 04’’ Hiromi Ishii Centro Cultural, Universidad de los Andes. Obra audiovisual Bogotá, Colombia 7:00 PM. - Nested loops V (2007) 7’10’’ Dirk Reith Obra electroacústica acusmatica INTERMEDIO El propósito de este ciclo de conciertos consiste principalmente en la - verSTIMMUNG (1995) 8'41'’ Dirk Reith diseminación por todo el mundo de obras audiovisuales de medio fijo; en Obra electroacústica acusmatica estas obras la música y la imagen comparten el mismo grado de - naT 2 (2006) 12’ Paulo Ferrreira importancia. El ciclo incluye también obras puramente electroacústicas. Obra audiovisual La intención de este ciclo es presentar los conciertos sin un lugar o país -Funktion Blau (1969) 6’07’’ Gottfried Michael Koenig fijo, de acuerdo con el termino nomádes , palabra griega que se utiliza Obra electroacústica acusmatica para definir pueblos que se mueven de un lugar a otro sin asentarse permanentemente en ninguno. - ZHONG (2005) 6’ Claudia Robles A Obra audiovisual - Interactions 2 (2013) 8’ Dirk Reith Obra electroacústica acusmatica He attended and later lectured at the Darmstadt music summer schools. From 1954 to Biografías 1964 Koenig worked in the electronic studio of West German Radio (WDR) producing his electronic compositions Klangfiguren, Essay and Terminus 1 and wrote orchestral and chamber music. Furthermore he assisted other composers, including Kagel, Evangelisti, Paulo Ferreira-Lopes Ligeti, Brün and Stockhausen (with the realization of Kontakte and Gesang der born in Portugal and lives in Germany. -

Thanos Polymeneas – Liontiris
THANOS POLYMENEAS-LIONTIRIS 47 Waterloo Street, Hove, BN3 1AY, UK 0044-(0)-7909 686704 [email protected] - www.thanospl.net - http://apescontainer.org/ Thanos Polymeneas-Liontiris is a composer, performer and sound artist. His practice comprises computer-aided compositions, interactive audiovisual installations and interactive music for dance, theatre and multimedia performances. He obtained a BA in Double Bass, and a BA in Electronic Music and Composition from Rotterdam Conservatoire, while following courses at the Institute of Sonology (Royal Conservatoire of The Hague) and at IRCAM. In addition, he has obtained two MA degrees both with distinction, one in Art and Technology from the Polytechnic University of Valencia and the other in Creative Education from Falmouth University. In 2012 he was awarded the fellowship of the UK Higher Education Academy (FHEA). His scientific publications encompass subjects related to Pedagogy, Technology and Aesthetics. Between 2011 and 2014 he worked as Technical Instructor of the Recording and Sound Studios of the Department of Performance at Falmouth University. Currently he is an AHRC funded researcher at University of Sussex where he also works as Associate Tutor. In 2017 he was appointed Lecturer of Digital Music and Sound Arts at the University of Brighton. Thanos is proficient in computer programming and in speaks fluently five languages (Greek, English, Spanish, Italian and Dutch). ---------------------------------------------------------------------------------------------- STUDIES: DUE 2018 - PhD ABD (Thesis to be submitted by: May 2018) University of Sussex 2014 - MA (Distinction) Creative Education - Falmouth University, UK. 2013 - Postgraduate Diploma in Higher Education (PGDipHE) - University College Falmouth, UK. 2012 - Postgraduate Certificate in Higher Education (PGCHE) - University College Falmouth, UK. -

Muc 4313/5315
MUC 4313/5315 Reading Notes: Chadabe - Electric Sound Sample Exams Moog Patch Sheet Project Critique Form Listening List Truax - Letter To A 25-Year Old Electroacoustic Composer Fall 2003 Table of Contents Chadabe - Electric Sound Chapter Page 1 1 2 3 3 7 4 9 5 10 6 14 7 18 8 21 9 24 10 27 11 29 12 33 Appendex 1 – Terms and Abbreviations 35 Appendex 2 – Backus: Fundamental Physical Quantities 36 Sample Exams Exam Page Quiz 1 37 Quiz 2 40 Mid-Term 43 Quiz 3 47 Quiz 4 50 Final 53 Moog Patch Sheet 59 Project Critique Form 60 Listening List 61 Truax - Letter to a 25-Year Old Electroacoustic Composer 62 i Chapter 1, The Early Instruments What we want is an instrument that will give us a continuous sound at any pitch. The composer and the electrician will have to labor together to get it. (Edgard Varèse, 1922) History of Music Technology 27th cent. B.C. - Chinese scales 6th cent. B.C. - Pythagoras, relationship of pitch intervals to numerical frequency ratios (2:1 = 8ve) 2nd cent. C.E. - Ptolemy, scale-like Ptolemaic sequence 16 cent. C.E. - de Salinas, mean tone temperament 17th cent. C.E. - Schnitger, equal temperament Instruments Archicembalo (Vicentino, 17th cent. C.E.) 31 tones/8ve Clavecin electrique (La Borde, 18th cent. C.E.) keyboard control of static charged carillon clappers Futurist Movement L’Arte dei Rumori (Russolo, 1913), description of futurist mechanical orchestra Intonarumori, boxes with hand cranked “noises” Gran concerto futuristica, orchestra of 18 members, performance group of futurist “noises” Musical Telegraph (Gray, 1874) Singing Arc (Duddell, 1899) Thaddeus Cahill Art of and Apparatus for Generating and Distributing Music Electronically (1897) Telharmonium (1898) New York Cahill Telharmonic Company declared bankruptcy (1914) Electrical Means for Producing Musical Notes (De Forest, 1915), using an audion as oscillator, more cost effective Leon Theremin Aetherphone (1920) a.k.a. -
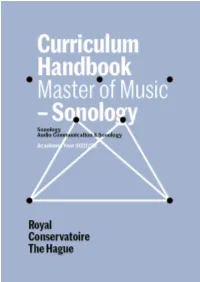
Curriculum Handbook – Master of Sonology
1 Curriculum Handbook – Master of Sonology The information contained in this Curriculum Handbook is, beyond errors and omissions, correct at the time of publication, but may be subject to change during the academic year. Therefore, always make sure you are referring to the latest version of this document which can be found at our website. For questions about courses, you can get in touch with the contact person mentioned in the course description. Due to the COVID-19 circumstances, our education programme and Education and Examination Regulations might differ from how these are described in the regulations and Curriculum Handbooks. In the event of any regulatory changes regarding assessment, a ‘Corona addendum’ will be published. TABLE OF CONTENTS Table of Contents ....................................................................................................................... 2 Introduction ................................................................................................................................ 3 Programme Objectives ............................................................................................................... 4 Curriculum Overviews ................................................................................................................ 7 Sonology .............................................................................................................................................. 7 Audio Communication & Sonology .................................................................................................... -

A History of Electronic Music Pioneers David Dunn
A HISTORY OF ELECTRONIC MUSIC PIONEERS DAVID DUNN D a v i d D u n n “When intellectual formulations are treated simply renewal in the electronic reconstruction of archaic by relegating them to the past and permitting the perception. simple passage of time to substitute for development, It is specifically a concern for the expansion of the suspicion is justified that such formulations have human perception through a technological strate- not really been mastered, but rather they are being gem that links those tumultuous years of aesthetic suppressed.” and technical experimentation with the 20th cen- —Theodor W. Adorno tury history of modernist exploration of electronic potentials, primarily exemplified by the lineage of “It is the historical necessity, if there is a historical artistic research initiated by electronic sound and necessity in history, that a new decade of electronic music experimentation beginning as far back as television should follow to the past decade of elec- 1906 with the invention of the Telharmonium. This tronic music.” essay traces some of that early history and its —Nam June Paik (1965) implications for our current historical predicament. The other essential argument put forth here is that a more recent period of video experimentation, I N T R O D U C T I O N : beginning in the 1960's, is only one of the later chapters in a history of failed utopianism that Historical facts reinforce the obvious realization dominates the artistic exploration and use of tech- that the major cultural impetus which spawned nology throughout the 20th century. video image experimentation was the American The following pages present an historical context Sixties. -

Royal Conservatoire – Curriculum and Course Descriptions
Curriculum Handbook Bachelor of Music – Sonology Academic Year 2020/21 Royal Conservatoire The Hague The information contained in this Curriculum Handbook is, beyond errors and omissions, correct at the time of publication, but may be subject to change during the academic year. Therefore, always make sure you are referring to the latest version of this document which can be found at our website. For questions about courses, you can get in touch with the contact person mentioned in the course description. 2 Royal Conservatoire – The Hague TABLE OF CONTENT Table of Content ......................................................................................................................... 3 Introduction ................................................................................................................................ 5 Programme Objectives Bachelor Sonology ................................................................................ 6 Curriculum Overview .................................................................................................................. 9 Course Descriptions.................................................................................................................. 10 Artistic Development ......................................................................................................................... 10 Specialisation: Composition/Performance/Research ................................................................... 10 Preparation for Individual Projects .............................................................................................. -

Instrumental Sound Structures
Institute of Sonology Royal Conservatory of The Hague _________________________________ Masters in Sonology Instrumental Sound Structures An instrumental approach to sound oriented composition By: Hugo Morales Murguía The Netherlands May 2009 Abstract The current situation of instrumental sound composition relies on the use of unconventional instrumental techniques, the utilization of traditional instruments in combination with technology or the development of new instruments. This paper seeks to analyse the links between new and traditional instrumental means of musical control and expression, by comparing them and ultimately relating them to my own compositional processes and results. Contents Abstract Introduction 4 Chapter I The Western Reinvention of Sound in the 20th Century 7 Listening outside 8 Mechanized sound 10 Electricity and Studios 12 Sound view from a new continent 15 New instrumental resources 18 Technology and tradition 21 Origins of live electronic music 24 Chapter II Instrumental Objects A personal approach to instrumental sound-based composition 27 Encounters 28 Solutions 29 Use of technology 31 Chapter II Examples 33 “Enclosure”, for cajón and live process 34 “Transients”, for amplified trio 40 “Espacios Encordados”, for piano and live process 43 “Hybrid-Guitar”, instrument in development 46 Chapter III Notation in Practice 50 Principles and strategies in music notation The complexity of interpretation 52 Analysis through notation 55 Chapter III Examples 57 Use of conventional notation 58 Notation a Posteriori 60 Notation as a tool for conventional communication 62 References 65 Acknowledgments 67 Instrumental Sound Structures An instrumental approach to sound oriented composition Introduction 5 Introduction Sound is the essence of all music. Western musical culture, however, has fragmented this universe in descriptive elements, allowing the rationalization and development of musical material and technique. -

Yannick Hofmann: Wellenfeldsynthese 3D – Ankunft Akustischer Holografie in Künstlerischer Praxis Sabine Breitsameter: Hörspielfilm
G R U S S W O R T ludger brümmer Das ZKM | Institut für Musik und Akustik heißt Sie herzlich willkommen zu next_generation 5.0, dem größten Treffen der Hochschulstudios für elektronische Musik. Die diesjährige Ausgabe des biennalen Festivals enthält eine Reihe von Superlativen: 27 anwesende Studios - 17 Konzerte - 19 Vorträge - 3 Gesprächsrunden und 7 Poster- sessions - 8 Installationen - 105 aufgeführte Werke, davon über 30 Uraufführungen und dazu das Akusmonium des GRM Paris mit über 50 Lautsprechern, der ZKM_Kubus mit 49 Lautsprechern. Damit ist dieses Festival das größte Festival elektronischer Musik in Deutschland und garantiert somit eine repräsentative Übersicht über das kreative Schaffen im Kontext von Technologie und Kunst. Das Akusmonium gab dem diesjährigen Festival auch den Titel „AKUSMATIK“, Musik die sich nur über den Klang ausdrückt und auf die Bildebene vollständig verzichtet. Das akusmatische Genre ermöglicht die klangliche Ausgestaltung der Musik mit Hilfe von unterschiedlichen in größere oder kleine Gruppen angeordneten Laut- sprechertypen. Was nun die jungen KomponistInnen aus der einzigartigen Möglichkeit, ihr Werk live auf dem Akusmonium im ZKM_Medientheater zu interpretieren, machen werden, wird für die Zuhörer überaus spannend sein. Ebenso spannend wird es, die unterschiedlichen musikalischen Ansätze im Bereich der Live-Elektronik, der Audiovisuellen Komposition oder auch der Installationen im ZKM_Kubus sowie im Studiobereich zu betrachten und in den Gesprächsrunden zu diskutieren. Ich bedanke mich für den Einsatz aller beteiligten Studierenden und Lehrenden, aber auch bei dem Team des ZKM, das in diesen Tagen an die Grenzen des technisch und menschlich Machbaren geraten wird. Dafür wird am Samstag nach den Konzerten kräftig gefeiert, bevor die Konferenz am Sonntag mit den letzten Vorträgen und Konzerten sowie der Versammlung der DEGEM (Deutsche Gesellschaft für elektro- akustische Musik) enden wird, zu der auch interessierte KomponistInnen eingeladen sind.