Das Ramayana Nach Valmiki
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
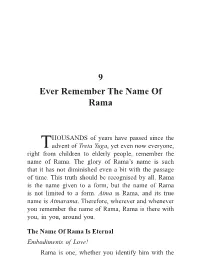
9 Ever Remember the Name of Rama
103 9 Ever Remember The Name Of Rama HOUSANDS of years have passed since the Tadvent of Treta Yuga, yet even now everyone, right from children to elderly people, remember the name of Rama. The glory of Rama’s name is such that it has not diminished even a bit with the passage of time. This truth should be recognised by all. Rama is the name given to a form, but the name of Rama is not limited to a form. Atma is Rama, and its true name is Atmarama. Therefore, wherever and whenever you remember the name of Rama, Rama is there with you, in you, around you. The Name Of Rama Is Eternal Embodiments of Love! Rama is one, whether you identify him with the 104 SATHYA SAI SPEAKS, Volume 40 atma or with the form installed in your heart. Every year comes the festival of Sri Rama Navami. But we have not so far understood its true significance. You identify Rama with a form. But Rama is not limited to any particular form. It is the name that is latent in your heart. Many changes and variations keep occurring in the world, but the name of Rama is immutable, eternal, unsullied and everlasting. Rama was not an ordinary individual. He was verily God who incarnated on earth for the welfare of mankind. People call God by many names like Rama, Krishna, Easwara and Mahadeva. They are all the names of one God. You should recognise the glory of this name. Sage Vasishta said, “Ramo vigrahavan Dharma” (Rama is the personification of Dharma). -

Ramayana: a Divine Drama Actors in the Divine Play As Scripted by Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
Ramayana: A Divine Drama Actors in the Divine Play as scripted by Bhagawan Sri Sathya Sai Baba Volume I Compiled by Tumuluru Krishna Murty Edited by Desaraju Sri Sai Lakshmi © Tumuluru Krishna Murty ‘Anasuya’ C-66 Durgabai Deshmukh Colony Ahobil Mutt Road Hyderabad 500007 Ph: +91 (40) 2742 7083/ 8904 Typeset and formatted by: Desaraju Sri Sai Lakshmi Cover Designed by: Insty Print 2B, Ganesh Chandra Avenue Kolkata - 700013 Website: www.instyprint.in VOLUME I No one can shake truth; no one can install untruth. No one can understand My mystery. The best you can do is get immersed in it. The mysterious, indescribable power has come within the reach of all. No one is born and allowed to live for the sake of others. Each has their own burden to carry and lay down. - Bhagawan Sri Sathya Sai Baba Put all your burdens on Me. I have come to bear it, so that you can devote yourselves to Sadhana TABLE OF CONTENTS FOR VOLUME I PRAYERS 11 1. SAMARPANAM 17 2. EDITORIAL COMMENTS 27 3. THE ESSENCE OF RAMAYANA 31 4. IKSHVAKU DYNASTY-THE IMPERIAL LINE 81 5. DASARATHA AND HIS CONSORTS 117 118 5.1 DASARATHA 119 5.2 KAUSALYA 197 5.3 SUMITRA 239 5.4 KAIKEYI 261 INDEX 321 LIST OF ILLUSTRATIONS FIGURE 1: DESCENT OF GANGA 113 FIGURE 2: PUTHRAKAMESHTI YAGA 139 FIGURE 3: RAMA TAKING LEAVE OF DASARATHA 181 FIGURE 4: DASARATHA SEES THE FATALLY INJURED SRAVANA 191 PRAYERS Vaamaankasthitha Jaanaki parilasat kodanda dandaamkare Chakram Chordhva karena bahu yugale samkham saram Dakshine Bibranam Jalajadi patri nayanam Bhadradri muurdhin sthitham Keyuradi vibhushitham Raghupathim Soumitri Yuktham Bhaje!! - Adi Sankara. -

Constructing Consanguinity Through Culture in Kavitha Kane's Sita's Sister
© 2019 JETIR March 2019, Volume 6, Issue 3 www.jetir.org (ISSN-2349-5162) Constructing Consanguinity through Culture in Kavitha Kane’s Sita’s Sister P. SUBA VETHA Ph. D Research Scholar Research Centre in English Sri Parasakthi College for Women Courtallam-627802 DR. S. KARTHIKA Assistant Professor (Research Supervisor & Head) Research Centre in English Sri Parasakthi College for Women Courtallam-627802 (Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Abishekapatti, Tirunelveli- 627012, Tamil Nadu, India) Abstract Indian English literature is an expression of the profound Indian sensibility and finds its roots in the rich Indian culture. Indian Literature revolves around human actions and the motivation behind the human behavior. The earlier forms of Indian literature were religious. India is a country whose value system is largely dominated by the epics. Kavita Kane, author of the new era, retelling Indian mythology in contemporary context, brings contemporary feel which makes the narrative more relatable for the present-day readers. Kavita Kane gives the readers a new outlook and a new lens for viewing the great epics Ramayan and Mahabharat. The word ‘Consanguinity’ means family relationship. Ramayan demonstrates the highest level of family values. The three types of Family life representing the three forms of civilizations were portrayed in Ramayan. They are: Aryan, Vanara and Rakshasha. The Aryan household was at Ayodhya. The Vanara household at Kishkindha and Rakshasha’s household at Lanka. This paper tries to analyse the point that how a strong bond of Consanguinity was constructed through culture in Kavita Kane’s Sita’s Sister. JETIRAG06143 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 676 © 2019 JETIR March 2019, Volume 6, Issue 3 www.jetir.org (ISSN-2349-5162) Keywords: Family, Strong Relationship, Acceptance, Unity etc…. -

Component-I (A) – Personal Details
Component-I (A) – Personal details: Prof. P. Bhaskar Reddy Sri Venkateswara University, Tirupati. Prof. V. Venkata Ramana Reddy Director, O.R.I., S. V.University, Tirupati. Prof. V. Venkata Ramana Reddy Director, O.R.I., S. V.University, Tirupati. Prof. V. Kannan University of Hyderabad, Hyderabad. 1 Component-I (B) – Description of module: Subject Name Indian Culture Paper Name Vedic, Epic and Puranic culture of India Module Name/Title Important Characters in Ramayana Module Id I C / VEPC / 19 Pre requisites Knowledge in later Vedic literature and importance of Ramayana To know about Significance of Ramayana Objectives Characters, major characters of Ramayana, Unique bonding between some characters, Ramayana characters in Mahabharata Keywords Ramayana / epic E-text (Quadrant-I): 1. INTRODUCTION: CHARACTERS IN RAMAYANA The Ramayana is one of the greatest epics of Hindu Mythology. Written by the sage Valmiki. The Ramayana is not just a story, but also an perfect medium for educating ones life. This has been an educational medium utilized by the ancient sages to impart the values of doing ones dharma (duty) and maintain relationships. The Ramayana has many varieties of characters who set as example how to lead life and how one should not. These characters are templates of roles a human play in life as an ideal father, ideal son, ideal brother, ideal leader, ideal wife, etc. The Ramayana is just not a fictional story, but depicts the importance of values such as how to lead a family life, up keeping the promises, protecting the weak etc. The great epic Ramayana preach a lot of values that we would want our next generation to inculcate. -

Year II-Chap.3-RAMAYANA
CHAPTER THREE Rama, Sita, Lakshmana and Hanuman in RAMAYANA Year II Chapter 3-RAMAYANA THE RAMAYANA Introduction Valmiki is known as Adi Kabi, the first poet. He wrote an epic in Sanskrit, the Ramayana, which depicts the life of Rama, the hero of the story. Sage Narada narrated the story of Rama to Valmiki. Ramayana is divided into the following: o Balakanda (Book of Youth) - Boyhood of Rama, o Ayodhya Kanda (Book of Ayodhya) - Life in Ayodhya after Rama and Sita’s wedding, o Aranya Kanda (Book of Forest) – Rama’s forest life and abduction of Sita by Ravana, o Kishkindha Kanda (Book of Holy Monkey Empire) – Rama’s stay in Kishkindha after meeting Hanuman and Sugriva, o Sundara Kanda (Book of Beauty) – Hanuman’s Prank-locating Sita in Ashoka grove, and o Yuddha Kanda (Book of War) – Rama’s victory over Ravana in the war and Rama’s coronation. The period after coronation of Rama is considered in the last book - Uttara Kanda. The feature story Dasaratha was the king of Kosala, an ancient kingdom that was located in present day Uttar Pradesh. Ayodhya was its capital- located on the banks of the river Sarayu. Dasaratha was loved by one and all. His subjects were happy and his kingdom was prosperous. Even though Dasaratha had everything that he desired, he was very sad at heart; he had no children. During the same time, there lived a powerful Rakshasa (demon) king in the island of Sri Lanka (Ceylon), located just south of India. He was called Ravana. He had ten heads. -

Ramayana, the Epic of Rama, Prince of India
The Ramayana Condensed into English Verse by Romesh C. Dutt To The Right Hon. Professor F. Max Muller Who has devoted his lifetime to the elucidation of the learning, literature, and religion of ancient India and has recognised and vindicated what is true and great and ennobling in modern India this translation of the Ramayana is dedicated as a sincere token of the esteem and regard of my countrymen. 3 Contents A Note on the Late Romesh C. Dutt Bibliography Book I. Sita-Swayamvara (The Bridal of Sita) I. Ayodhya, the Righteous City II. Mithila, and the Breaking of the Bow III. The Embassy to Ayodhya IV. Meeting of Janak and Dasa-ratha V. The Preparation VI. The Wedding VII. Return to Ayodhya Book II. Vana-Gamana-Adesa (The Banishment) I. The Council Convened II. The People Consulted III. The City Decorated IV. Intrigue V. The Queen’s Demand VI. The King’s Lament VII. The Sentence Book III. Dasa-ratha-Viyoga (The Death of the King) I. Woman’s Love II. Brother’s Faithfulness 4 III. Mother’s Blessings IV. Citizens’ Lament V. Crossing the Tamasa: the Citizens’ Return VI. Crossing the Ganges, Bharad-vaja’s Hermitage VII. Crossing the Jumna – Valmiki’s Hermitage VIII. Tale of the Hermit’s Son Book IV. Rama-Bharata-Sambada (The Meeting of the Princes I. The Meeting of the Brothers II. Bharat’s Entreaty and Rama’s Reply III. Kausalya’s Lament and Rama’s Reply IV. Jabali’s Reasoning and Rama’s Reply V. The Sandals VI. The Hermitge of Atri Book V. -

B.A. II YEAR.Xlsx
B.A. II YEAR exam_codeinst_codecate_coderoll_no cname fname Distribution date Submission date 002 103 1 13765 ABHISHEK GURU A B GURU 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13766 AES KUMAR LACHHMAN 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13767 AJAY KUMAR BAGHEL LAXMAN BAGHEL 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13768 AKANKSHA KRISHNA KUMAR 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13769 AKASH MALI FALGUNI MALI 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13770 ALINA KHAN AABID KHAN 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13771 AMISHA RAMU 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13772 ANITA KASHYAP BUDHRAM KASHYAP 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13773 ANJALI JHAPDA RAM 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13774 ANJALI RAO SURYA RAO 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13775 ANKIT EKKA SILBANUS EKKA 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13776 ANURADHA MEDIYA BANSHILAL MEDIYA 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13777 ARUNA PATEL SHIV SHANKAR PATEL 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13778 ASMITA BAHEKAR RAMESH BAHEKAR 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13779 BABLI SOMNATH 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13780 BABLI MOURYA SUKHRAM 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13781 BHARAT SINGH BAGHEL RATAN SINGH BAGHEL 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13782 BHARTI NISHAD NILURAM NISHAD 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13783 BHASKAR KASHYAP KAMLOCHAN KASHYAP 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13784 BHAVESH KUMAR BAGHEL GHASI RAM BAGHEL 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13785 BHAVIKA BAFNA PRAKASHCHAND BAFNA 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13786 BHUPENDRA GAURI SINGH 07/07/2021 13/07/2021 002 103 1 13787 BIHARI LAL SIRDHAR 07/07/2021 13/07/2021 -

Urmila: the Depiction of Sacrifices of Less Known Character of Ramayana RADHA D R1 Dr
AEGAEUM JOURNAL ISSN NO: 0776-3808 Urmila: The depiction of sacrifices of less known character of Ramayana RADHA D R1 Dr. PREMALATHA. S2 Research Scholar Assistant Professor REVA University, REVA University, Bangalore. Bangalore. [email protected] [email protected] Ph.no-9986902244 Ph.no-8123730963 Abstract: The Ramayana and Mahabharata are two major epics. The characters of Ram, Sita and Lakshman are very popular among people but Urmila’s character is not highlighted though she sacrificed her whole life for the sake of family. She is known as Sita’s sister or Lakshman’s wife, she didn’t get any special treatment in Mithila even though she is a real princess of Mithila because her parents treated their adopted sister Sita and Urmila in the same way. Sita was very fortunate to have complete attention of her parents but Urmila never felt jealous or hatred with Sita. She loved her unconditionally. In the time of Exile Sita and Lakshman accompanied Ram to the forest but Urmila spent longest fourteen years in the absence of her husband in the doomed palace. She is very courageous and strong, she had taken a responsibility of family management when it needed her the most but her sacrifices and pain is never stressed anywhere in Ramayana. Urmila was a strong pillar in the palace, she used to convince and comfort her family members as they were very sad due to the exile of Ram. She has assisted her brother-in-law Shatrughna in administration as she is very intelligent and brave. She didn’t leave anyone if she finds something is bad and unethical. -

Introduction to Vedic Knowledge
Introduction to Vedic Knowledge Parama Karuna Devi published by Jagannatha Vallabha Vedic Research Center Copyright © 2012 Parama Karuna Devi All rights reserved. Title ID: 4165735 ISBN-13: 978-1482500363 ISBN-10: 148250036 : Jagannatha Vallabha Vedic Research Center +91 94373 00906 E-mail: [email protected] Website: www.jagannathavallabha.com http://www.facebook.com/pages/Parama-Karuna-Devi/513845615303209 http://www.facebook.com/JagannathaVallabhaVedicResearchCenter © 2011 PAVAN PAVAN House Siddha Mahavira patana, Puri 752002 Orissa Introduction to Vedic Knowledge TABLE OF CONTENTS 1. Perspectives of study The perception of Vedic culture in western history Study of vedic scriptures in Indian history 2. The Vedic texts When, how and by whom the Vedas were written The four original Vedas - Samhitas, Brahmanas, Aranyakas Upanishads 3. The fifth Veda: the epic poems Mahabharata and Bhagavad gita Ramayana and Yoga Vasistha Puranas 4. The secondary Vedas Vedangas and Upavedas Vedanta sutra Agamas and Tantra Conclusion 3 Parama Karuna Devi 4 Introduction to Vedic Knowledge The perception of Vedic culture in western history This publication originates from the need to present in a simple, clear, objective and exhaustive way, the basic information about the original Vedic knowledge, that in the course of the centuries has often been confused by colonialist propaganda, through the writings of indologists belonging to the euro-centric Christian academic system (that were bent on refuting and demolishing the vedic scriptures rather than presenting them in a positive way) and through the cultural superimposition suffered by sincere students who only had access to very indirect material, already carefully chosen and filtered by professors or commentators that were afflicted by negative prejudice. -

The Ideal Brothers 6
84 Summer Showers - 2002 6 The Ideal Brothers Saravarupa Dharam Shantham Sarva nama Dharam Shivam Satchidanandam Advaitam Sathyam Shivam Sundaram All the names and forms are but the manifestations of the Supreme Being who is the embodiment of Peace and Auspiciousness. He is Existence-Knowledge-Bliss Absolute and non-dual. He is Sathyam, Sivam, Sundaram (Truth, Goodness, Beauty). (Sanskrit Verse) HE strength and capacities of the Divine are beyond comprehension; yet, without Tunderstanding this, criticism of Divinity is rife. One may praise, another may deride, but Divinity remains the same. Neither will criticism diminish Divinity, nor will praise enhance it. The traits of ebbing and rising are that of this world. Divinity is unaffected 86 Summer Showers - 2002 Summer Showers - 2002 87 by both. Those who hanker after name and fame can dawn to dusk it was Shatrughna who stayed in Ayodhya, never comprehend Divinity. Thousands of students enquired into the problems of the citizens and governed have passed out of this university, having acquired a the kingdom. By night he would faithfully report totally free education. We have not published or everything to Bharatha. Shatrughna carried out every advertised this fact. I derive my joy from their joy and aspect of administration of the kingdom without causing remain contented. the least trouble to Bharatha. Though he did so much, Dedication of Rama’s Brothers his name appears scarcely in literature. Yesterday we had seen that Bharatha did not go Both the sons of Sumitra always engaged into Ayodhya with Rama’s sandals. He instead built a themselves in serving their elder brothers and fostering small ashram at Nandigrama and remained there, unity among themselves. -
Sanskar Gurukul Weekly Update
Sanskar Gurukul Weekly Update Class Name: Atri Week# 14: January 12th, 2014 General Assembly We started the GA with 3 Oms and the Shanti Mantra....some children went on to chant the prayer "Hari Om Sri Gurubhyoh Namah". We spent a few minutes discussion what that prayer meant - and who our Gurus were, and what we learnt from them. We discovered through discussion that Gurus teach us everything, how to live life with good values, and in reality we can learn from everyone around us, even a tiny ant. An Ant, when it discovers food - takes it back to its colony/ant farm and in doing so creates a rtrail for other ants to follow - it teaches us the value of sharing. Also, it can carry several times it own weight - showing its physical prowess - for an ant! We then discussed the upcoming festival of Makara Sankranti, Uttarayan and Pongal. This festival based on the solar calendar, is one of the few Indian festivals that falls on the same day each year - Jan 14.We worship[ the sun, and ask for good health, kn owledge, purity of thought, among many other community driven ways of celebration. Ww asked the students to take as homework an assignment to discussion with your family on how you celebrate this festival and what you call it. We talked about Jan 12 being National Youth Day in India. It was chosen to be on this date as this is also the birthday of Swami Vivekananda who was known for his philosophy and most notably for his bringing to the West the ideas and understanding of Hinduism. -

Sanskar Gurukul Weekly Update
Sanskar Gurukul Weekly Update Class Name: Kashyapa Week# 08: November 09th , 2014 General Assembly We started with 3 Oms and Shanti Mantra. Aparna Aunty explained the mechanism of chanting Om, and explained to children the appropriate way of sitting, breathing, pronunciation and sounding of Om. We then reviewed the prayers before meals, from the Prarthana book. Class In class, we continued with Ramayan … When Sita grew up and reached the age of marriage, Janaka was worried. He could not find a prince who was a perfect match for her. After some thought he announced that whoever could lift the mighty bow of Mahadeva, pull the string and bend the bow, would receive Sita’s hand in marriage. Many princes came from distant lands to attempt this challenge, but they all returned disappointed. Mithila… Rama, Laxmana, Vishwamitra and his rishi’s rested for the night on the outskirts of Mithila. The entire city was decorated and there were festivities everywhere. As soon as people saw Viswamitra, they quickly informed Janaka about his arrival. King Janaka and his ministers came to welcome Vishwamitra to Mithila. Janaka was thrilled to learn that Rama and Laxmana are the sons of his old friend Dashrata. Vishwamitra told Janaka the tales of their bravery. The Yagna… After King Janaka’s yagna was completed successfully, Vishwamitra told him that Rama was keen on seeing Lord Shiva’s bow. Janaka ordered his soldiers to bring the bow to the assembly. Five thousand mighty warriors had to drag the bow and they placed it in the center of the assembly hall.