Selbstentwürfe in Der Fremde. Der
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Staging Iranian Modernity: Authors in Search of New Forms
Copyright by Maryam Shariati 2016 The Dissertation Committee for Maryam Shariati certifies that this is the approved version of the following dissertation: Staging Iranian Modernity: Authors in Search of New Forms Committee: Elizabeth M. Richmond-Garza, Supervisor Mohammad R. Ghanoonparvar, Co-Supervisor Lynn R. Wilkinson Katherine M. Arens Sofian Merabet Staging Iranian Modernity: Authors in Search of New Forms by Maryam Shariati, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY The University of Texas at Austin May 2016 Dedication For my soulmate, Ehsan. For everything. Acknowledgements I wish to gratefully acknowledge the guidance and support I have received, intellectual and otherwise, throughout the process of composing and revising this dissertation. My first debt of gratitude is to my dissertation committee members and in particular my indefatigable supervisor, Professor Elizabeth Richmond-Garza, for her unflinching encouragement and infinite forbearance throughout my studies at The University of Texas at Austin. She has been an erudite mentor, critical commentator, and encouraging guide and I thank her for sharing her wealth of knowledge, invaluable insight and expertise in this project. To my co-supervisor, Professor Mohammad R. Ghanoonparvar, I owe immeasurable debt of gratitude for his intellectual guidance and strong commitment to my research—from the start to finish. His boundless enthusiasm, great knowledge, and unfathomable erudition opened an avenue to many stimulating discussions and enabled me to have a clear direction of my project. Another substantial acknowledgement must go to Professor Lynn Wilkinson for her instrumental role at every stage of my research: conceptualizing, researching, and writing. -

The Poetics of Commitment in Modern Persian: a Case of Three Revolutionary Poets in Iran
The Poetics of Commitment in Modern Persian: A Case of Three Revolutionary Poets in Iran by Samad Josef Alavi A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Near Eastern Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge: Professor Shahwali Ahmadi, Chair Professor Muhammad Siddiq Professor Robert Kaufman Fall 2013 Abstract The Poetics of Commitment in Modern Persian: A Case of Three Revolutionary Poets in Iran by Samad Josef Alavi Doctor of Philosophy in Near Eastern Studies University of California, Berkeley Professor Shahwali Ahmadi, Chair Modern Persian literary histories generally characterize the decades leading up to the Iranian Revolution of 1979 as a single episode of accumulating political anxieties in Persian poetics, as in other areas of cultural production. According to the dominant literary-historical narrative, calls for “committed poetry” (she‘r-e mota‘ahhed) grew louder over the course of the radical 1970s, crescendoed with the monarch’s ouster, and then faded shortly thereafter as the consolidation of the Islamic Republic shattered any hopes among the once-influential Iranian Left for a secular, socio-economically equitable political order. Such a narrative has proven useful for locating general trends in poetic discourses of the last five decades, but it does not account for the complex and often divergent ways in which poets and critics have reconciled their political and aesthetic commitments. This dissertation begins with the historical assumption that in Iran a question of how poetry must serve society and vice versa did in fact acquire a heightened sense of urgency sometime during the ideologically-charged years surrounding the revolution. -

Michael Craig Hillmann–Résumé Copy
Michael Craig Hillmann–Résumé, 1996-2017 3404 Perry Lane, Austin, Texas 78731, USA 512-451-4385 (home tel), 512-653-5152 (cell phone) UT Austin WMB 5.146 office: 512-475-6606 (tel) and 512-471-4197 (fax) [email protected] and [email protected] (e-mail addresses) Web sites: www.utexas.Academia.edu/MichaelHillmann, www.Issuu.com/MichaelHillmann Academic Training_____________________________________________________________________________________________ • Classics, College of the Holy Cross, Worcester (MA), 1958-59. • B.A., English literature, Loyola University Maryland, Baltimore, MD), 1962. • Postgraduate study, English literature, The Creighton University, Omaha (NB), 1962-64. • M.A., Near Eastern Languages and Civilizations, The University of Chicago, 1969. • Postgraduate study, Persian literature, University of Tehran, 1969-73. • Ph.D., Near Eastern Languages and Civilizations, The University of Chicago, 1974. • M.A., English Literature, Texas State University at San Marcos (1997). Professional Positions since 1996__________________________________________________________________________________ • Professor of Persian, The University of Texas at Austin, 1974- . • President, Persepolis Institute (non-academic Persian Language consultants), Austin, 1977- . Teaching since 1996____________________________________________________________________________________________ Language • Elementary Colloquial/Spoken and Bookish/Written Persian (First-year Persian 1 and 2) • Elementary Persian Reading for Iranian Heritage Speakers • Intermediate -

Persian, Farsi, Dari, Tajiki: Language Names and Language Policies
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Department of Anthropology Papers Department of Anthropology 2012 Persian, Farsi, Dari, Tajiki: Language Names and Language Policies Brian Spooner University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/anthro_papers Part of the Anthropological Linguistics and Sociolinguistics Commons, and the Anthropology Commons Recommended Citation (OVERRIDE) Spooner, B. (2012). Persian, Farsi, Dari, Tajiki: Language Names and Language Policies. In H. Schiffman (Ed.), Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and Its Neighbors: The Changing Politics of Language Choice (pp. 89-117). Leiden, Boston: Brill. This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/anthro_papers/91 For more information, please contact [email protected]. Persian, Farsi, Dari, Tajiki: Language Names and Language Policies Abstract Persian is an important language today in a number of countries of west, south and central Asia. But its status in each is different. In Iran its unique status as the only official or national language continueso t be jealously guarded, even though half—probably more—of the population use a different language (mainly Azari/Azeri Turkish) at home, and on the streets, though not in formal public situations, and not in writing. Attempts to broach this exclusive status of Persian in Iran have increased in recent decades, but are still relatively minor. Persian (called tajiki) is also the official language ofajikistan, T but here it shares that status informally with Russian, while in the west of the country Uzbek is also widely used and in the more isolated eastern part of the country other local Iranian languages are now dominant. -

The Symbolism of Bahram Gor‟S Dragon-Slaying in Haft Peykar and the Story‟S Reflection in Kamāl Ud-Dīn Behzād‟S Paintings
THE SYMBOLISM OF BAHRAM GOR’S DRAGON-SLAYING IN HAFT PEYKAR AND THE STORY’S REFLECTION IN KAMĀL UD-DĪN BEHZĀD’S PAINTINGS PJAEE, 17 (5) (2020) THE SYMBOLISM OF BAHRAM GOR‟S DRAGON-SLAYING IN HAFT PEYKAR AND THE STORY‟S REFLECTION IN KAMĀL UD-DĪN BEHZĀD‟S PAINTINGS Atefeh Garoossi1*, Mina Sadri2 1*Master Student of Persian Painting, Visual Arts Faculty, Tehran University, Tehran, Iran. 2Assistant Professor, Painting & Sculpture Department, Visual Arts Faculty, Tehran, University, Tehran Iran. Corresponding Author: 1*[email protected] Atefeh Garoossi, Mina Sadri. The Symbolism of Bahram Gor’s Dragon-slaying in Haft Peykar and the Story’s Reflection in Kamāl Ud-dīn Behzād’s Paintings-- Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17(5), 1414-1424. ISSN 1567- 214x Keywords: Bahram Gor, Dragon Slaying, Symbol, Painting, Haft Peykar. Abstract Haft Peykar is One of Nezami Ganjavi‟s most prominent works. It is a symbolic one and each of its stories and scenes can be interpreted and deciphered in different ways. One of the most important stories among them is Bahram Gor‟s dragon-slaying, which has a considerable presence in Iranian visual arts, including painting. The present research aims to study and decipher the symbols used in this mysterious story, as we believe there are still ambiguous points that can be clarified through more accurate studies. To find them, the following questions have been raised: What are the secrets and mysteries behind the story of Bahram Gor‟s dragon-slaying? What are the characteristics of the reflection of Bahram Gor's dragon- slaying story in Iranian painting? The illustration of Bahram Gor's dragon-slaying story is consistent with the poetry images in Haft Peykar, but it seems that the symbols and mysteries that lie in the hidden layers of this story are not found in the paintings drawn according to this story. -

The Impact of the Modernity Discourse on Persian Fiction
The Impact of the Modernity Discourse on Persian Fiction Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Comparative Studies in the Graduate School of The Ohio State University By Saeed Honarmand, M.A. Graduate Program in Comparative Studies The Ohio State University 2011 Dissertation Committee: Richard Davis, Advisor Margaret Mills Philip Armstrong Copyright by Saeed Honarmand 2011 Abstract Modern Persian literature has created a number of remarkable works that have had great influence on most middle class people in Iran. Further, it has had representation of individuals in a political context. Coming out of a political and discursive break in the late nineteenth century, modern literature began to adopt European genres, styles and techniques. Avoiding the traditional discourses, then, became one of the primary characteristics of modern Persian literature; as such, it became closely tied to political ideologies. Remarking itself by the political agendas, modern literature in Iran hence became less an artistic source of expression and more as an interpretation of political situations. Moreover, engaging with the political discourse caused the literature to disconnect itself from old discourses, namely Islamism and nationalism, and from people with dissimilar beliefs. Disconnectedness was already part of Iranian culture, politics, discourses and, therefore, literature. However, instead of helping society to create a meta-narrative that would embrace all discourses within one national image, modern literature produced more gaps. Historically, there had been three literary movements before the modernization process began in the late nineteenth century. Each of these movements had its own separate discourse and historiography, failing altogether to provide people ii with one single image of a nation. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA, IRVINE Narrative and Iranian
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE Narrative and Iranian Identity in the New Persian Renaissance and the Later Perso-Islamicate World DISSERTATION submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in History by Conrad Justin Harter Dissertation Committee: Professor Touraj Daryaee, Chair Professor Mark Andrew LeVine Professor Emeritus James Buchanan Given 2016 © 2016 Conrad Justin Harter DEDICATION To my friends and family, and most importantly, my wife Pamela ii TABLE OF CONTENTS Page LIST OF FIGURES iv ACKNOWLEDGMENTS v CURRICULUM VITAE vi ABSTRACT OF THE DISSERTATION vii CHAPTER 1: INTRODUCTION 1 CHAPTER 2: Persian Histories in the 9th-12th Centuries CE 47 CHAPTER 3: Universal History, Geography, and Literature 100 CHAPTER 4: Ideological Aims and Regime Legitimation 145 CHAPTER 5: Use of Shahnama Throughout Time and Space 192 BIBLIOGRAPHY 240 iii LIST OF FIGURES Page Figure 1 Map of Central Asia 5 iv ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude to all of the people who have made this possible, to those who have provided guidance both academic and personal, and to all those who have mentored me thus far in so many different ways. I would like to thank my advisor and dissertation chair, Professor Touraj Daryaee, for providing me with not only a place to study the Shahnama and Persianate culture and history at UC Irvine, but also with invaluable guidance while I was there. I would like to thank my other committee members, Professor Mark LeVine and Professor Emeritus James Given, for willing to sit on my committee and to read an entire dissertation focused on the history and literature of medieval Iran and Central Asia, even though their own interests and decades of academic research lay elsewhere. -

GHAREHGOZLOU, BAHAREH, Ph.D., August 2018 TRANSLATION STUDIES
GHAREHGOZLOU, BAHAREH, Ph.D., August 2018 TRANSLATION STUDIES A STUDY OF PERSIAN-ENGLISH LITERARY TRANSLATION FLOWS: TEXTS AND PARATEXTS IN THREE HISTORICAL CONTEXTS (261 PP.) Dissertation Advisor: Françoise Massardier-Kenney This dissertation addresses the need to expand translation scholarship through the inclusion of research into different translation traditions and histories (D’hulst 2001: 5; Bandia 2006; Tymoczko 2006: 15; Baker 2009: 1); the importance of compiling bibliographies of translations in a variety of translation traditions (Pym 1998: 42; D’hulst 2010: 400); and the need for empirical studies on the functional aspects of (translation) paratexts (Genette 1997: 12–15). It provides a digital bibliography that documents what works of Persian literature were translated into English, by whom, where, and when, and explores how these translations were presented to Anglophone readers across three historical periods—1925–1941, 1942–1979, and 1980–2015— marked by important socio-political events in the contemporary history of Iran and the country’s shifting relations with the Anglophone West. Through a methodical search in the library of congress catalogued in OCLC WorldCat, a bibliographical database including 863 editions of Persian-English literary translations along with their relevant metadata—titles in Persian, authors, translators, publishers, and dates and places of publication—was compiled and, through a quantitative analysis of this bibliographical data over time, patterns of translation publication across the given periods -
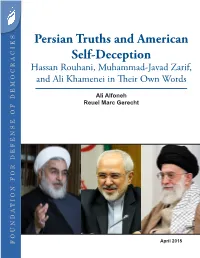
Persian Truths and American Self-Deception Hassan Rouhani, Muhammad-Javad Zarif, and Ali Khamenei in Their Own Words
Persian Truths and American Self-Deception Hassan Rouhani, Muhammad-Javad Zarif, and Ali Khamenei in Their Own Words Ali Alfoneh Reuel Marc Gerecht April 2015 FOUNDATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES FOUNDATION Persian Truths and American Self-Deception Hassan Rouhani, Muhammad-Javad Zarif, and Ali Khamenei in Their Own Words Ali Alfoneh Reuel Marc Gerecht April 2015 FDD PRESS A division of the FOUNDATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES Washington, DC Persian Truths and American Self-Deception Table of Contents Introduction: A Decent Respect for the Written Word [in Persian] ......................................................................... 2 I: The Man and The Myth: The Many Faces of Hassan Rouhani ............................................................................. 4 II: An Iranian Moderate Exposed: Everyone Thought Iran’s Foreign Minister Was a Pragmatist. They Were Wrong. .............................................................................................................................................................................. 19 III: Iran’s Supreme Censor: The Evolution of Ali Khamenei from Sensitive Lover of Western Literature to Enforcer of Islamic Revolutionary Orthodoxy .......................................................................................................... 25 Persian Truths and American Self-Deception Introduction: A Decent Respect ever-so-short reform movement under president Mohammad Khatami) — they may have read little for the Written Word [in Persian] of the writings of the mullahs -

Secular Writers' Engagement with Religious Tradition in 20Th Century Iran: from Undermining to Deconstructing; a Generational
International Journal of Comparative Literature & Translation Studies ISSN: 2202-9451 www.ijclts.aiac.org.au Secular Writers’ Engagement with Religious Tradition in 20th Century Iran: From Undermining to Deconstructing; A Generational Paradigm Shift Elham Hosnieh* Graduate School of Global Studies, Doshisha University, Kyoto, Japan. Corresponding Author: Elham Hosnieh, E-mail: [email protected] ARTICLE INFO ABSTRACT Article history The present article is an attempt to conceptually discuss the development of modern secular Received: July 22, 2020 approaches to religious tradition in contemporary Iran through the lenses of literary works. Accepted: January 15, 2021 Throughout the paper, secularism has been understood as in the notion of “changes in the conditions Published: January 31, 2021 of belief”, proposed by Charles Taylor. With José Casanova’s reading of Taylor’s conception, Volume: 9 Issue: 1 secularism becomes equivalent to a gradual construction of new and contextually specific images of the self and society, different from European narrative of religious decline. Accordingly, this article revisits the category of the Iranian ‘secular’ writer by looking into the trajectory of the Conflicts of interest: None Iranian literature field and its shifting relation to religion, itself influenced by the change in Funding: None how secularism is understood within the field, during the 20th century. The paper argues that the 1979 revolution and its aftermath led to a paradigm shift in the writers’ conception of secular engagement with the religious tradition when compared with the first and second generation of Keywords: writers. The first generation of Iranian secular writers mostly undermined the religious tradition Iranian Literature, as outdated rituals, and the second generation made a return to it as an authentic part of the Iranian Secularism, identity under the local and global socio-political influences. -

Journal 2016 –
1 JOURNAL OF THE IRAN SOCIETY Editor: David Blow VOL. 2 NO. 15 CONTENTS Lectures: Javanmardi in the Iranian Tradition 7 17th Century Paintings from Safavid Isfahan 15 Travel Scholars’ Reports: Marc Czarnuszewicz 29 Book Reviews: Sweet Boy Dear Wife: Jane Dieulafoy in Persia 1881-1886 34 Memories of a Bygone Age: Qajar Persia and Imperial Russia 1853-1902 46 Nazi Secret Warfare in Occupied Persia. Espionage and Counter-intelligence in Occupied Persia. 49 Shiva Rahbaran – Writers Uncensored. 54 The Love of Strangers. 58 1a St Martin’s House, Polygon Road, London NW1 1QB Telephone : 020 7235 5122 Fax : 020 7259 6771 Web Site : www.iransociety.org Email : [email protected] Registered Charity No 248678 2 OFFICERS AND COUNCIL 2016 (as of the AGM held on 22 June 2016) President SIR RICHARD DALTON K.C.M.G. Vice-Presidents SIR MARTIN BERTHOUD K.C.V.O., C.M.G. MR M. NOËL-CLARKE MR B. GOLSHAIAN MR H. ARBUTHNOTT C.M.G. Chairman MR A. WYNN Hon. Secretary MR D.H.GYE Hon. Treasurer MR R. M. MACKENZIE Hon. Lecture Secretary MRS J. RADY Members of Council Dr F. Ala Dr M-A. Ala Mr S. Ala Mr D. Blow Hon J.Buchan Ms N Farzad Dr T. Fitzherbert Professor Vanessa Martin Dr A. Tahbaz 3 THE IRAN SOCIETY OBJECTS The objects for which the Society is established are to promote learning and advance education in the subject of Iran, its peoples and culture (but so that in no event should the Society take a position on, or take any part in, contemporary politics) and particularly to advance education through the study of the language, literature, art, history, religions, antiquities, usages, institutions and customs of Iran. -

Culture and Cultural Politics Under Reza Shah
Culture and Cultural Politics Under Reza Shah Culture and Cultural Politics Under Reza Shah presents a collection of innovative research on the interaction of culture and politics accompanying the vigorous modernization program of the first Pahlavi ruler. Examining a broad spectrum of this multifaceted interaction it makes an important contribution to the cultural history of the 1920s and 1930s in Iran, when, under the rule of Reza Shah Pahlavi, dramatic changes took place inside Iranian society. With special reference to the practical implementation of specific reform endeavors, the various contributions critically analyze different facets of the relationship between cultural politics, individual reformers, and the everyday life of modernist Iranians. Interpreting culture in its broadest sense, this book brings together con- tributions from different disciplines such as literary history, social history, ethnomusicology, art history, and Middle Eastern politics. In this way, it combines for the first time the cultural history of Iran’s modernity with the politics of the Reza Shah period. Challenging a limited understanding of authoritarian rule under Reza Shah, this book is a useful contribution to existing literature for students and scholars of Middle Eastern History, Iranian History, and Iranian Culture. Dr Bianca Devos is Assistant Professor/Lecturer at the Center for Near and Middle East Studies at the University of Marburg (Germany). Her main fields of research are Iran’s modern history, particularly the press and early modern entrepreneurship, and literary history. Professor Christoph Werner holds the Chair of Iranian Studies at the Center for Near and Middle East Studies at the University of Marburg (Germany). His main fields of interest are Qajar history, vaqf studies, and modern Persian literature.