Die Literatur, Die Mut Macht (Boell, Simmel)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Johannes Mario Simmel Und Das Kino
Retrospektive JOHANNES MARIO SIMMEL 17. Jänner bis 5. Februar 2019 im METRO Kinokulturhaus Retrospektive JOHANNES MARIO SIMMEL UND DAS KINO 17. Jänner bis 5. Februar 2019 METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien 1924 in Wien geboren, beginnt der gelernte Chemiker Johannes Mario Simmel nach Zur Eröffnung am 17.1. diskutieren um 19:00 im Literaturmuseum dem Zweiten Weltkrieg als Journalist und Übersetzer zu arbeiten, ab Anfang der (Johannesgasse 6, 1010 Wien) bei freiem Eintritt Literaturwissenschaftler 1950er wird er auch als Drehbuchautor aktiv (u. a. schreibt er bei Emile E. Reinerts Michael Rohrwasser, Filmhistoriker Christoph Huber und Kurator Florian ABENTEUER IN WIEN mit). Seine Fähigkeiten als Reporter und sein untrügliches Widegger über Bedeutung und Wirkung von Johannes Mario Simmel. Gespür für Themen und Menschen ebnen dem Workaholic in den folgenden Jahren den Weg. Mit dem bombastischen Erfolg des Kaviar-Buchs 1960, das sogleich Kurator: Florian Widegger verfilmt wird, beginnt Simmels Karriere als Romanautor. Anhand dieses Buches lassen sich einige inhaltliche wie stilistische Merkmale Simmels erfassen: Die Hauptfiguren sind meist männlich, gut situiert, haben ihr Herz am rechten Fleck und FILMLISTE sind trotzdem nie um einen Trick verlegen, wenn es darum geht, Eigeninteressen durchzusetzen. Oft sind es äußere Umstände, die ihr Leben durcheinanderwirbeln – HOTEL ADLON (Josef von Báky, A 1951) und immer verlieben sie sich in schöne Frauen. Die Verbindung von schicksalhaftem FRÜHLING AUF DEM EIS (Georg Jacoby, A 1951) Weltgeschehen und Herzschmerz, von Leid und Liebe, von Aufklärung und LIEBE, DIE DEN KOPF VERLIERT (Thomas Engel, A 1956) Romantik – Simmel gelingt sie mühelos. Das macht seine Bücher zwar zugänglich, NACKT – WIE GOTT SIE SCHUF (Hans Schott-Schöbinger, BRD/I 1958) die seriöse Literaturkritik schmähte sie aber fast bis zum Schluss: Erst in seinen MIT HIMBEERGEIST GEHT ALLES BESSER (Georg Marischka, A 1960) letzten Lebensjahren konnte der zu Jahresbeginn 2009 verstorbene Autor jene für AFFÄRE NINA B. -

DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung Des Filmmuseums Berlin 29. April
DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung des Filmmuseums Berlin 29. April – 15. August 2004 Filmreihe im Kino Arsenal 29. April – 26. Mai 2004 Ruth Leuwerik, Hamburg 1961 © Peter Nürnberg Ort: Filmmuseum Berlin im Filmhaus am Potsdamer Platz (Sony Center) Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin Info: Tel. + 49 - (30) - 300 903 -0 Geöffnet: Di – So 10 bis 18 Uhr Do 10 bis 20 Uhr Pfingsten geöffnet Eintritt: 3 € Ermäßigt: 2 € Kombiticket: 7 € (mit Besuch der Ständigen Ausstellung) Ermäßigt: 5 € Katalog: 16,90 € Info: www.henschel-verlag.de Filmreihe: Programm: www.fdk-berlin.de www.filmmuseum-berlin.de DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung des Filmmuseums Berlin 29. April – 15. August 2004 Biografie und Zeitleiste Kindheit und Jugend 1924 – 1946 Am 23. April 1924 wird Ruth Leeuwerik als einzige Tochter von Luise und Julius Martin Leeuwerik in Essen geboren. Das zweite „e“ in ihrem Nachnamen wird Ruth Leuwerik mit dem Beginn ihrer Filmkarriere streichen. Die Familie zieht 1938 nach Münster in Westfalen, wo Ruth nach dem Abschluss der Höheren Handelsschule als Sekretärin des Verkehrsvereins arbeitet und in ihrer Freizeit Schauspielunterricht nimmt. Nach der Prüfung an der Reichstheaterkammer erhält Ruth Leuwerik in der Spielzeit 1942/43 am Westfälischen Landestheater Paderborn ihren ersten Vertrag und tourt mit Gastspielen durch das Sauerland und das Ruhrgebiet. Das folgende Engagement an den Städtischen Bühnen Münster währt nur bis zum Frühling 1944, als das Theater infolge des Krieges schließen muss. Ruth Leuwerik zieht mit ihrer Mutter ins Sauerland und wird zum Arbeitsdienst in der Rüstungsindustrie abkommandiert. -

The Inventory of the Johannes Mario Simmel Collection #459
The Inventory of the Johannes Mario Simmel Collection #459 Howard Gotlieb Archival Research Center SIMMEL, JOHANNES MARIO Gift of August 1970 A. ALLE MENSCHEN WERDEN BRUDER, Droemer Knaur. Munich. 1967. Box 1. Folder 1-7 1. Typescript with many holograph corrections, ca. 650 pp. Box 2. Folder 1-4 Box 3. Folder 1 2. Typescript with holograph corrections, 813 pp. Box 3. Folder 2 3. Typescript with holograph correcti0ns, PP• 420-649 4. Bound page proofs, uncorrected (2 volumes) Box 3. Folder 3 5. Miscellaneous typescript and holograph, ca. 20 pp. Box 3. Folder 4 6. "Naturwissenschaft und Zeitgeist-forschung" Carbon typescript, 23 pp. Boxes 4-7 7. Magazines, newspapers, and clippings, used as background material (4 manuscript boxes) B. BIS ZUR BITTEREN NEIGE. Droemer Knaur. Munich. 1961. Box 8. Folder 1 1. Typescript with many holograph corrections, ca. 350 pp. Box 8. Folder 2 2. Scenes extracted from sections 1-19, Part I. Carbon typescript, ca. 20 pieces. Box 8. Folder 3 3. Miscellaneous typescript with holograph corrections and carbon typescript, ca. 20 pp. SIMMEL, JOHANNES MARIO Gift of Aug:ust 1970 Box 9. 4. Galley proofs. 5. Miscellaneous: a, Biographical notes on JMG for Quick. Typescript with holograph corrections, 6 pp. b, Notes on diseases. Typescript, 4 pp. c, "Ein Bericht Uber m.einen 8 Wochen langen Aufenthalt in den Wittenauer Pflege-and Heilstatten." Typescript with holograph corrections, and notes, 48 pp. d. Material relating to serialization of NEIGE in Quick. Holograph, 12 pp. e. Material relating to illustrations in Quick. Typescript and carbon typescript with holograph corrections, 12 pp. -

Images of the Second World War in Austrian Literature After 1945
Studies in 20th & 21st Century Literature Volume 31 Issue 1 Austrian Literature: Gender, History, and Article 4 Memory 1-1-2007 Images of the Second World War in Austrian Literature after 1945 Karl Müller University of Salzburg Follow this and additional works at: https://newprairiepress.org/sttcl Part of the German Literature Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Müller, Karl (2007) "Images of the Second World War in Austrian Literature after 1945 ," Studies in 20th & 21st Century Literature: Vol. 31: Iss. 1, Article 4. https://doi.org/10.4148/2334-4415.1644 This Article is brought to you for free and open access by New Prairie Press. It has been accepted for inclusion in Studies in 20th & 21st Century Literature by an authorized administrator of New Prairie Press. For more information, please contact [email protected]. Images of the Second World War in Austrian Literature after 1945 Abstract The author examines selected examples of post-1945 Austrian literature, asking what pictures of the Second World War they imparted and what role they played when, certainly from 1948 on, a certain image of history began to take shape in Austria against the background of the Cold War. This image involved a fade-out in particular of the racist nature of the war, and it had a collectively exonerating and distorting impact. Attention is paid to the stories and novels of former participants in the war and National Socialists, such as, for example, Erich Landgrebe, Erich Kern, Hans Gustl Kernmayr, Kurt Ziesel. -
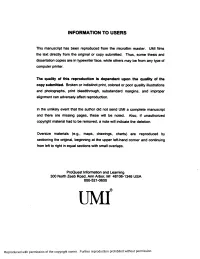
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. WHO CARES WHODUNIT? ANTI-DETECTION IN WEST GERMAN CINEMA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Yogini Joglekar, M.A. ***** The Ohio State University 2002 Dissertation Committee: Approved by Professor John Davidson, Adviser Professor Anna Grotans Adviser Professor Linda Mizejewski ic Languages and Literatures Graduate Program Reproduced with permission of the copyright owner. -

Online Publication October 2010 Gernot Heiss: Österreich Als
Online Publication October 2010 Gernot Heiss: Österreich als Schauplatz des Kalten Krieges im Film document first published in (print): Österreich und Ungarn im Kalten Krieg ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék – Universität Wien, Institut für Zeitgeschichte, Wien – Budapest, 2010. István Majoros, Zoltán Maruzsa, Oliver Rathkolb (Redaktion): Österreich und Ungarn im Kalten Krieg ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék – Universität Wien, Institut für Zeitgeschichte, Wien – Budapest, 2010. Gernot Heiss Österreich als Schauplatz des Kalten Krieges im Film Drehort Das in Besatzungszonen geteilte, dann seit 1955 neutrale Österreich zwischen den Blöcken, vor allem seine Hauptstadt Wien keine 50 Kilometer vom Eisernen Vorhang, war naheliegend ein Ort für Roman- und Filmhandlungen, in denen der Antagonismus zwischen „Freier Welt” und „Kommunismus” thematisiert wurde. Die Mehrheit der im Westen produzierten Filme zum Thema – und nur um diese geht es im Folgenden – und vor allem jene aus Hollywood spielen freilich im pazifischen Raum, der wohl bereits im Zweiten Weltkrieg in der Wahrnehmung und Erinnerung der US-amerikanische Bevölkerung mindestens von gleichgewichtiger Bedeutung mit dem europäischen Kriegsschauplatz war und nun durch den Koreakrieg zum Thema große Aktualität bekommen hatte. Wenn ein Kalter-Kriegs Film in Europa spielt, dann wurde das geteilte Berlin, das auch durch Ereignisse immer wieder als Ort des Ost-Westkonfliktes international in die Schlagzeilen kam, als Schauplatz meistens Wien vorgezogen.1 Die Filmkomödie „One, Two, Three” (USA 1961, Regie Billy Wilder, Drehbuch gemeinsam mit I.A.L. Diamond) lässt darauf schließen, dass selbst Regisseure, die ihre Kindheit und Jugend in Wien verbracht hatten, Berlin als Ort des Ost-Westkonfliktes bevorzugten. Dennoch, unter jenen mit einem Österreichbezug finden sich gute Beispiele, um die wechselnden Tendenzen in den ‚westlichen’ Filmen zur Thematik zu zeigen. -
Abstracts Vol. /Bd.12/2015 Sabine Anselm Margit Riedel Cora Dietl
Abstracts Vol. /Bd.12/2015 Sabine Anselm Abstract: The current piece of youth literature „Marienbilder“ by Tamara Bach as a subject in German class is addressed in this article, starting with the question which genre – novella or novel – the text belongs to. Also, supplementary didactical material will be provided. First, the focus is on the narrative construction, as the reader is being presented with five equally valid versions of events. The way in which this specific fashion of narrating helps solving the ethical questions approached in the text in an aesthetic manner is further presented. In addition to this identity-orientated approach to literature education, features of intertextual and cross-medial narrating are elaborated and commented upon, in the following section of the presentation. In conclusion, the approach is systematized considering the processes of literary education. Keywords: value education, teaching of literature, narrative ethics, youth literature, development of identity, short story, learning through literature, novel. Margit Riedel Abstract: Emilia Galottiis one of the most frequently analyzed German plays and next to Nathan the Wise one of the most famous dramas of the Enlightenment. It has become a piece of the literary canon in general. But there are several more (didactic) reasons to justify working with three Emilia-films in German classes. Firstly dramatic texts are written for the stage not just for being read. Secondly youth nowadays have more and more difficulties in reading long texts especially when their language differs from everyday language, so a visualisation can help. And thirdly, talking about theatre films, or „drama films“ asKepser calls them, will not only teach people in discussing literature and reflecting their own values but will also strengthen their film competence. -

Magazine 29 JANVIER > 4 FÉVRIER 2005
N° 5 magazine 29 JANVIER > 4 FÉVRIER 2005 DO RÉ MI FA FOLLE 5 Deux rendez-vous en direct DU 29 JANVIER de la Folle Journée de Nantes AU Samedi 29 et dimanche 30 janvier 4 FÉVRIER 2005 LES FILMS LES GRANDS RENDEZ-VOUS Rapa Nui de Kevin Reynolds Dimanche 30 janvier à 20.45 et lundi 31 janvier à 15.15 Interview de Theo Van Gogh Lundi 31 janvier à 01.10 De l’histoire ancienne d’Orso Miret Mercredi 2 février à 22.40 L’inconnu du Nord-Express d’Alfred Hitchcock Jeudi 3 février à 20.45 K-G pour le meilleur ou le pire de Jens Jonsson Vendredi 4 février à 15.15 L’amour n’est qu’une parole d’Alfred Vohrer Vendredi 4 février à 23.25 La dérive de Paula Delsol Vendredi 4 février à 01.25 THOMAS MANN ET LES SIENS Mêlant fiction et documents, une saga qui retrace les destins de la tribu Mann, famille d’intellectuels et d’artistes allemands qui a marqué le XXe siècle. “Fiction”, mardi 1er février à 22.45 BAVARIA FILM/SIBYLLE ANNECK 29 JANVIER | 4 FÉVRIER 2005 LES PRIME TIME SAMEDI 29/1 DIMANCHE 30/1 LUNDI 31/1 L’AVENTURE HUMAINE THEMA MUSICA Le fabuleux destin Les mers du Sud Le barbier de Séville des inventions (4) Depuis leur découverte par les Le comte Almaviva demande au Audiovision pour aveugles navigateurs européens, les îles des barbier Figaro de l’introduire auprès et malvoyants Comment la première liaison télégraphique entre l’Europe mers du Sud ont la réputation d’être de la jeune Rosine… (suite page 14) et les États-Unis fut mise en place… un paradis.. -

ANNUAL REPORT 2009 Swiss-Based Highlight Communications AG Is One of the Largest and Most Successful Media Stocks Listed in the German Capital Market
ANNUAL REPORT 2009 Swiss-based Highlight Communications AG is one of the largest and most successful media stocks listed in the German capital market. Its unique selling proposition is its broad product portfolio. Highlight Communications AG at a glance (TCHF) 2009 2008 Consolidated Total assets 632,429 639,883 balance sheet Film assets 205,746 247,627 Cash and cash equivalents 201,090 187,459 Financial liabilities 317,871 304,805 Equity attributable to the shareholders 106,091 91,696 Consolidated Revenues 517,918 518,376 profi t and loss account Profi t from operations 52,900 57,752 Profi t before taxes 44,246 44,552 Net profi t (Highlight shareholders) 31,999 29,777 Earnings per share (CHF) 0.69 0.65 Consolidated Cash fl ow from operating activities 122,841 148,519 cash fl ow statement Cash fl ow for investing activities –94,992 –146,676 thereof payments for fi lm assets –120,676 –116,858 Cash fl ow for/from fi nancing activities –14,067 1,860 thereof dividend payments –9,726 –9,837 Cash fl ow for the reporting period 13,782 3,703 Personnel Headcount as of December 31 670 705 The companies of the Highlight Group design, produce and market top events and premium formats in the areas of fi lm, sports and music. Highlight Communications AG, Pratteln, Switzerland FILM SPORTS- & EVENT-MARKETING 100 % 100 % 80 % Constantin Film AG Highlight Communications Team Holding AG Munich, Germany (Deutschland) GmbH Lucerne, Switzerland Munich, Germany Subsidiaries of T.E.A.M. Television Event And Constantin Film AG Rainbow Home Entertainment AG Media Marketing -

Die Literatur, Die Mut Macht (Boell, Simmel)
Die Literatur, die Mut macht (Boell, Simmel) Azinović, Andrijana Master's thesis / Diplomski rad 2013 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:008670 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-09-26 Repository / Repozitorij: FFOS-repository - Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Diplomski studij njemačkog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja Andrijana Azinović Die Literatur, die Mut macht (Boell, Simmel) Diplomski rad Mentor: prof. dr. sc. Vlado Obad Osijek, 2013. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................................. 1 2. Die Literatur, die Mut macht ............................................................................................................... 3 3. Johannes Mario Simmel ...................................................................................................................... 8 3.1. Biographie .................................................................................................................................... 8 3.2. Das geheime Brot – über das Werk ........................................................................................... -

Neuerwerbungsliste Juli 2019 Film
NEUERWERBUNGSLISTE JULI 2019 FILM Medienempfehlungen der Cinemathek in der Amerika-Gedenkbibliothek © Eva Kietzmann, ZLB Zentral- und Landesbibliothek Berlin Stiftung des öffentlichen Rechts Inhaltsverzeichnis Film 5 Stummfilme 3 Film 7 Fernsehserien 4 Film 10 Tonspielfilme 7 Film 19 Kurzspielfilme 29 Film 20 Animationsfilme 29 Film 27 Animation/Anime Serien 31 Film 30 Experimentalfilme 31 Film 40 Dokumentarfilme 32 Musi Musikdarbietungen/ Musikvideos 33 K 400 Kinderfilme 35 Ju 400 Jugendfilme 36 Sachfilme nach Fachgebiet 38 Seite 2 von 42 Stand vom: 31.07.2019 Neuerwerbungen im Fachbereich Film Film 5 Stummfilme Film 5/69:BD Pioneers: first women filmmakers / Ruth Ann Baldwin [Regie] ; Grace Cunard [Regie] ; Dorothy Davenport [Regie] ; Alice Guy [Re- gie] ; Zora Neale Hurston [Regie] ; Cleo Madison [Regie] ; Frances Marion [Regie] ; Alla Nazimova [Regie] ; Mabel Normand [Regie] ; Ida May Park [Regie] ; Nell Shipman [Regie] ; Lois Weber [Regie] ; Elsie Jane Wilson [Regie] ; Marion E. Wong [Regie]. - Expanded Blu- ray edition. - 2018 Film 5/69 c:DVD Pioneers: first women filmmakers / Ruth Ann Baldwin [Regie] ; Grace Cunard [Regie] ; Dorothy Davenport [Regie] ; Alice Guy [Re- gie] ; Zora Neale Hurston [Regie] ; Cleo Madison [Regie] ; Frances Marion [Regie] ; Alla Nazimova [Regie] ; Mabel Normand [Regie] ; Ida May Park [Regie] ; Nell Shipman [Regie] ; Lois Weber [Regie] ; Elsie Jane Wilson [Regie] ; Marion E. Wong [Regie]. - 2018 Film 5 Czin 2:BD ¬Der¬ Geiger von Florenz / Paul Czinner [Regie] ; Otto Kanturek [Kamera] ; Adolf Schlasy [Kamera] ; Uwe Dierksen [Komponist/in] ; Conrad Veidt [Schauspieler/in] ; Elisabeth Bergner [Schauspie- ler/in] ; Nora Gregor [Schauspieler/in]. - Deluxe edition, restaurier- te Fassung. - 2019 Film 5 Czin 2 ¬Der¬ Geiger von Florenz / Paul Czinner [Regie] ; Otto Kanturek a:DVD [Kamera] ; Adolf Schlasy [Kamera] ; Conrad Veidt [Schauspieler/in] ; Elisabeth Bergner [Schauspieler/in] ; Nora Gregor [Schauspie- ler/in] ; Uwe Dierksen [Komponist/in]. -

Walter-Gensler-Dissertation
Copyright by Christina Cindy Walter-Gensler 2016 The Dissertation Committee for Christina Cindy Walter-Gensler Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Ideologies of Motherhood: Literary Imaginaries and Public Discourses Committee: Katherine Arens, Supervisor Janet Swaffar, Co-Supervisor Sabine Hake Peter Rehberg Heidi Schlipphacke Ideologies of Motherhood: Literary Imaginaries and Public Discourses by Christina Cindy Walter-Gensler, B.B.A.; B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin August 2016 Dedication <To all Rabenmütter, especially my grandmother Franziska, who after WWII was an immoral single mother, and my mother Veronika, who did not give up her work when I was born. These two women have been incredibly inspiring role models and I owe them a lot.> Acknowledgements <I would like to thank Katherine Arens, my intellectual mother, for her continuous support and encouragement. She is the best advisor possible and I cannot express in words how much I owe her. Moreover, I would like to thank Janet Swaffer, not only for sharing her expertise on twentieth-century literature, but also for keeping me calm and focused. I am indebted to Peter Rehberg for his numerous suggestions and food for thought, particularly in terms of the methodological and theoretical framework. Heidi Schlipphacke on the other hand I have to thank for providing me with valuable insights into the origin of bourgeois femininity and for encouraging me to investigate a variety of mass media outlets in addition to novels.