Grm Korrektur2107 1.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The University of Chicago Objects of Veneration
THE UNIVERSITY OF CHICAGO OBJECTS OF VENERATION: MUSIC AND MATERIALITY IN THE COMPOSER-CULTS OF GERMANY AND AUSTRIA, 1870-1930 A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE HUMANITIES IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF MUSIC BY ABIGAIL FINE CHICAGO, ILLINOIS AUGUST 2017 © Copyright Abigail Fine 2017 All rights reserved ii TABLE OF CONTENTS LIST OF MUSICAL EXAMPLES.................................................................. v LIST OF FIGURES.......................................................................................... vi LIST OF TABLES............................................................................................ ix ACKNOWLEDGEMENTS............................................................................. x ABSTRACT....................................................................................................... xiii INTRODUCTION........................................................................................................ 1 CHAPTER 1: Beethoven’s Death and the Physiognomy of Late Style Introduction..................................................................................................... 41 Part I: Material Reception Beethoven’s (Death) Mask............................................................................. 50 The Cult of the Face........................................................................................ 67 Part II: Musical Reception Musical Physiognomies............................................................................... -

Intimacy, Marriage, and Risk in Turn-Of-The-Century Berlin
© 2014 Tyler Carrington LOVE IN THE BIG CITY: INTIMACY, MARRIAGE, AND RISK IN TURN-OF-THE-CENTURY BERLIN BY TYLER CARRINGTON DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2014 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Professor Peter Fritzsche, Chair Professor Harry Liebersohn Professor Mark Micale Professor Mark Steinberg ABSTRACT This dissertation examines the surprising push and pull between tradition and modernity that occurred when men and women living in Europe’s fastest growing city fought off isolation and attempted to find love using self-consciously modern mindsets and technologies. Whether it was the decision to approach a stranger on the streetcar, go dancing with a co-worker, look for a mate in one of the city’s many gay bars, post a newspaper personal ad, or eschew the institution of marriage altogether and opt for a free love union, Berliners of all stripes left the shores of tradition and ventured into the choppy waters of a more individualized kind of love. And while there was much to be gained (as they describe in diaries, short stories, penny novels, and lively newspaper debates), the decision to break with the way “grandfather took grandmother” was risky, not least because these maverick Berliners were testing the boundaries of both middle- class respectability and hegemonic masculinity and femininity. In exploring Berliners’ narratives about their love lives, their metropolis, and their status as men and women, this dissertation argues that, even in a city whose most celebrated trait was its newness, traditional respectability proved remarkably robust. -

Goethe in Chicago
: GOETHE IN CHICAGO BY ROSE J. SEITZ, A.M. Tilden Technical High School, Chicago THxA.T Chicagoans, keenly interested in and busily occupied with the stirring events of Civil-War days, nevertheless did not lose their contact with German literature and their admiration for Goethe reveals itself strikingly in a poem found in the issue of the Chicago Sonntags-Zeituug for December 14, 1862.1 It is entitled Der Erlkonig and cleverly applies the central theme of Goethe's poem to the political affairs of that memorable time. In this poem Abraham Lincoln is the father riding through the night with his child Seward, his secretary of state, in his arms. Jefiferson Davis, tempting Seward with promises of favors from the rich Southland, takes the place of the Erlking, who lures the child in Goethe's poem. Davis, as the Erlking, succeeds in drawing Seward to a compromise and destroying him in the eyes of the people. The poem is as follows Wer reitet so spat durch Xacht und Wind? Es ist Herr Lincoln, der milde gesinnt, Er halt den Seward wohl in dem Arm, Er halt ihn sicher, er halt ihn warm. "Sag", Seward, was birgst du so bang dein Gesicht?" "Siehst unten du den Jefif. Davis nicht? ?" Jefif. Davis mit seinem Rebellenschweif "Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif." "Du lieber Seward, komm' geh" mit mir, Gar viele Dinge versprech' ich dir. Viel Baumwolle wachst in unsrem Land, !" Ich driicke dir A'ieles zum Dank in die Hand "O Lincoln, Lincoln, horst du denn nicht, Was Davis mir so kiihn verspricht?" "Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, !" Die ganze Geschichte ist nichts als Wind "Willst, feiner Kunde, du mit mir geh'n, Der Siiden soil deiner warten schon, Wir fiihren zusammen den festlichen Reih'n, !" L"nd theilen das Land dann zwischen uns Zwei'n '^Sonntags-Ansgabc der Illinois Staats-Zeititng. -

Hochsommer in Berlin – Sprudeln Alle Brunnen? Und Antwort Vom 08
Drucksache 18 / 20 026 Schriftliche Anfrage 18. Wahlperiode Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Stefan Evers (CDU) vom 20. Juni 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 25. Juni 2019) zum Thema: Hochsommer in Berlin – Sprudeln alle Brunnen? und Antwort vom 08. Juli 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. Juli 2019) Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Herrn Abgeordneten Stefan Evers (CDU) über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei - G Sen - A n t w o r t auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/20026 vom 20. Juni 2019 über Hochsommer in Berlin – Sprudeln alle Brunnen Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: Vorbemerkung der Verwaltung: Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständig- keit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner Wasserbetriebe (BWB) zu den Fragen 1, 3 b) und 7 sowie die Bezirke zu den Fragen 1, 3 a), 5, 6 und 7 um Stellungnah- me gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. Sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiederge- geben. Frage 1: Welche öffentlichen Schmuck-Brunnenanlagen in Berlin sind aktuell -
Programm Weimar
Volker Wolter Goethe, Schiller, Heine und all die anderen. Eine literarische Zeitreise durch Weimar 2. Semester der Studienstufe Literarische Studienfahrten nach WEIMAR 14. Juli bis 19. Juli 2016 Liebe Schülerinnen und Schüler, wenn wir im Juli 2016 nach Weimar fahren, nehmen wir den Faden des jetzigen Abitur- jahrganges wieder auf und setzen eine seit vielen Jahren geltende Tradition am Gym- nasium Rahlstedt fort. „Anfangs will der Mensch in die nächste Stadt - dann auf die Uni- versität - dann in eine Residenzstadt von Belang - dann (falls er nur 24 Zeilen geschrie- ben) nach Weimar - und endlich nach Italien oder in den Himmel“, schreibt Jean Paul 17971 und er beschreibt damit eine Stellung dieser um das Jahr 1800 gerade mal 6.000 Einwohner zählenden kleine Stadt, deren Bedeutung bis heute anhält. Weimar steht seit vielen Jahren im unmittelbaren Zusammenhang mit dem im Hambur- ger Bildungsplan für Deutsch ausgewiesenen Semesterakzent „Literatur und Sprache von der Aufklärung bis zur Klassik“. Damit steht Weimar schon mal im Fokus, denn viele der in diesen Epochen relevanten Schriftsteller versammelten sich in Weimar (allen voran: Goethe), oder sie orientierten oder rieben sich zumindest an Weimar: Man kam nicht an diesem Ort nicht vorbei. Es gab in Weimar auch eine großartige Zeit lange vor Goethe, die den Ruf Weimars mit begründete: Von 1708 bis 1717 wohnte Johann Sebastian Bach dort; in seinem Wohn- haus direkt neben dem jetzigen Hotel „Elephant“ kamen seine beiden Söhne Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emmanuel zur Welt. Auf unserem Stadtspaziergang wer- den wir dort vorbeikommen, wo statt seines Hauses nur noch ein schnöder Hotelpark- platz mit Marmortafel an der Umfassungsmauer existiert. -

Denkmäler Im Bezirk Mitte - Berlin.De
Denkmäler im Bezirk Mitte - Berlin.de 440 Ergebnisse gefunden Sortieren nach: Bitte wählen Straße Postleitzahl Künstlername Name des Denkmals Ortsteil Erbaut "Aus dem Wasser Steigender" Garnisonskirchplatz 10178 Sabina Grzimek Mitte 2006 "Der Rufer" Straße des 17. Juni 10557 Gerhard Marcks Tiergarten / Großer Tiergarten 1967/89 "Eiserner Gustav" Potsdamer Str. 58 10785 Gerhard Rommel Tiergarten 1998 "Sämann" Bodestraße 1-3 10178 Constantin Meunier Mitte 1896 "Wir sind das Volk" Alt-Moabit 101 10559 Rolf Biebl Moabit 2009 2 Bären Zoo Berlin 10787 unbekannt Tiergarten / Zoo 1856 2 kleine Faune Turmstr. 22 10559 unbekannt Moabit 3 Figuren "Gesundheit" Schwyzer Str. 6 13349 Unbekannt Wedding Unbekannt 3 Steinskulpturen Potsdamer Str. 50 10785 Ulrich Rückriem Tiergarten unbekannt 4 Abu Markubs Zoo Berlin 10787 Reinhard Dachlauer Tiergarten / Zoo 1990 4 Geierperlhühner Zoo Berlin 10787 Reinhard Dachlauer Tiergarten / Zoo 1990 6 Skulpturen Otto-Dix-Straße 10557 Michael Schoenholtz Moabit 1982 Abschied Alt-Moabit 12A 10559 unbekannt Moabit Adelbert von Chamisso Monbijoupark 10178 Julius Moser Mitte 1888 Adenauer-de Gaulle-Denkmal Tiergartenstraße 35 10785 Chantal de la Chauvinière-Riant Tiergarten 2003 Adolf Bardeleben Charité 10117 Martin Wolff Mitte 1889 Adorant Alte Nazarethkirche 13347 unbekannt Wedding 325 v.Chr./1826 Affenfamilie (Steppenpaviane) Zoo Berlin 10787 Hermann Christlieb Tiergarten / Zoo 1926 Affengruppe Zoo Berlin 10787 Arminius Hasemann Tiergarten / Zoo 1979 Albrecht v. Graefe Schumannstr. 5 10117 Rudolf Siemering Mitte 1882 -

H. C. Andersen's 'Schiller Fairy Tale' and the Post-Romantic Religion Of
H. C. ANDERSEN’S ‘SCHILLER FAIRY TALE’ AND THE POST-ROMANTIC Tale RELIGION OF ART [ HEINRICH DETERING ABSTRACT In his story ‘Den gamle Kirkeklokke’ [‘The Old Church Bell’], Andersen transforms, rein- terprets, and dissolves Schiller’s popular poem ‘Das Lied von der Glocke’ [‘The Song of the Bell’] into prose. Written for the Schiller celebrations in 1859, it re-establishes the Roman- tic cult of the artist under profoundly changed cultural conditions. The article examines Andersen’s complex relationship with the Weimar culture and reveals the hidden autobio- ] graphical patterns in his Schiller narrative. By adopting Schiller’s role for himself and at the same time linking it to the biography of Thorvaldsen, Andersen manages to bridge the only recently developed national gap between Danish and German culture. He simultane- ously arranges the story as a critical commentary on his own Romantic tale ‘Klokken’ (‘The Bell’). Thus, ‘my Schiller fairy tale’ turns out to be a post-Romantic legend that succeeds TRANSLATED BY SABINA FAZLI Wackenroder’s and Tieck’s outdated ‘religion of art’ in a decidedly ‘prosaic’ mode. KEYWORDS Hans Christian Andersen, art religion (Kunstreligion), Schiller reception, Romanti- cism vs Biedermeier, fairy tale postromantic religion of art, Schiller, Hans Christian Andersen. Because of Friedrich Schiller, Hans Christian Andersen even wanted to change the course of a river. On March 29, 1860, his friend Adolph Drewsen recounts: A few days ago, Andersen asked me where Schiller’s city of birth, Marbach, was actually situated, namely, whether it might not perhaps be on the Danube, and when he heard that it was on the Neckar, he wished to know into which river the Neckar flows. -

Denkmalpflege Und Repräsentationskultur in Der DDR. Der Wiederaufbau Der Straße Unter Den Linden 1945 – 1989
Silke Schumacher-Lange Denkmalpflege und Repräsentationskultur in der DDR. Der Wiederaufbau der Straße Unter den Linden 1945 – 1989. Dissertation zur Vorlage im Fachbereich II (Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation) der Universität Hildesheim Für Johannes und Jule 1 Silke Schumacher-Lange Denkmalpflege und Repräsentationskultur in der DDR. Der Wiederaufbau der Straße Unter den Linden 1945 – 1989. Dissertation zur Vorlage im Fachbereich II (Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation) der Universität Hildesheim 2 Gliederung Einleitung: Zielsetzung und Fragestellungen 5 Quellenlage und methodische Grundlagen/ Danke 7 Teil 1: Denkmalpflege in der DDR 11 Teil 2: Repräsentative Denkmalpflege in der DDR am Beispiel der Straße Unter den Linden 64 Abschließende Betrachtung 264 Teil 1: Denkmalpflege in der DDR 11 1. Das Traditionsverständnis in der materialistischen Geschichtsauffassung 12 2. Sozialistische Erbaneignung in der DDR 15 2.1. Sozialistischer Realismus 24 3. Denkmalpflege in der DDR 33 4. Zusammenfassung 62 Teil 2: Repräsentative Denkmalpflege in der DDR am Beispiel der Straße Unter den Linden 64 1. Zur Geschichte der Straße Unter den Linden 65 2. Krieg und Zerstörung in Berlin 75 3. Die Straße Unter den Linden in den Wiederaufbauplänen Berlins 1945-1949 83 4. Der Wiederaufbau der Straße Unter den Linden 97 4.1. Die ersten Nachkriegsjahre 1945 –1949 97 4.1.1. Exkurs: Städtebau in der Sowjetunion am Beispiel der Rekonstruktion Moskaus 119 4.2. Die neue Funktion der Linden: Aufmarschstraße zum politischen Zentrum 131 4.3. Im Kampf um eine neue deutsche Architektur 166 4.4. Der Wettbewerb nach dem V. Parteitag 208 4.5. Das politische Zentrum umringt von preußischer Geschichte 245 3 Abschließende Betrachtung 264 1. -

Sommerspaziergang Des Vfdgb Durch Den Tiergarten Mit Dr. Klaus H. Von Krosigk Am 19.6.2021
Sommerspaziergang des VfdGB durch den Tiergarten mit Dr. Klaus H. von Krosigk am 19.6.2021 Obwohl es sehr heiß war, fanden sich 16 Vereinsmitglieder zum Sommerspaziergang durch den Tiergarten. ein. Beginn des Tiergartenspaziergangs westlich vom Brandenburger Tor Interessierte Zuhörer Sommerspaziergang des VfdGB durch den Tiergarten mit Dr. Klaus H. von Krosigk am 19.6.2021 Goethe Denkmal, alter Bestand, alle zwei Jahre wird das Denkmal denkmalgerecht gereinigt und instand gesetzt, die Handwerker waren gerade dabei Musikerdenkmal ,Hayden.. Sommerspaziergang des VfdGB durch den Tiergarten mit Dr. Klaus H. von Krosigk am 19.6.2021 Mozart, Beethoven Denkmal https://www.berlin.de/senuvk/berlin_tipps/grosser_tiergarten/de/sehenswertes/kunstdenkmale/ musiker_denkmal.shtml Sommerspaziergang des VfdGB durch den Tiergarten mit Dr. Klaus H. von Krosigk am 19.6.2021 Denkmalgruppe Luiseninsel Königin Luise Insel mit Denkmal Sommerspaziergang des VfdGB durch den Tiergarten mit Dr. Klaus H. von Krosigk am 19.6.2021 Ein Gesamtbild der Anlage Das Standbild Friedrich Wilhelm III. https://www.berlin.de/senuvk/berlin_tipps/grosser_tiergarten/de/sehenswertes/kunstdenkmale/ denkmalgruppe_luiseninsel.shtml Sommerspaziergang des VfdGB durch den Tiergarten mit Dr. Klaus H. von Krosigk am 19.6.2021 https://www.berlin.de/senuvk/berlin_tipps/grosser_tiergarten/de/sehenswertes/besondere_parkbereiche/ steppengarten.shtml Sommerspaziergang des VfdGB durch den Tiergarten mit Dr. Klaus H. von Krosigk am 19.6.2021 https://www.berlin.de/senuvk/berlin_tipps/grosser_tiergarten/de/sehenswertes/besondere_parkbereiche/ -

Denkmäler Im Bezirk Mitte - Berlin.De
Denkmäler im Bezirk Mitte - Berlin.de 440 Ergebnisse gefunden Sortieren nach: Bitte wählen Straße Postleitzahl Künstlername Name des Denkmals Ortsteil Erbaut Sinkende Mauer Invalidenpark 10115 Christophe Girot Mitte 1997 Wiedervereinigungsdenkmal Ecke Liesenstr./ Chausseestr. 10115 Hildegard Leest Gesundbrunnen 1962 Geschwister Kopppenplatz 10115 Karl Lemke Mitte 1968 Revolutionstele 1 "Orte der Friedlichen Revolution" Hannoversche Str. 30 10115 Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. Mitte Gedenkstein Sammellager Große Hamburger Str. 27 10115 unbekannt Mitte 1995 Denkmal Jüdische Opfer des Faschismus Große Hamburger Str. 27 10115 Will Lammert Mitte 1957 Robert-Koch-Denkmal Robert-Koch-Platz 10115 Louis Tuaillon Mitte 1916 Emil-Fischer-Denkmal Robert-Koch-Platz 10115 Fritz Klimsch und Erich Scheibe Mitte 1921/52 Bertol Brecht Bertolt-Brecht-Platz 10117 Fritz Cremer Mitte 1988 Reiterstandbild Friedrichs des Großen Unter den Linden 9 10117 Christian Daniel Rauch Mitte 1836 - 1951 Hugenotten-Pelikan Friedrichstr. 131 10117 Michael Klein Mitte 1994 Versunkene Bibliothek Bebelplatz 10117 Micha Ullmann Mitte 1994 - 1995 Claire Waldoff Friedrichstr. 107 10117 Reinhard Jacob Mitte 1986 Wilhelm von Humboldt Unter den Linden 6 10117 Martin Paul Otto Mitte 1882 - 1883 Alexander von Humboldt Unter den Linden 6 10117 Reinhold Begas Mitte 1882 - 1883 Heilige Gertrud Gertraudenbrücke 10117 Rudolf Siemering Mitte 1896 Max Planck Unter den Linden 6 10117 Bernhard Heiliger Mitte 1948 - 1949 Theodor Mommsen Unter den Linden 6 10117 Adolf Brütt Mitte 1905 Hermann -
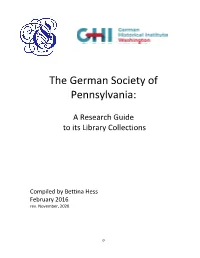
Research Guide to Its Library Collections
& The German Society of Pennsylvania: A Research Guide to its Library Collections Compiled by Bettina Hess February 2016 rev. November, 2020 0 Introduction p. 2 History and Brief Overview of the Collections p. 2 Books Main Collection p. 5 German American Collection p. 9 Carl Schurz Collection p. 30 Reference Collection p. 30 Pamphlets Main Collection p. 31 German American Collection p. 31 cataloged p. 31 uncataloged legal size boxes with call numbers p. 40 legal size boxes without call numbers p. 52 Carl Schurz Collection pamphlet box lists p. 54 Ephemera German American Collection Letter size boxes with call numbers p. 148 Letter size boxes without call numbers p. 163 Legal size boxes without call numbers p. 176 Manuscripts Mss. I Collections with finding aids p. 179 Collections with catalog entries p. 199 collections by size with inventories: Mss. IIa -- Letter size boxes p. 202 Mss. IIb -- Legal size boxes p. 207 Mss. III -- flat boxes (12 x 16 “) p. 210 Mss. IV -- flat boxes (14 x 18 “) p. 215 Mss. Oversize (20 x 24”) p. 219 Mss. Oversize Gallery (24 x 36”) p. 224 Minimally processed manuscript collections p. 228 Newspapers/Periodicals Newspapers on microfilm p. 292 German American imprints -- bound volumes p. 296 German imprints -- bound volumes p. 313 1 Introduction This research guide to the German Society of Pennsylvania’s Joseph Horner Memorial Library is an update to the original guide written by Kevin Ostoyich in 2006 (The German Society of Pennsylvania: A Guide to its Book and Manuscript Collections) and published by the German Historical Institute. -

New Perspectives on German-American Educational History
Overhoff, Jürgen [Hrsg.]; Overbeck, Anne [Hrsg.] New perspectives on German-American educational history. Topics, trends, fields of research Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2017, 235 S. - (Studien zur Deutsch-Amerikanischen Bildungsgeschichte / Studies in German-American Educational History) Empfohlene Zitierung/ Suggested Citation: Overhoff, Jürgen [Hrsg.]; Overbeck, Anne [Hrsg.]: New perspectives on German-American educational history. Topics, trends, fields of research. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2017, 235 S. - (Studien zur Deutsch-Amerikanischen Bildungsgeschichte / Studies in German-American Educational History) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-206941 - http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-206941 in Kooperation mit / in cooperation with: http://www.klinkhardt.de Nutzungsbedingungen Terms of use Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist using this document. ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an of this document does not include any transfer of property rights and it is diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen: conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle retain all copyright information and other information regarding legal Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder distribute or otherwise use the document in public.