Rechtsextremismus in Der Weitlingstraße - Mythos Oder Realität
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

England and Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions >> Irving V
[Home ] [ Databases ] [ World Law ] [Multidatabase Search ] [ Help ] [ Feedback ] England and Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions You are here: BAILII >> Databases >> England and Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions >> Irving v. Penguin Books Limited, Deborah E. Lipstat [2000] EWHC QB 115 (11th April, 2000) URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2000/115.html Cite as: [2000] EWHC QB 115 [New search ] [ Help ] Irving v. Penguin Books Limited, Deborah E. Lipstat [2000] EWHC QB 115 (11th April, 2000) 1996 -I- 1113 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION Before: The Hon. Mr. Justice Gray B E T W E E N: DAVID JOHN CADWELL IRVING Claimant -and- PENGUIN BOOKS LIMITED 1st Defendant DEBORAH E. LIPSTADT 2nd Defendant MR. DAVID IRVING (appered in person). MR. RICHARD RAMPTON QC (instructed by Messrs Davenport Lyons and Mishcon de Reya) appeared on behalf of the first and second Defendants. MISS HEATHER ROGERS (instructed by Messrs Davenport Lyons) appeared on behalf of the first Defendant, Penguin Books Limited. MR ANTHONY JULIUS (instructed by Messrs Mishcon de Reya) appeared on behalf of the second Defendant, Deborah Lipstadt. I direct pursuant to CPR Part 39 P.D. 6.1. that no official shorthand note shall be taken of this judgment and that copies of this version as handed down may be treated as authentic. Mr. Justice Gray 11 April 2000 Index Paragraph I. INTRODUCTION 1.1 A summary of the main issues 1.4 The parties II. THE WORDS COMPLAINED OF AND THEIR MEANING 2.1 The passages complained of 2.6 The issue of identification 2.9 The issue of interpretation or meaning III. -
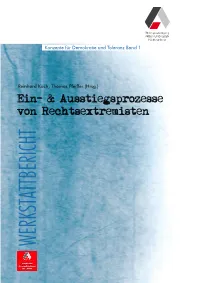
Werkstattbericht
R. Koch, T. Pfeiffer (Hrsg.) | EIN- UND AUSSTIEGSprOZESSE VON RECHTSEXTREMISTEN Reinhard Koch, Reinhard Koch, Konzepte für Konzepte Thomas Pfeiffer(Hrsg.) D emokratie und Toleranz Band1 emokratie undToleranz ARBEIT UNDLEBEN Bildungsvereinigung Niedersachsen WERKSTATTBERICHT Konzepte für Demokratie und Toleranz Band 1 Konzepte für Demokratie und Toleranz Band 1 Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Impressum Verantwortlich: Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Ost gGmbH Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt Bohlweg 55 • 38100 Braunschweig Fon: 0531 1233642, Fax: 0531 1233655 Internet: http://www.arug.de Verantwortlich: Reinhard Koch Redaktion: Anna Balzer | Felix Gerhardt | Reinhard Koch | Benjamin Menzel | Jennifer Pätsch | Thomas Pfeiffer | Mark Poltrock | Grit Thümmel | Monika Zarzycka Layout: ají-grafik Druck: Druckhaus Dresden GmbH Braunschweig, März 2009 Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“. Inhalt Einstiegs- und Ausstiegsprozesse von Rechtsextremisten – ein Werkstattbericht Thomas Pfeiffer ������������������������������������������������������������������������������ 7 Porträtskizzen aus Biografien Stefan Michael Bar – Fluchtpunkt Neonazi Eine Jugend zwischen Rebellion, Hakenkreuz und Knast Anna Balzer und Monika Zarzycka ������������������������������������������������ 17 Jörg Fischer – Ganz rechts. Mein Leben in der DVU Sebastian Wagner ������������������������������������������������������������������������ 23 Nick W. Greger -

Ein Überblick Über Rechte Und Rechtsextreme Strukturen
SS pp ee zz ii aa ll ii tt ää tt ee nn aa uu ss MM ii tt tt ee ll ff rr aa nn kk ee nn Ein Überblick über rechte und rechtsextreme Strukturen antifaschistisches dokumentations- und informationsprojekt 01 Inhaltsverzeichnis 02 Vorwort 03 Einleitung 05 „Rechts angehauchte Jugendliche“ – Ein Interview mit Kurt Gref 07 Panorama 09 Regionalberichte 09 Nürnberg – die fast tausendjährige Stadt 13 Alles bewältigt, nichts begriffen. Über die Funktionalisierung der Geschichte am Beispiel des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände in Nürnberg 15 Tradition hat einen Namen – 1. FC Nürnberg 16 Die Kleeblattstadt Fürth 18 Erlangen – „offen aus Tradition“ 21 Vereinigung der Einzeltäter – Wehrsportgruppe Hoffmann 24 Herzogenaurach: Stiefel in der Turnschuhmetropole 28 Augen zu und durch – Der Landkreis Forchheim 32 Adelsdorf: „Dagestanden, gschaut und nix gmacht“ 34 Latest News 35 „Grüss Gott im Nürnberger Land“ – Rechte Strukturen gestern und heute 37 „Sehr brisant“ – Der Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim 42 Schwabach – „einfach reizvoll“ 44 „Mitten im Romantischen Franken“ – Ansbach 46 „Rassistische Erfahrungen ziehen sich durch mein ganzes Leben“ – Ein Interview mit Elisabeth S. 49 Initiativen gegen Rechts 49 „Unermüdliches Engagement gegen Rechts“ – Das Fürther Bündnis gegen Rassismus und Rechtsextremismus und Radio Bambule 51 Was tun gegen Rechts? Antirassistische und Antifaschistische Gruppen und Organisationen in Mittelfranken 53 Background-Lexikon 53 „White Sound“ in motion - Ein Blick auf die rechtsextreme Musikszene 60 Abschied aus der Subkultur – Über Style und Mode der „Nationalen Jugend“ 61 Codes und Zeichen 65 Rechte Parteien 70 Das schwarz-braune Band der Sympathie- von Anti-PC zu Anti-Antifa 73 Freie Kameradschaften 77 Vertriebenenverbände – Zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus 81 „Los von Rom“ - Der Südtiroler „Freiheitskampf“ 82 Revisionisten und Holocaust-Leugner 84 Esoterik und Irrationalismus 87 Grauzone 90 Neue Deutsche Welle von der Maas bis an den Belt. -

„Rudolf Heß Marsch“ - Kristallisationspunkt Der Militanten Rechten |
„Rudolf Heß Marsch“ - Kristallisationspunkt der militanten Rechten | ... https://www.antifainfoblatt.de/artikel/„rudolf-heß-marsch“-kristallisati... NS-SZENE ANTIFA BRAUNZONE GESELLSCHAFT GESCHICHTE DISKUSSION REPRESSION RASSISMUS Startseite NEUESTE ARTIKEL AIB 115 / 2.2017 | 04.08.201 Frankreich: Neonazi-Mordse aufgedeckt? AIB 115 / 2.2017 | 29.07.201 Arnsdorf: „Zivilcourage“ von AIB 115 / 2.2017 | 25.07.201 Wer sich selbst am nächsten findet rechte Freunde AIB 114 / 1.2017 | 17.07.201 „Wir hatten uns eine solidar Streitkultur erhofft“ AIB 114 / 1.2017 | 14.07.201 „Vorbeugende Verbrechensbekämpfung“ im Nationalsozialismus SUCHEN Neonazi-Versammlung nach dem Tod von Rudolf Heß in West-Berlin. NS-Szene | AIB 19 / 3.1992 | 29.09.1992 „Rudolf Heß Marsch“ - Kristallisationspunkt AKTUELLES HEFT der militanten Rechten Wunsiedel August 1992: Der Todestag von Rudolf Heß jährt sich zum fünften Mal. Die ersten Aufrufe der Neonazis zum »Rudolf-Heß-Marsch 1992« sind im Umlauf und die ersten Vorbereitungstreffen finden statt. Dieses sich alljährlich wiederholende Spektakel entwickelte sich zu einem Kristallisationspunkt der militanten Rechten, bei dem sich mittlerweile die Täter von Hoyerswerda bis Schönau mit immer größeren Kreisen der Schreibtischtäter treffen, um ein »Fanal für Deutschland« auf die Straße zu bringen. Auch die von Anfang an vorhandene internationale Beteiligung stieg seit 1991 sprunghaft an. Wir wollen mit diesen Beitrag die Entwicklung nachzeichnen und die beteiligten Gruppen darstellen. »Rudolf Heß - Märtyrer für Deutschland« ? Als Rudolf Heß am 17. August 1987 als 93jähriger im MEHR ZUM THEMA Gefängnis von Berlin- Spandau starb, war der Mythos vom 1 von 7 06.08.17, 13:18 „Rudolf Heß Marsch“ - Kristallisationspunkt der militanten Rechten | ... https://www.antifainfoblatt.de/artikel/„rudolf-heß-marsch“-kristallisati.. -

Schlussbericht
Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/17740 10.07.2013 2.1 Umfang und Herkunft des Beweis- Schlussbericht materials Seite 19 des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung eines 2.2 Umgang mit Aktenmaterial nach Abschluss möglichen Fehlverhaltens bayerischer Sicherheits- und der Untersuchung Seite 20 Justizbehörden einschließlich der zuständigen Ministeri- en, der Staatskanzlei und der politischen Entscheidungs- 3. Zeugen Seite 20 trägerinnen und Entscheidungsträger 3.1 Zeugenvernehmungen in alphabetischer im Zusammenhang mit der Beobachtung rechtsextremis- Reihenfolge Seite 21 tischer Strukturen und Aktivitäten in Bayern, insbeson- 3.2 Verzicht auf Zeugenvernehmungen Seite 26 dere der Herausbildung der rechtsextremistischen Grup- 3.3 Schriftliche Aussagen Seite 26 pierung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) und 3.4 Öffentlichkeit Seite 27 eventueller Unterstützer in Bayern 4. Sachverständige Seite 27 und der Verfahren zur Ermittlung der Täter der Mord- anschläge vom 9. September 2000 in Nürnberg, 13. Juni 2001 in Nürnberg, 29. August 2001 in München, 9. Juni B. Feststellungen zu den einzelnen Fragen 2005 in Nürnberg und 15. Juni 2005 in München und des Untersuchungsauftrags Seite 27 eventueller weiterer, in Bayern von Rechtsextremisten begangener Straftaten I. Sachverhalt Seite 27 und der hieraus zur Verbesserung der Bekämpfung Fragen Teil A: Rechtsextremistische rechtsextremistischer Strukturen und Aktivitäten und Strukturen und Aktivitäten im Zeitraum zur Optimierung der Ermittlungsverfahren und der Zu- vom 01.01.1994 bis 04.07.2012 in Bayern Seite 28 sammenarbeit der verschiedenen Sicherheits- und Jus- tizbehörden erforderlichen organisatorischen und politi- Fragen Teil B: Mordanschläge in Bayern Seite 80 schen Maßnahmen (Drs. 16/13150) II. Gemeinsame Bewertung aller Mitglieder des Untersuchungsausschusses Seite 132 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1. -

Werkstattbericht
R. Koch, T. Pfeiffer (Hrsg.) | EIN- UND AUSSTIEGSprOZESSE VON RECHTSEXTREMISTEN Reinhard Koch, Reinhard Koch, Konzepte für Konzepte Thomas Pfeiffer(Hrsg.) D emokratie und Toleranz Band1 emokratie undToleranz ARBEIT UNDLEBEN Bildungsvereinigung Niedersachsen WERKSTATTBERICHT Konzepte für Demokratie und Toleranz Band 1 Konzepte für Demokratie und Toleranz Band 1 Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Impressum Verantwortlich: Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Ost gGmbH Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt Bohlweg 55 • 38100 Braunschweig Fon: 0531 1233642, Fax: 0531 1233655 Internet: http://www.arug.de Verantwortlich: Reinhard Koch Redaktion: Anna Balzer | Felix Gerhardt | Reinhard Koch | Benjamin Menzel | Jennifer Pätsch | Thomas Pfeiffer | Mark Poltrock | Grit Thümmel | Monika Zarzycka Layout: ají-grafik Druck: Druckhaus Dresden GmbH Braunschweig, März 2009 Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“. Inhalt Einstiegs- und Ausstiegsprozesse von Rechtsextremisten – ein Werkstattbericht Thomas Pfeiffer ������������������������������������������������������������������������������ 7 Porträtskizzen aus Biografien Stefan Michael Bar – Fluchtpunkt Neonazi Eine Jugend zwischen Rebellion, Hakenkreuz und Knast Anna Balzer und Monika Zarzycka ������������������������������������������������ 17 Jörg Fischer – Ganz rechts. Mein Leben in der DVU Sebastian Wagner ������������������������������������������������������������������������ 23 Nick W. Greger -

ANTISEMITISM TODAY Kenneth S
A N T “All those who are concerned or confused about contemporary I antisemitism will want to read this book. All those who think S E the situation is hopeless need to read this book. And all those M who think there is no problem must read this book.” I T Deborah E. Lipstadt, I Dorot Professor of Modern Jewish S and Holocaust Studies, Emory University M T O “Ken Stern has been out on the front lines of the fight against D antisemitism, and he knows how and where the battles have A been waged. He makes crystal clear what antisemitism is and Y how to devise the best strategy to fight it. And along the way you will meet some fascinating heroes, slackers, and knaves.” Morris Dees, cofounder and chief trial counsel of the Southern Poverty Law Center How It Is the Same, How It Is Different, and How to Fight It K e n n e t h S . S American Jewish Committee t e The Jacob Blaustein Building r n Kenneth S. Stern 165 East 56 Street New York, NY 10022 The American Jewish Committee publishes in these areas: •Hatred and Anti-Semitism •Pluralism •Israel •American Jewish Life •International Jewish Life •Human Rights www.ajc.org December 2006 $10.00 AJC AMERICAN JEWISH COMMITTEE The American Jewish Committee protects the rights and freedoms of Jews the world over; combats bigotry and anti-Semitism and promotes human rights for all; works for the security of Israel and deepened understanding between Americans and Israelis; advocates public policy positions rooted in American democratic values and the perspectives of the Jewish heritage; and enhances the cre- ative vitality of the Jewish people. -

Hakennuss Und Zirbelkreuz Rechtsextremismus in Augsburg (1945 – 2000) Nach Einer Facharbeit Aus Dem Fach Geschichte/Sozialkunde 1999 Am Holbein-Gymnasium/Augsburg
NEUE KRITIK AUS SCHULE UND HOCHSCHULE • HEFT NR. 2 • AUGUST 2001 Hakennuss und Zirbelkreuz Rechtsextremismus in Augsburg (1945 – 2000) Nach einer Facharbeit aus dem Fach Geschichte/Sozialkunde 1999 am Holbein-Gymnasium/Augsburg … Von Gabriel Wetters Tobias Lotter Schriftenreihe des Kurt-Eisner-Vereins für politische Bildung in Bayern e.V. Mit der Reihe Neue Kritik aus Schule und Hochschule bietet der Kurt-Eisner-Verein für Inhalt: Vorwort politische Bildung in Bayern e.V. eine Mög- lichkeit, Arbeiten zu veröffentlichen, die im Zusammenhang der Schul-, Studien- oder Be- So in etwa 10 Stunden sind es noch bis zum Abgabetermin in der Schule. Gabriel rufsausbildung, in der Gewerkschaftsjugend Vorwort 3 und ich sitzen in dem viel zu kleinen Arbeitszimmer, der Computer rattert unauf- oder einem selbstorganisierten Arbeitskreis ent- hörlich, die ganzen letzten Tage schon. Hinter uns liegt ein Monat, in dem wir in standen sind. Die bearbeiteten Themen sollten allgemein interessante Probleme behandeln, die Archiven und Büchern durch die letzten 54 Jahre Regionalgeschichte getaucht sind im weiten Sinn politische Relevanz besitzen. 1. Die Welt durch das rechte Auge – und uns in einem Schnellkurs zu Spezialisten der rechten Szene vor Ort gemacht Mit der Veröffentlichung in dieser Reihe erhal- Versuch einer Definition haben. Gabriel sitzt irgendwo auf den im Zimmer verstreuten Akten und schaut ten die Autorinnen und Autoren die Chance, anhand der ideologischen mich aus übermüdeten Augen an. Nun gilt es aus unseren Schreibergüssen 2 Fach- ihre oft aufwendig recherchierten Positionen ei- Grundlagen des Rechts- arbeiten zu zaubern. Die Kapitel werden auseinandergerissen, für jeden ein wenig nem breiteren Kreis vorzulegen. Für die Lese- rinnen und Leser werden kritische Anstrengun- extremismus 5 Theorie, ein wenig Praktisches. -

1974-1994, Zwanzig Jahre Nazis in Hamburg 2 Vorwort
1974-19941974-1994 2020 Jahre Jahre Neonazis Neonazis inin Hamburg Hamburg 4DM4DM SchülerInnenSchülerInnen 3DM3DM INHALT VORWORT 3 Impressum DIE OFFIZIELLE SICHT 4 WIE ALLES ANFING - NSDAP UND „HANSA BANDE“ 5 Herausgeber: Antifaschistische Gruppe 1974 – NSDAP-Treffen im Haus des Sports mit Christophersen und Lauck 5 „DRUSCHBA NARODNYCH” Die „Hansa Bande“ Michael Kühnens 5 c/o Hamburger Satz- und Die Eselsmasken-Aktion 6 Verlags-Kooperative GmbH Die „Aktionsfront Nationaler Sozialisten“ (ANS) 7 Schulterblatt 58 Frauenpolitik – Fehlanzeige! 7 20 357 Hamburg Der Mord an Johannes Bügner 8 V.i.S.d.P.: Heinrich Eckhoff Erscheinungsdatum: 07.10.1994 CHRISTIAN WORCH - AKTIVIST DER ERSTEN STUNDE 9 2. unveränderte Auflage Rechte Hand von Michael Kühnen 9 Bestellungen an die Im Führungskreis der „Gesinnungsgemeinschaft der neuen Front“ (GDNF) 10 Verlagsadresse Worchs Aktivitäten – eine Chronologie 10 Normalpreis 4DM Organisator des „Aufbauplanes Ost“ und der Heß-Märsche 11 Preis für SchülerInnen 3DM Organisator des Nazi-Terrors („Anti-Antifa“, „Einblick“) 13 plus 1 DM/Heft Porto bei Versand JÜRGEN RIEGER - ANWALT DER BRAUNEN SZENE 14 Aktivist des Neonazismus 14 Anwalt der alten und neuen Nazis 15 Sein Landhaus in der Heide 16 Braune Rechtshilfe 17 DIE FAP 18 Nach Verbot der ANS „Unterschlupf“ der Neonazis 18 Die Freiheitliche Arbeieterpartei Deutschlands (FAP) in Hamburg 18 Das Komitee Adolf Hitler 19 Friedhelm Busse – ein Nazi und Krimineller 20 Die Bundesgeschäftsstelle in Halstenbek und die Brüder Goertz 20 Die Nationale Liste Hamburg 21 Willi -

Medien Einer Neuen Sozialen Bewegung Von Rechts
Medien einer neuen sozialen Bewegung von rechts Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum - Fakultät für Sozialwissenschaft - vorgelegt von Thomas Pfeiffer aus Hüttental (jetzt Siegen) Bochum 2000 gewidmet Ludwig Gehm Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus Medien einer neuen sozialen Bewegung von rechts 3 Inhalt Seite Vorwort 8 1. Einleitung 10 1.1 Gegenstand und Aufbau der Untersuchung 10 1.2 Literatur 12 1.3 Materiallage 16 I. Theoretischer Teil 2. Begriffsbestimmungen 19 2.1 Soziale Bewegungen 19 2.2 Rechtsextremismus 28 3. Diskussion: Eine neue soziale Bewegung von rechts? 39 3.1 Merkmale sozialer Bewegungen 39 3.1.1 Variable Organisations- und Aktionsformen 39 3.1.2 Geringe Rollenspezifikation 42 3.1.3 Mobilisierung 44 3.1.4 Kontinuität 47 3.1.5 Symbolische Integration 49 3.1.6 Sozialer Wandel als Ziel 51 3.2 Merkmale neuer sozialer Bewegungen 52 3.2.1 Geringer Grad organisatorischer Verfestigung, Bürokrati- 52 sierung und Zentralisierung in Verbindung mit Führerfeindlichkeit 3.2.2 Hohe Variabilität der Aktionsformen bei Betonung direkter 53 Aktion 3.2.3 Vielzahl autonomer, aber stark vernetzter Teilbewegungen 54 3.2.4 Abwesenheit einer einheitlichen geschlossenen Ideologie 55 3.2.5 Verortung der Bewegungen auf der Schnittstelle zwischen 55 soziokultureller und politischer Sphäre 3.3 Fazit 57 4. Kommunikationsstrukturen in neuen sozialen Bewegungen 60 4.1 Akteursgruppen 60 4.2 Vernetzung und Gegenöffentlichkeit 62 4.3 Breitenwirkung 66 4.4 Soziale Relais/Scharniere 70 Medien einer neuen sozialen Bewegung von rechts 4 5. Medien der neuen sozialen Bewegungen (Alternativpresse) 74 5.1 Begriff 75 5.2 Professionalisierung 78 5.3 Funktionen 81 5.4 Typologie 84 5.4.1 Bisherige Typologievorschläge 85 5.4.2 aktuelle, nicht aktuelle Medien 86 5.4.3 lokale, regionale, überregionale Medien 87 5.4.4 Printmedien, elektronische Medien, Telekommunikation 87 5.4.5 Ideologieorgane, Zielgruppenorgane, Scharnierorgane 89 5.5 Produzenten 90 5.6 Rezipienten 92 II. -

Karlova Univerzita V Praze
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of International Studies Master thesis 2016 Patrick Hoffmann CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of International Studies Patrick Hoffmann German Foreign Fighters in the Yugoslav Wars Master thesis Prague 2016 Author: Bc. Patrick Hoffmann Supervisor: doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D. Academic Year: 2015/2016 Bibliographic note HOFFMANN, Patrick. German Foreign Fighters in the Yugoslav Wars. 101 p. Master thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institut of International Studies, Supervisor doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D. Abstract The aim of the thesis is to identify those German citizens, who were fighting in the Yugoslav wars, determine their background, actions on the ground and post-war trajectories, as well as suggest probable motivations for joining the combat in the way they did. The thesis raises the question, how these German war volunteers can be best described and if they are somehow specific within their subgroup of predominantly Western anti-Yugoslav foreign fighters. I argue that Nir Arielli, one of the few scholars dealing with the role of Westerners in the conflict, falls short by qualifying them merely as “meaning seekers” and thus overlooks the multitude of political connections and references, first and foremost among the Germans. I will offer a critique by pointing out differences and nuances, especially in origin-based motives, ideological underpinning and perspectives on the conflict. In doing so, I will raise the question of what we do know about the political situation in both Germany and Croatia in the early 1990s, and how each of that might that have facilitated decisions to join combat abroad. -

Personenregister 659
Personenregister 659 Personenregister Aae, Per Lennart 50, 472 Bode, Alexander 105 Aarseth, Ostein (alias Euronymous) 182 Boehm, Max Hildebert 269 Abd Al-Nasser, Jamal 441 Böhm, Michael 265 Achenbach, Ernst 360 Borchert, Siegfried (alias SS-Siggi) 175 Addo, Otto 574 Borghezio, Mario 52 Ahmedinedjad, Mahmud 452, 455f. Bordin, Norman 430, 462 Adorno, Theodor W. 23, 50, 294, 579, 581, 585, Borstel, Dierk 10 606 Bossi, Umberto 529 Adriano, Alberto 362 Brähler, Elmar 69, 234 Alemmanno, Gianni 479 Braun, Stephan 12 Allen, Martin 372 Bräuniger, Eckart 38, 470, 493ff. Almirante, Giorgio 483 Brinkmann, Patrik 114, 465 Althans, Ewald 361 Brodkorb, Mathias 242, 285, 287, 513 Althaus, Dieter 222 Brunner, Frank 626f. Andrejewski, Michael 242 Brunner, Manfred 397 Angelilli, Roberto 480 Buchheit, Frank 13 Antonescu, Ion 469 Buchstein, Hubertus 62 Apfel, Holger 102, 104, 157, 217, 234f., 395, Burwitz, Gudrun 361 410 Busch, Christoph 297 Armstroff, Dörthe 212 Busse, Friedhelm 92, 386, 429 Arzheimer, Kai 550 Butterwegge, Christoph 60 Asamoah, Gerald 203, 574f. Butz, Arthur R. 114, 404 Aschenauer, Rudolf 361 Calderoli, Roberto 480 Backes, Uwe 58 Calladine, Stephen (alias Stigger) 166 Bara, George 469 Castelli, Roberto 480 Bärthel, Christian 392 Cermak, Antonin 473 Bärthel, Klaus 233, 239 Chamenei, Ajatollah Ali 450f. Bauer, Yehuda 584 Chlada, Marvin 196 Beam, Louis Ray 290 Christophersen, Thies 382, 405f. Beckstein, Günther 647 Chung, Carl 14 Beier, Klaus 199 Clausewitz, Carl von 93, 95, 265 Beisicht, Markus 52, 132ff., 136, 141ff., 388ff. Clemens, Björn 125, 391f. Belhadj, Ali 583 Codreanu, Corneliu Zelea 462, 468ff. Belov, Alexander 464 Coja, Ion 470 Benoist, Alain de 24, 26f., 60, 68, 265, 279, 513 Cook, Robin 410 Benz, Wolfgang 12 Berlusconi, Silvio 479f.