Halbtageswanderung Am 28. Januar 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TRANSFER the Steinbeis Magazine
TRANSFER The Steinbeis Magazine Transfer sans frontières Feature Topic: Our International Activities Insights from Steinbeis experts throughout the world Bond or Turing? Steinbeis Swipe!: Digitalization and technology convergence Keeping Warranty Costs Under Control Steinbeis forecasts infrequent failure rates Leading Like Hidden Champions Steinbeis conducts research into more effective leadership 01 | 2016 2 CONTENT Editorial 03 STEINBEIS SWIPE! | Bond or Turing? 04 Digitalization and technology convergence: Are people and technology merging into one entity? Feature Topic: Our International Activities 05 Insights from Steinbeis experts “Companies now face huge challenges in international competition” 06 An interview with Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Norbert Höptner, the Commissioner for Europe of the Baden-Württemberg Ministry of Finance and Economics and Director of Steinbeis-Europa-Zentrum. Managers of the Future: How will they be Educated? 29 Combatting Air Pollution in China – the German Way 08 The 2015 Steinbeis Competence Day Successful market entry thanks to Steinbeis Safe and Sound Indoors 30 Steinbeis Transfer in South Korea 09 Steinbeis experts optimize storm clips used on house roofs Successfully shaping the international transfer Wanted: Effective IT Systems 32 of knowledge and technology Experts test modular software development tool through “Education, Education, Education!” 10 the Steinbeis Network An interview with Prof. Dr. Werner G. Faix, Managing Director Training Spotlight 34 of the School of International Business and Entrepreneurship Welcome to the Steinbeis Network 36 (SIBE) at Steinbeis University Berlin Knowledge and Technology Transfer Made in India 12 The Meeting Turbocharger 37 Steinbeis successfully introduces its model Steinbeis lends a helping hand to software start-up “Risk management isn’t a luxury” 14 Stepping into Asia 38 An interview with Prof. -

Your Direct Route to Lapp Schulze-Delitzsch-Straße
Industriestraße Breitwiesenstraße allgraben W Am B C Your direct route to Lapp Schulze-Delitzsch-Straße A e aß tr -S pp Gewerbestraße D/E/F Handwerkstraße Oskar-La Handwerkstraße A Lapp Holding AG Oskar-Lapp-Straße 2, 70565 Stuttgart Tel. 0711/7838-01, Fax 0711/7838-2640 B U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart Tel. 0711/7838-01, Fax 0711/7838-2640 E-mail: [email protected] C Lapp Service GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 29, 70565 Stuttgart Tel. 0711/7838-01, Fax 0711/7838-6380 E-mail: [email protected] D Lapp Systems GmbH Oskar-Lapp-Straße 5, 70565 Stuttgart Tel. 0711/78 38-04, Fax 0711/78 38-3520 E-mail: [email protected] E Contact Connectors GmbH Oskar-Lapp-Straße 5, 70565 Stuttgart Tel. 0711/78 38-03 F Lapp GmbH Kabelwerke Oskar-Lapp-Straße 5, 70565 Stuttgart Tel. 0711/78 38-02 Heilbronn 831 From A831 Exit S-Leonberg Universität and Stuttgar t B14/Schattenring/ 831 . Hauptstr. Möhringer Landstr. r Stgt.-Zentru m Karlsruhe St . d- Botnang tr Möhringen From A831 S h c d-Sü r Exit o Vaihin en ger S tr. K b S-Vaihingen .- No b ra o lg R al Schock W enrieds S Vaihingen tr. m 8 Vaihingen A Sch ocken riedstr. 81 B14 Indus triestr. Büsnau . Degerloch r St Stuttgart-Universität Ind - Kaltental ustrie d B27 str. ü B -S reitw Stuttgart-Vaihinge n ie rd n sens e tr. Sc No hulze- 831 Del r. llgrab itzsc t h-S Möhringen S tr. Autobahnkreuz Vaihingen Wa h G c Ha ew Stuttgart ndwerkst erbe Am str. -
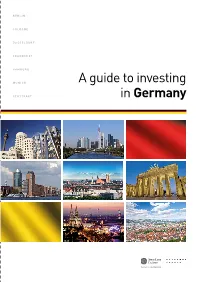
A Guide to Investing in Germany Introduction | 3
BERLIN COLOGNE DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG MUNICH A guide to investing STUTTGART in Germany ísafördur Saudharkrokur Akureyri Borgarnes Keflavik Reykjavik Selfoss ICELAND Egilsstadir A guide to investing in Germany Introduction | 3 BERLIN FINLAND ME TI HT NORWAY IG HELSINKI FL COLOGNE R 2H SWEDEN TALLINN OSLO INTRODUCTION ESTONIA STOCKHOLM IME T T GH LI DUSSELDORF F IN 0M 3 RIGA INVESTING IN GERMANY R 1H LATVIA E FRANKFURT EDINBURGH IM T T LITHUANIA GH DENMARK LI F R COPENHAGEN VILNIUS BELFAST 1H MINSK IRELAND HAMBURG DUBLIN BELARUS IME HT T LIG F IN HAMBURG M 0 UNITED KINGDOM 3 WARSAW Germany is one of the largest Investment Markets in Europe, with an average commercial AMSTERDAM BERLIN KIEV MUNICH NETHERLANDS POLAND transaction volume of more than €25 bn (2007-2012). It is a safe haven for global capital and LONDON BRUSSELS DÜSSELDORF COLOGNE UKRAINE offers investors a stable financial, political and legal environment that is highly attractive to both BELGIUM PRAGUE STUTTGART FRANKFURT CZECH REPUBLIC domestic and international groups. LUXEMBOURG PARIS SLOVAKIA STUTTGART BRATISLAVA VIENNA MUNICH BUDAPEST This brochure provides an introduction to investing in German real estate. Jones Lang LaSalle FRANCE AUSTRIA HUNGARY BERN ROMANIA has 40 years experience in Germany and today has ten offices covering all of the major German SWITZERLAND SLOVENIA markets. Our full-service real estate offering is unrivalled in Germany and we look forward to LJUBLJANA CROATIA BUCHAREST ZAGREB BELGRADE sharing our in-depth market knowledge with you. BOSNIA & HERZEGOVINA SERBIA SARAJEVO BULGARIA ITALY SOFIA PRESTINA KOSOVO Timo Tschammler MSc FRICS SKOPJE HAMBURG MACEDONIA International Director ROME TIRANA MADRID ALBANIA Management Board Germany PORTUGAL Lisboa (Lisbon) SPAIN GREECE Office and Industrial, Jones Lang LaSalle Setúbal ATHENS BERLIN Germany enjoys a thriving, robust and mature real estate market which is one of the DÜSSELDORF cornerstones of the German economy. -

BAYHA by Mrs, Martha a Direct 1972 GENEALOGY Clapp Barrier
BAYHA GENEALOGY By Mrs, Martha Clapp Barrier A Direct Descendent 1972 cAUîi y HISTORY LIBRARY 35 NÖFV1 H WEST TEMPLE SALT LAKE CITY, UTAH 84150 DESDENDENTS OF BLASIUS FREDERICK BAYHA AND JOHANN LUDWIG BAYHA Second and Eighth Sons of JOHN LUDWIG BAYHA (Baiha) Citizen and Working Master Born November 5, 1755 Married May 6, 1?77 Died 26, 1829 In Plieningen, Province of Neckar Kries, Wurtemburg GERMANY and his wife CHRISTINA SIEGLE Born March 4, I76O Died December 22, 1844 Daughter of Lorenz Siegle, Judge and Millowner and Anna Barbara (Schweizer) from the village of Sielmingen Including allied Families of LOEFFLER(Leffier), IMHOFF and PRAGER I972 _1- The following is a list of the American Descendents of JOHANN LUIMIG BAYHA (Baiha) and CHRISTINE (SIEGLE) BAYHA. Of the eleven (ll) children born to them only two of them emigrated to America and the record of their descendents is contained in the following pages. As far as is known the remainder of the family stayed in Germany and their lineage is not given here. The compiler has confined her efforts to the research only of the American descendents of the two children who came to America and settled in Wheeling, West Virginia. The information on the later generations is very incomplete; The compiler has not had the time, financial resource or the advantage of searching all of the records available. All has been done by correspondence as the manuscript will show, and many documents have been obtained from the Ohio County Court in Wheeling, West Virginia. LUDWIG BAYHA, Citizen and Working Master was born in Plieningen, province of Neckar-Kries, near Stuttgart in the Kingdom of Wurtemburg, Germany on November 5» 1?55 and died there on May 26, 1829« He was the son of Ludwig Baiha and Anna (Bauerlih). -

It's Time to Put Energy Issues Front, Center
Vol. 39, No. 17 U.S. Army Garrison Stuttgart September 9, 2010 It’s time to put energy issues front, center Commentary by Lt. Gen. Rick Lynch are outside the Army’s control, the ability to in changing how we do business, the Installation Installation Management Command commander accomplish our mission is open to risk. Management Energy Portfolio is our toolbox. This The Installation Management Campaign Plan, the document, which is also being revised for release in n the past, energy has been a side conversation strategic document directing our actions, includes a October, describes Army programs and initiatives that for the Army. It tended to be an area of section focused on energy efficiency and security; this help installations realize their energy goals. Iconcern for some experts and specialists, but section, Line of Effort 6, was developed in support of One example is metering. Housing units on 45 many of us did not give it much the Army Energy Security Implementation Strategy. Army installations are metered to measure whether thought. The keys to success for LOE 6 focus on reducing the occupants of each unit are using above or below However, with changing energy and water consumption, increasing energy the energy usage baseline every month. Provided security concerns and increased and water efficiency, modernizing infrastructure, with the meter data, occupants have steadily reduced demands on finite financial and developing renewable and alternative energy their energy consumption so that 80 percent now and natural resources, we must supplies. receive money back for using less than the baseline each month. proactively address today’s We have continued to work on LOE 6, in particular refining the keys to success and developing Other programs and initiatives include efforts energy challenges for the sake of Lt. -

Office Market Profile
Office Market Profile Stuttgart | 1st quarter 2020 Published in April 2020 Stutt gart Development of Main Indicators Below-average start to the year At the beginning of the year, the Stuttgart off ice letting market saw its volume of take-up fall by 61% to 33,100 sqm compared to the corresponding period last year. This result is around 57% below the fi ve-year average of fi rst quarters, but the number of deals is similar to that recorded in the same period last year. This is because many large users have already secured space with long lease terms and is also due to the low supply of available larger premises. As a result, the < 500 sqm size category was the most popular, accounting around 41% of the take-up result. On the supply side, all of for around 70% of transactions. The largest transaction was the approx. 5,500 sqm of the off ice space completed in the concluded by the fl exible off ice space provider REGUS with fi rst quarter was already occupied and therefore no new almost 2,800 sqm in the peripheral Leinfelden-Echterdingen off ice space was released onto the market. Despite a slight submarket. With a share of around 34%, the City submarket drop in the volume of vacancies, the vacancy rate remains at recorded the highest volume of take-up and accounted for 2.3% and the prime rent is unchanged at €24.50/sqm/month. around half of all deals. Vaihingen-Möhringen followed with around 23%. The most active demand group by far was business-related service providers who were responsible for Stuttgart: Off ice Space Market Areas with Rental -

Teilbelegung Klein
Weil deine Stadt alles hat. Seien auch Sie mit dabei! Profitieren Sie von unseren Marketingpaketen. Foto: gpointstudio/shutterstock Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Wochenblatt. www.kauf-vor-ort-stuttgart.de INITIATIVE „KAUF VOR ORT“ Innenstadt bedeuten für uns alle ein großes Weil deine Stück Lebensqualität. Damit dieses erhal- Stadt alles ten bleibt, müssen wir uns alle entscheiden: hat“ betont Wollen wir vom Sofa aus im Internet bestel- die Kompe ten zen len? Oder kaufen wir dort ein, wo wir auch des regio nalen Han- leben – und stärken so unsere Region. dels und Dienstleis- tungssektors nicht nur in Mit der Aktion „Kauf vor Ort. Weil deine idealer Art und Weise, sondern Stadt alles hat“ wollen Stuttgarter Zeitung, unterstützt auch andere Marketingmaß- Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter nahmen unserer Städte, Gemeinden und Wochenblatt den heimischen Handel, das Werbe gemeinschaften. Handwerk und den Dienst leistungssektor stärken. Wir sehen uns seit jeher als Partner Gemeinsam mit Ihnen und den Unter- der regionalen Wirtschaft. Partnerschaft nehmen aus unserer Region werden wir bedeutet in meinen Augen, den anderen die Bedeutung und Moderne des lokalen bestmöglich und vor allem nachhaltig zu Handels, Handwerks und Dienstleistungs- unterstützen. Tief greifende Veränderungen sektors in verschiedenen Werbe- und Reich- im Einkaufsverhalten fordern die ortsan- weitenformaten herausstellen. Sehr geehrte Damen und Herren, sässigen Unternehmen heraus. Sie müssen sich etwa gegen die Konkurrenz im Internet unsere Region bietet eine Vielzahl an behaupten. Ihr attraktiven Einkaufsmöglichkeiten. Die Stadt Stuttgart mit Ihren Stadtbezirken Eingehende und kompetente Beratung, und Ihrer Umgebung bietet mehr, als so die Tiefe des Sortiments und nicht zuletzt mancher vermutet: Die Kunden finden die Qualität der angebotenen Produkte und hier ein vielfältiges, inspirierendes Ange- Dienstleistungen – das sind Argumente, bot und viele engagierte Kaufleute. -

Green Roofs: a Resource Manual for Municipal Policy Makers
green Roofs A Resource Manual for Municipal Policy Makers CMHC—Home to Canadians Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) has been Canada's national housing agency for over 60 years. Together with other housing stakeholders, we help ensure that Canada maintains one of the best housing systems in the world.We are committed to helping Canadians access a wide choice of quality, affordable homes, while making vibrant, healthy communities and cities a reality across the country. For more information, visit our website at www.cmhc.ca You can also reach us by phone at 1 800 668-2642 or by fax at 1 800 245-9274. Outside Canada call (613) 748-2003 or fax to (613) 748-2016. Authors Gail Lawlor Beth Anne Currie Hitesh Doshi Ireen Wieditz May 2006 Canada Mortgage and Housing Corporation supports the Government of Canada policy on access to information for people with disabilities. If you wish to obtain this publication in alternative formats, call 1 800 668-2642. Green Roofs: A Resource Manual for Municipal Policy Makers Canada Mortgage and Housing Corporation Green Roofs: A Resource Manual for Municipal Policy Makers Advisory Committee Region Name Contact Information West (B.C.) Dale Mikklesen City of Vancouver (604) 871-6168 [email protected] West (Alta.) Kerry Ross Studio T Design (403) 220-0542 [email protected] West (Man.) Rodney McDonald McDonald and Hardess Sustainability Group Inc. (204) 478-0598 [email protected] Central (Ont.) Karen Moyer City of Waterloo (519) 747-8609 [email protected] Central (Ont.) Jane Welsh City -

2019 Proceedings Book
2019 32ND PROCEEDINGS OF April 10-13 HILTON AUSTIN NEW ORLEANS APRIL 21-24 SHERATON NEW ORLEANS HOTEL 2 Sydney is closer than you think. Follow us for updates vetdermsydney.com Principal Sponsors Major Sponsors 3 TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION ABSTRACTS #detectDex 5 THURSDAY 19 App 5 Resident Abstract Presentations 21 Hotel Map 6 ISVD Sessions 45 Registration Hours 7 Concurrent Session Presentations 63 Exhibit Hall Hours 7 Poster Hours 7 FRIDAY 78 Exhibit Hall Map 7 Original Abstract Presentations 80 Sponsors 8 Clinical Abstract Presentations 99 Exhibitors 9 Scientific Session Presentations 103 Concurrent Session Presentations 105 COMPLETE SCHEDULE Wednesday 10 SATURDAY 118 Thursday 11 Clinical Abstract Presentations 120 Friday 14 Scientific Session Presentations 131 Saturday 16 Concurrent Session Presentations 158 ADVT Sessions 179 ROUNDTABLE SESSIONS POSTERS 184 Thursday 18 Friday 18 Saturday 18 4 Help us Keep Track of Dex! Dex is ready to explore Austin. While we’d love for him to sample some BBQ and jam out on South Sixth Street, we want to make sure he’s not getting into any trouble. Help us keep track of him during the conference. If you spot him make sure to snap a photo and share it on the app using your Instagram account. Remember to tag NAVDF (@navdf) and use the hashtags #detectDex, #NAVDF, and #NAVDF2019. Once your photo is shared, return Dex to his dog house at NAVDF registration and claim your reward! ® APP DOWNLOAD INSTRUCTIONS 1. Search NAVDF in the iTunes or Google Play Store. 2. Tap “Get” or “Install” OR LAPTOP OR OTHER DEVICES Enter https://crowd.cc/2xzru in your browser search bar 5 HOTEL MEETING SPACE 6 REVISION Date:2/7/2019 REGISTRATIONAMERICAN & EXHIBIT ACADEMY OF HALL VETERINARY HOURSBy: MAREESA JOHNSON DERMATOLOGY BOOTH COUNT APRIL 11-13, 2019 Inventory as of 02/07/2019 Dimension Size Qty SqFt 8'x10' 80 49 3,920 HILTON AUSTIN DOWNTOWN - GRAND BALLROOM SALON H - AUSTIN,TX Totals: 49 3,920 REGISTRATION INFORMATION EXHIBIT HALL & POSTERBLDG. -

Stuttgart Dodea School Zones: SY 2019-2020
Stuttgart DoDEA School Zones: SY 2019-2020 March 2020 ALPHABETICALLY Primary towns are in bold-type or (parentheses) Town / City District ZipCode K-5 6-8 9-12 Special Notes: Aich (Aichtal) 72631 SES PMS SHS Aichtal 72631 SES PMS SHS Aidlingen 71134 SES PMS SHS (not Dachtel or Lehenweiler) Aldingen (Remseck/Neckar) 71686 RBES PMS SHS Altdorf (Kreis BB) 71155 SES PMS SHS (not Altdorf / Kreis ES) Asemwald (Stuttgart) 70599 RBES PMS SHS Asperg 71679 RBES PMS SHS Bad Cannstatt (Stgt) 70372 RBES PMS SHS 70374 Beihingen (Freiberg/Neckar) 71691 RBES PMS SHS Bergheim (Stuttgart) 70499 RBES PMS SHS Bernhausen (Filderstadt) 70794 PES PMS SHS Birkach (Stuttgart) 70599 RBES PMS SHS Böblingen 71032 SES PMS SHS 71034 Bonlanden (Filderstadt) 70794 PES PMS SHS Botnang (Stuttgart) 70195 PES PMS SHS Breitenstein (Weil/Schönbuch) 71093 SES BMS SHS Burgholzhof (Stuttgart) 70376 RBES PMS SHS Büsnau (Stuttgart) 70569 PES PMS SHS Dagersheim (Böblingen) 71034 SES PMS SHS Darmsheim (Sindelfingen) 71069 SES PMS SHS Dätzingen ((Grafenau) 71120 SES PMS SHS Degerloch (Stuttgart) 70597 RBES PMS SHS Denkendorf 73770 RBES PMS SHS Dettenhausen 72135 SES PMS SHS Deufringen (Aidlingen) 71134 SES PMS SHS Diezenhalde (Böblingen) 71034 SES PMS SHS Ditzingen 71254 RBES PMS SHS (not Heimerdingen or Schöckingen) Döffingen (Grafenau) 71120 SES PMS SHS Dürrlewang (Stuttgart) 70565 PES PMS SHS Echterdingen (L.E.) 70771 PES PMS SHS Eglosheim (Ludwigsburg) 71634 RBES PMS SHS Ehningen 71139 SES PMS SHS Eichholz (Sindelfingen) 71067 SES PMS SHS Eltingen (Leonberg) 71129 PES PMS SHS -

Welcome to Germany and the University of Hohenheim
Welcome to Germany and the University of Hohenheim Welcome Guide for the international Master programs of the University of Hohenheim Winter Semester 2016/17 DEAR STUDENTS! We hope you will get quickly acquainted with the campus in Hohenheim. To facilitate the first weeks in your new environment we have summarized some important aspects concerning administration and student life for you. If you have any further questions, please feel free to contact us. All the best for your studies and your time in Germany! Staff of the University of Hohenheim INDEX AND CHECKLIST WHAT YOU SHOULD DO: HOW TO DO IT? SEE PAGE… APPLY FOR A DORMITORY ROOM.................................................................. 1 REGISTER AT THE MUNICIPALITY.................................................................. 1 OPEN A BANK ACCOUNT............................................................................. 1 ACTIVATE YOUR BLOCKED BANK ACCOUNT AT DEUTSCHE BANK..................... 2 PAY REGISTRATION FEE............................................................................. 2 GET HEALTH INSURANCE............................................................................ 2 REGISTER AT THE UNIVERSITY.................................................................... 4 SIGN ROOM CONTRACT AND DEDUCTION AUTHORIZATION FOR RENT.…....... 4 GET INTERNET ACCESS AND EMAIL ACCOUNT............................................... 5 APPLY FOR A RESIDENCE PERMIT................................................................ 6 GOOD TO KNOW… LIBRARY........................................................................................................ -

Abholtermine Gelber Sack 2021 Der Firma Schaal + Müller Gmbh & Co
Abholtermine Gelber Sack 2021 der Firma Schaal + Müller GmbH & Co. KG Dezember Abhol- Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Bezirke 2020 tag 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 Frauenkopf, Hedelfingen (ohne Hafen) 14.12. Mo. 04.01. 25.01. 15.02. 08.03. 29.03. 19.04. 10.05. 31.05. 21.06. 12.07. 02.08. 23.08. 13.09. 04.10. 25.10. 15.11. 06.12. 27.12. 17.01. Sillenbuch (mit Riedenberg) Feuerbach, Killesberg, Weißenhof 15.12. Di. 05.01. 26.01. 16.02. 09.03. 30.03. 20.04. 11.05. 01.06. 22.06. 13.07. 03.08. 24.08. 14.09. 05.10. 26.10. 16.11. 07.12. 28.12. 18.01. Möhringen 16.12. Mi. 09.01. 27.01. 17.02. 10.03. 31.03. 21.04. 12.05. 02.06. 23.06. 14.07. 04.08. 25.08. 15.09. 06.10. 27.10. 17.11. 08.12. 29.12. 19.01. Stuttgart-West (ohne Kräherwald, Solitude, 17.12. Do. 07.01. 28.01. 18.02. 11.03. 01.04. 22.04. 15.05. 05.06. 24.06. 15.07. 05.08. 26.08. 16.09. 07.10. 28.10. 18.11. 09.12. 30.12. 20.01. Wildpark) Stammheim, Weilimdorf 18.12. Fr. 08.01. 29.01. 19.02. 12.03. 03.04. 23.04. 14.05. 04.06. 25.06. 16.07. 06.08. 27.08. 17.09. 08.10. 29.10. 19.11.