Psychologische Interpretation. Biographien – Texte – Tests
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ambulatory Assessment: Issues and Perspectives
Ambulatory assessment: Issues and perspectives Chapter (pp. 3 – 20) In: Fahrenberg, J. & Myrtek, M. (Eds.). (1996). Ambulatory Assessment: Computer- assisted Psychological and Psychophysiological Methods in Monitoring and Field Studies. Seattle, WA: Hogrefe and Huber. Jochen Fahrenberg University of Freiburg i. Br., Germany Introduction Ambulatory assessment designates a new orientation in behavioral and psychophysiologi- cal assessment. Since this approach relates to everyday life (“naturalistic” observation), the ecological validity of research findings is claimed and, consequently, a suitability for application. Individual differences in behavior and physiology as well as behavior disorders are investigated in real-life situations where relevant behavior can be much more effec- tively studied than in the artificial environment of laboratory research. Such aims and concepts are not entirely new, but recently developed computer-assisted methods in ambulatory monitoring and field studies constitute a new methodology in psy- chology and psychophysiology. The present research is still primarily concerned with methodological issues and conducting pilot studies to explore the potentialities and limita- tions of ambulatory data acquisition in various domains. However, an increasing number of substantial research findings exist, some of which challenge theoretical positions that were attained based on laboratory observation. Ambulatory assessment originated from a number of previously rather independent re- search orientations with specific objectives: Clinical (bedside) monitoring was introduced as means of continuously observing of a patient’s vital functions, e.g., respiratory and cardiovascular parameters under anesthesia, during intensive care and in perinatal condition. If relevant changes occur, i.e., if certain critical values are exceeded, an alarm is set off. Such monitoring is an essential part of biomedical instrumentation in hospitals. -
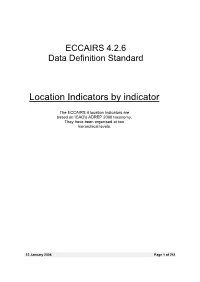
Location Indicators by Indicator
ECCAIRS 4.2.6 Data Definition Standard Location Indicators by indicator The ECCAIRS 4 location indicators are based on ICAO's ADREP 2000 taxonomy. They have been organised at two hierarchical levels. 12 January 2006 Page 1 of 251 ECCAIRS 4 Location Indicators by Indicator Data Definition Standard OAAD OAAD : Amdar 1001 Afghanistan OAAK OAAK : Andkhoi 1002 Afghanistan OAAS OAAS : Asmar 1003 Afghanistan OABG OABG : Baghlan 1004 Afghanistan OABR OABR : Bamar 1005 Afghanistan OABN OABN : Bamyan 1006 Afghanistan OABK OABK : Bandkamalkhan 1007 Afghanistan OABD OABD : Behsood 1008 Afghanistan OABT OABT : Bost 1009 Afghanistan OACC OACC : Chakhcharan 1010 Afghanistan OACB OACB : Charburjak 1011 Afghanistan OADF OADF : Darra-I-Soof 1012 Afghanistan OADZ OADZ : Darwaz 1013 Afghanistan OADD OADD : Dawlatabad 1014 Afghanistan OAOO OAOO : Deshoo 1015 Afghanistan OADV OADV : Devar 1016 Afghanistan OARM OARM : Dilaram 1017 Afghanistan OAEM OAEM : Eshkashem 1018 Afghanistan OAFZ OAFZ : Faizabad 1019 Afghanistan OAFR OAFR : Farah 1020 Afghanistan OAGD OAGD : Gader 1021 Afghanistan OAGZ OAGZ : Gardez 1022 Afghanistan OAGS OAGS : Gasar 1023 Afghanistan OAGA OAGA : Ghaziabad 1024 Afghanistan OAGN OAGN : Ghazni 1025 Afghanistan OAGM OAGM : Ghelmeen 1026 Afghanistan OAGL OAGL : Gulistan 1027 Afghanistan OAHJ OAHJ : Hajigak 1028 Afghanistan OAHE OAHE : Hazrat eman 1029 Afghanistan OAHR OAHR : Herat 1030 Afghanistan OAEQ OAEQ : Islam qala 1031 Afghanistan OAJS OAJS : Jabul saraj 1032 Afghanistan OAJL OAJL : Jalalabad 1033 Afghanistan OAJW OAJW : Jawand 1034 -

Personality HISTORICAL FOUNDATIONS of EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Edited by John A
PERSPECTIVES ON INDIVIDUAL DIFFERENCES CECIL R. REYNOLDS, Texas A&M Universih/, College Station ROBERT T. BROWN, Universih/ of North Carolina, Wilmington DETERMINANTS OF SUBSTANCE ABUSE Biological, Psychological, and Environmental Factors Edited by Mark Galizio and Stephen A. Maisto Personality HISTORICAL FOUNDATIONS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Edited by John A. Glover and Royce R. Ronning Dimensions THE INDIVIDUAL SUBJECT AND SCIENTIFIC PSYCHOLOGY Edited by Jaan Valsiner and Arousal THE NEUROPSYCHOLOGY OF INDIVIDUAL DIFFERENCES A Developmental Perspective Edited by Lawrence C. Hartlage and Cathy F. Telzrow PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES Edited by A Natural Science Approach Hans J. Eysenck and Michael W. Eysenck JAN STRELAU PERSONALITY DIMENSIONS AND AROUSAL University of Warsaw Edited by Jan Strelau and Hans J. Eysenck Warsaw, Poland PERSPECTIVES ON BIAS IN MENTAL TESTING and Edited by Cecil R. Reynolds and Robert T. Brown HANS J. EYSENCK THEORETICAL FOUNDATIONS OF BEHAVIOR THERAPY Institute of Psychiatry Edited by Hans J. Eysenck and Irene Martin University of London London, England A Continuation Order Plan is available for this series. A continuation order will bring delivery of each new volume immediately upon publication. Volumes are billed only upon actual shipment. For further informa- tion please contact the publisher. Plenum Press . New York and London CHAPTER 5 Concepts of Activation and Arousal in the Theory of Emotionality (Neuroticism) A Multivariate Conceptualization JOCHEN FAHRENBERG INTRODUCTION Autonomic arousal and cortical arousal are essential concepts in Ey- senck's theory of personality because individual differences in these functions are related to the well-known dimensions of emotionality (neuroticism) and extraversion-introversion. Psychophysiological per- sonality research has been strongly influenced by these postulates, al- though autonomic and cortical arousal are theoretical constructs that still lack consistent operationalizations. -

Bürgerbote Februar 2019
Bruckmühler Bürger Bote Unabhängig · überparteiliches Marktgemeindeblatt · Jahrgang 27 · Ausgabe Februar 2019 Fotos: Ahrens, Baumann, Grafik: A. Kästner Unsere Öff nungszeiten: Montag – Freitag 6.00 Uhr – 19.30 Uhr Samstag 8.00 Uhr – 18.00 Uhr • Sonntag 9.00 Uhr – 12.30 Uhr Außerhalb der Öff nungszeiten „Tankautomat Betrieb“! NEU NEU NEU NEU NEU NEU Lotto und Zeitschriften gekühlte Getränke – auch Kistenware Morgens frische Brezen und Kaff ee Süßwaren und Chips Honig und Speck aus der Region Tabak/gekühlter Kautabak Autozubehör und Tankgutscheine Hochleistungs-Diesel jetzt bis -30 °C DAUERHAFT GÜNSTIGE SPRITPREISE! Tel. 0 81 04 / 89 81 11 Ayinger Straße 3 • 85649 Faistenhaar Februar 2019 Inhaltsverzeichnis ALLGEMEINE INFORMATIONEN Bauernhofkindergarten ������������������������������������������������������������� 50 Salonmusik mit »Dolce Vita« ��������������������������������������������������� 51 Vorwort �����������������������������������������������������������������������������������������������2 Schnuppertag im Waldkindergarten ����������������������������������� 51 Notrufe������������������������������������������������������������������������������������������������3 Spende aus Mittenkirchen ������������������������������������������������������� 52 Redaktionsschluss BBB Februar ������������������������������������������������3 Spende aus Waith������������������������������������������������������������������������ 52 Impressum �����������������������������������������������������������������������������������������3 Tafel-Team -

Herr Teuber, Was Hat Sie Am Erfolg Von Catanam Meisten
HERBST 2020 • SCHUTZGEBÜHR: 9 EURO Spielspaß ’20 Das Jahrbuch für Spielbegeisterte Es bleibt kein normales Jahr CORONA UND DIE FOLGEN Still sein ist der neue Dialog DIE SPIELETRENDS 2020 2.1 Die Komplett- Ausgabe Herr Teuber, was hat Sie am Erfolg von Catan am meisten überrascht? 25 JAHRE „SIEDELN“ GEBURTSTAGSKINDER: WOLFGANG KRAMER: ROTE LISTE: TIPPS KLASSIKER, DIE ES WERT WAS MICH ZUM SPIELBE- FÜR ALLE SCHNÄPPCHEN- SIND GESPIELT ZU WERDEN GEISTERTEN REIFEN LIESS JÄGER PALEO PREVIEW — Livestream— Sonntag, 18. Oktober 20:00 Uhr SPIEL.digital 22. – 25. OKTOBER 2020 MACHT MIT ! TÄGLICH 12:00 – 22:00 Uhr digitale Spiel.Tische mit Erklärern TÄGLICH 19:00 Uhr Q&A Livestreams TÄGLICH 20:00 Uhr Let’s Play Livestreams mit Special Guests ... sowie Verlosungen, ein Carcassonne Turnier und vieles mehr! RESSORTTITEL Ergänzunge Betitelung Liebe Leserinnen, liebe Leser, HERBST 2020 • SCHUTZGEBÜHR: 9 EURO Spielspaß ’20 Das Jahrbuch für Spielbegeisterte Es bleibt kein normales Jahr CORONA UND DIE FOLGEN Still sein ist der neue Dialog Die Welt steht Kopf seit Mitte März. Lockdown, Homeoffice und geschlossene Gren- DIE SPIELETRENDS 2020 2.0 Die Komplett- zen waren plötzlich die neue Abnormalität. Notgedrungen hielt sich auch der Spiel- Ausgabe Herr Teuber, spaß in Grenzen: Abgesagte Spieleveranstaltungen, kein Zusammenkommen mit was hat Sie am Erfolg von Catan am meisten überrascht? 25 JAHRE „SIEDELN“ GEBURTSTAGSKINDER: WOLFGANG KRAMER: ROTE LISTE: TIPPS Freunden fürs Spielen, zumindest vorübergehend. KLASSIKER, DIE ES WERT WAS MICH ZUM SPIELBE- FÜR ALLE SCHNÄPPCHEN- SIND GESPIELT ZU WERDEN GEISTERTEN REIFEN LIESS JÄGER Das Cover zeigt Klaus Ein „Jahrbuch für Spielbegeisterte“ stellt unter anderem den Anspruch, die Gegen- Teuber, den Autor des wart einzufangen, das Heute in den Kontext mit dem Gestern zu stellen, um mit internationalen Spie- dieser Erkenntnis den Blick in die Zukunft zu richten. -

Bürgerbote Oktober 2019
Bruckmühler Bürger Bote Unabhängig · überparteiliches Marktgemeindeblatt · Jahrgang 27 · Ausgabe Oktober 2019 45 Jahre Partnerschaft Bruckmühl/Bruck a. d. Leitha Fotos: Döringer, W. Fuchs siehe Bericht S. 36 – 38 SONDERPREIS Alle Boxspringbetten reduziert! Zum Beispiel: Boxspringbett BELLADORM® Basic hochwertiger Massivholzrahmen, Bonellfederkern, hochwertiger Taschenfederkern komplett wie Abbildung (ohne Dekoration) nur € 1489,00 verschiedene Kopfteile und viele verschiedene Stoffarten möglich. Innstr. 29 · 83022 Rosenheim · Tel.: 0 80 31 / 38 05 45 · Fax: 38 08 31 [email protected] · www.benedorm.eu BENEDORM® und BELLADORM® trademarks for a perfect sleeping produced in Germany Oktober 2019 Inhaltsverzeichnis ALLGEMEINE INFORMATIONEN »Werkstattbühne« ���������������������������������������������������������������48 – 49 12� Kulturherbst in Feldkirchen-Westerham �����������49 – 50 Vorwort �����������������������������������������������������������������������������������������������2 Vortrag – »Zoff im Kinderzimmer« �������������������������������52 – 53 Notrufe������������������������������������������������������������������������������������������������3 Spende vom Dorffest ����������������������������������������������������������������� 53 Redaktionsschluss BBB November ������������������������������������������3 Neues aus der Waldspielgruppe �����������������������������������53 – 54 Impressum �����������������������������������������������������������������������������������������3 Im Boschenhaus wird viel geboten �������������������������������������� -

Skat-Journal Skat-Journalausgabe 365 Berlin-Brandenburg Landes-Mann- Schaftsmeister- Schaft 19
4/2009 Skat-Journal Skat-JournalAusgabe 365 Berlin-Brandenburg Landes-Mann- schaftsmeister- schaft 19. + 20.09.2009 Neukölln-Pokal der VG 17 04.10.2009 Kreuzberg-Pokal der VG 11 07.11.2009 Offener Nord-West- Pokal der VG 13 15.11.2009 Deutschlands größter Skatreisen-Veranstalter Das Original –- Seit 21 Jahren mit Freunden um die Welt DerDer Skat-Reisedienst Skat-Reisedienst -· Uerz & & Rakers Rakers - An · An der der Böhke Böhke 26 - 3317526 · 33175 Bad Lippspringe Lippspringe TelefonTelefon: 05252-97190 05252-97190 · FaxTelefax: 971910 971910 · [email protected] [email protected] www.skatreise.de· www.skatreise.de Foto: Karin Rechenberg Mit Freunden um die Welt! - Das Original buchen - Mallorca - 18.12.09 - 1.1.2010 ****Riu Bravo Das beliebte Haus liegt in der Inselmetro- pole Palma. Nur 200 Meter vom belebten Strand können Sie jederzeit viel unterneh- men. Langeweile kommt hier nicht auf. Inklusiv Weihnachts- und Silvestergala 999.- ! Gut Rothensiek 23.12.-2.1. o. 23.-28.12. o. 28.-2.1.08 Für gemütliche Festtage auf unserem Gut Rothensiek stehen drei Pakete zur Wahl. Paket 1 mit beiden Festen, Paket 2 nur mit Weihnachten oder Paket 3 nur mit Sil- vester. Mit Programm und Halbpension ab 359.- ! Telefon 05252-97190Uerz & Rakers- Telefax - An05252-971910 der Böhke 26 - [email protected] - 33175 Bad Lippspringe - www.skatreise.de Vereine intern – kurz notiert Der 1. Märkische SC feierte vor kurzer Zeit sein Hans Hinte für die nächsten Jahre alles Gute und 40-jähriges Jubiläum. Der amt. Präsident des weiterhin so viele Erfol ge wie bisher. LV 1, Dieter Galsterer, und der Präsident der VG 13, Der Skatfreundin Melitta Röhle und den Skat- Claus Scheffler, waren bei einem kleinen Preis- freunden Max Jany, Gerd Freiberg und Henry kat vor Ort und übergaben die Ehrengaben. -

Robert Burns in Other Tongues; a Critical
^S *&>• >n BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE SAGE ENDOWMENT FUND THE GIFT OF iii^nrg W. Bags 1S9X .fjr/j.rjf:.. ikp/.v.fj... 9963 Cornell University Library PR4336.J12 Robert Burns in other tongues; a critical 3 1924 013 447 937 M ^ Cornell University VM Library The original of tliis bool< is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924013447937 ROBERT BURNS IN OTHER TONGUES PUBLISHED BY JAMES MACLEHOSE AND SONS. GLASGOW, ^nbUshcrs to the Snibersitji). MACMILLAN AND CO., LONDON AND NEW YORK" Loitdon^ • Sijnpkin, Hamilton and Co. Cainbridge^t Macinillan and Bowes, Edinburgh^ Dotiglas and Foulis. MDCCCXCVI. " , ROBERT BURNS IN OTHER TONGUES A Critical Review of the Translations of the Songs & Poems of Robert Burns i'- ii /; WILLIAM JACKS AUTHOR OF A TRANSLATION OF "NATHAN THE WISE ETC. Glasgow James MacLehose and Sons ^nblisheis to tite Stnibtrsits 1896 Ail rights reserved cc ! Jungst pflUckt' ich einen Wiesenstrauss, Trug ihn gedankenvoll nach Haus ; Da hatten, von der warmen Hand, Die Kronen sich alle zur Erde gewandt, Ich setzte sie in frisches Glas, Und welch ein Wunder war rair das Die Kopfchen hoben sich empor, Die Blatterstengel im grunen Flor, Und allzusammen so gesund, Als stiinden sie noch auf Muttergrund. So war mir's, als ich wundersam Main Lied in fremder Sprache vernahm. Goethe PREFACE. I WAS led into the present, task by seeing now and again in newspapers, reviews of foreign translations of the works of Robert Burns, and by occasionally meeting with specimens of these translations in my wanderings on the Continent. -

Personality Psychology: Lexical Approaches, Assessment Methods, and Trait Concepts Reveal Only Half of the Story—Why It Is Time for a Paradigm Shift
Integr Psych Behav (2013) 47:1–55 DOI 10.1007/s12124-013-9230-6 REGULAR ARTICLE Personality Psychology: Lexical Approaches, Assessment Methods, and Trait Concepts Reveal Only Half of the Story—Why it is Time for a Paradigm Shift Jana Uher Published online: 8 February 2013 # The Author(s) 2013. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract This article develops a comprehensive philosophy-of-science for person- ality psychology that goes far beyond the scope of the lexical approaches, assessment methods, and trait concepts that currently prevail. One of the field’s most important guiding scientific assumptions, the lexical hypothesis, is analysed from meta- theoretical viewpoints to reveal that it explicitly describes two sets of phenomena that must be clearly differentiated: 1) lexical repertoires and the representations that they encode and 2) the kinds of phenomena that are represented. Thus far, personality psychologists largely explored only the former, but have seriously neglected studying the latter. Meta-theoretical analyses of these different kinds of phenomena and their distinct natures, commonalities, differences, and interrelations reveal that personality psychology’s focus on lexical approaches, assessment methods, and trait concepts entails a) erroneous meta-theoretical assumptions about what the phenomena being studied actually are, and thus how they can be analysed and interpreted, b) that contemporary personality psychology is largely based on everyday psychological knowledge, and c) a fundamental circularity in the scientific explanations used in trait psychology. These findings seriously challenge the widespread assumptions about the causal and universal status of the phenomena described by prominent personality models. The current state of knowledge about the lexical hypothesis is reviewed, and implications for personality psychology are discussed. -

Biological Psychology
Biological Psychology Managing Editor: Malcolm Lader Co-Editor: Peter Venables Volume 15,1982 NORTH-HOLLAND PUBLISHING COMPANY AMSTERDAM Biological Psychology 15 (1982) 151-169 151 North-Holland Publishing Company COVARIATION AND CONSISTENCY OF ACTIVATION PARAMETERS Jochen FA HREN BERG and Friedrich FOF.RSTER Freiburg University, D-7800 Freiburg, F.R.G. Accepted for publication 7 June 1982 Individual differences in activation processes, as well as the consistency and predictability of these differences, constitute a classical issue eliciting much theoretical discussion in this field and as such poses an essential question for any practical application of psychophysiological methods. A typical activation experiment assessing 125 male students on four self-report and 21 physiological measures under five conditions (rest, mental arithmetic, interview, anticipation and blood taking) was performed supplying an empirical basis for a multivariate analysis. A partition of covariance, factor analyses, item analyses and scale construction procedures as well as models engaging an increasing number of components were used to study the covariation and consistency of these activation parameters. Several biometric problems that are generally thought to complicate the evaluation of such data (i.e. non-linear relations, the problem of initial values, differing sensibility curves of physiological response systems, individual response specificities) are considered and tested empirically. Findings suggest that the use of a single variable or a composite measure as an 'indicator' of individual differences in state or reaction aspects of activation is inadequate, due to empirical inconsistency and the lack of predictability between functional subsystems. A multicomponent model or a set of marker variables , having empirically derived discriminative efficiency as well as reliability estimates, seem to be preferable. -

Ballesteros-A 1..128
A A ACHIEVEMENT MOTIVATION THE IMPORTANCE OF ACHIEVEMENT part of the motivation process responsible for MOTIVATION the translation of motivation into action is often called the volitional phase in the control Human life can be described as a continuous work of behaviour (Heckhausen, 1989); during this at tasks. Individuals may or may not be successful phase, goal-oriented action turns into outcomes in facing these tasks. The psychology of achieve- controlled by the degree of goal commitment. ment motivation is engaged to run research projects Goal commitment affects the way persons choose aiming at a better understanding of individual to reach their goals and the selection of strategies performance and the nature of human resources they pursue (Brandtsta¨dter & Renner, 1990). as well as at the development of assessment and Examples for such strategies are to pursue intervention techniques to increase achievement a goal persistently even in case of hindrances or motivation. Tasks in industrial settings and in to adapt flexibly to changing aspects of the service organizations become more and more situation. The translation process works better complex and underlie dynamic changes arising when more specific and concrete goals are set, from changing market demands. To keep indivi- the higher the goal commitment the more duals highly achievement motivated while doing effective the chosen strategies of goal pursuit their jobs, tasks have to be designed with high (Vroom, 1964; Locke & Latham, 1990; Kleinbeck, motivating potentials. in press). From a motivational perspective the action A goal-oriented course of action immune to process is divided into two parts. The first part disturbances is especially supported by specific describes the development of achievement motiva- and concrete goals (goal characteristics; tion as a consequence of a fit between the Figure 1). -

The 50 Most Influential Psychologists in the World 1
Taken from : https://thebestschools.org/features/most-influential-psychologists-world/ The Taos Institute’s co-founder and board president, Kenneth J. Gergen, PhD is featured in this article. (#19 on page 30 in alpha oder) ⁂ The 50 Most Influential Psychologists in the World 1. John R. Anderson | Cognitive Psychology Anderson was born in Vancouver, British Columbia, Canada, in 1947. He received his bachelor’s degree from the University of British Columbia in 1968, and his PhD in psychology from Stanford University in 1972. Today, he is Professor of Psychology (with a joint appointment in Computer Science) at Carnegie Mellon University. Anderson is a pioneer in the use of computers to model the “architecture” of the human mind, an approach known as “rational analysis.” He is perhaps best known for his ACT-R (Adaptive Control of Thought-Rational) proposal regarding the hypothetical computational structures underlying human general intelligence. Anderson also engaged in careful experimental studies, using fMRI technology, in an effort to provide empirical support for his theoretical models. Out this work came a number of insights now considered basic to cognitive science, such as, notably, the stage theory of problem-solving (encoding, planning, solving, and response stages), and the decomposition theory of learning (breaking down a problem into more-manageable components, also known as chunking). In his path-breaking early work, Anderson collaborated with Herbert Simon and other giants in the history of cognitive science. In more recent years, he has been involved in the development of intelligent tutoring systems. The author or co-author of over 320 peer-reviewed journal articles and book chapters, and the author, co-author, or editor of six highly influential books, Anderson has received numerous awards, grants, fellowships, lectureships, and honorary degrees.