Von Der Biographie Zum Autobiographischen Brief. Die
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
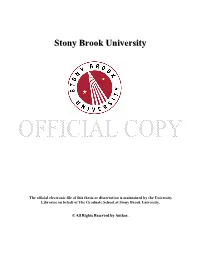
Stony Brook University
SSStttooonnnyyy BBBrrrooooookkk UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy The official electronic file of this thesis or dissertation is maintained by the University Libraries on behalf of The Graduate School at Stony Brook University. ©©© AAAllllll RRRiiiggghhhtttsss RRReeessseeerrrvvveeeddd bbbyyy AAAuuuttthhhooorrr... The Civic Virtue of Women in Quattrocento Florence A Dissertation Presented by Christine Contrada to The Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in History Stony Brook University May 2010 Copyright by Christine Contrada 2010 Stony Brook University The Graduate School Christine Contrada We, the dissertation committee for the above candidate for the Doctor of Philosophy degree, hereby recommend acceptance of this dissertation. Dr. Alix Cooper – Dissertation Advisor Associate Professor, History Dr. Joel Rosenthal – Chairperson of Defense Distinguished Professor Emeritus, History Dr. Gary Marker Professor, History Dr. James Blakeley Assistant Professor, History St. Joseph’s College, New York This dissertation is accepted by the Graduate School. Lawrence Martin Dean of the Graduate School ii Abstract of the Dissertation The Civic Virtue of Women in Quattrocento Florence by Christine Contrada Doctor of Philosophy in History Stony Brook University 2010 Fifteenth century Florence has long been viewed as the epicenter of Renaissance civilization and a cradle of civic humanism. This dissertation seeks to challenge the argument that the cardinal virtues, as described by humanists like Leonardo Bruni and Matteo Palmieri, were models of behavior that only men adhered to. Elite men and women alike embraced the same civic ideals of prudence, justice, fortitude, and temperance. Although they were not feminists advocating for social changes, women like Alessandra Strozzi, Margherita Datini, and Lucrezia Tornabuoni had a great deal of opportunity to actively support their own interests and the interests of their kin within popular cultural models of civic virtue. -

'In the Footsteps of the Ancients'
‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’: THE ORIGINS OF HUMANISM FROM LOVATO TO BRUNI Ronald G. Witt BRILL ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ STUDIES IN MEDIEVAL AND REFORMATION THOUGHT EDITED BY HEIKO A. OBERMAN, Tucson, Arizona IN COOPERATION WITH THOMAS A. BRADY, Jr., Berkeley, California ANDREW C. GOW, Edmonton, Alberta SUSAN C. KARANT-NUNN, Tucson, Arizona JÜRGEN MIETHKE, Heidelberg M. E. H. NICOLETTE MOUT, Leiden ANDREW PETTEGREE, St. Andrews MANFRED SCHULZE, Wuppertal VOLUME LXXIV RONALD G. WITT ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ THE ORIGINS OF HUMANISM FROM LOVATO TO BRUNI BY RONALD G. WITT BRILL LEIDEN • BOSTON • KÖLN 2001 This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Witt, Ronald G. ‘In the footsteps of the ancients’ : the origins of humanism from Lovato to Bruni / by Ronald G. Witt. p. cm. — (Studies in medieval and Reformation thought, ISSN 0585-6914 ; v. 74) Includes bibliographical references and indexes. ISBN 9004113975 (alk. paper) 1. Lovati, Lovato de, d. 1309. 2. Bruni, Leonardo, 1369-1444. 3. Latin literature, Medieval and modern—Italy—History and criticism. 4. Latin literature, Medieval and modern—France—History and criticism. 5. Latin literature, Medieval and modern—Classical influences. 6. Rhetoric, Ancient— Study and teaching—History—To 1500. 7. Humanism in literature. 8. Humanists—France. 9. Humanists—Italy. 10. Italy—Intellectual life 1268-1559. 11. France—Intellectual life—To 1500. PA8045.I6 W58 2000 808’.0945’09023—dc21 00–023546 CIP Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Witt, Ronald G.: ‘In the footsteps of the ancients’ : the origins of humanism from Lovato to Bruni / by Ronald G. -

Prima Parte DEFINITIVA.Qxd
STUDI MEDIEVALI E UMANISTICI XII Direzione VINCENZO FERA (Dir. resp.), PAOLA DE CAPUA, DANIELA GIONTA, CATERINA MALTA, ANTONIO ROLLO Comitato scientifico RINO AVESANI, GUGLIEMO BOTTARI, A. CARLOTTA DIONISOTTI, MICHELE FEO, GIACOMO FERRAÙ, GIUSEPPE FRASSO, JAMES HANKINS, KRISTIAN JENSEN, NICHOLAS MANN, FRANCI- SCO RICO, SILVIA RIZZO, FRANCESCO TATEO Redazione ANTONINO ANTONAZZO, GIOVANNI CASCIO I saggi pervenuti alla Rivista sono affidati alla valutazione di due referees, secondo un proce- dimento rigorosamente anonimo, e in seguito sottoposti al vaglio della Direzione. La Rivista pubblica periodicamente on line (www.cisu.unime.it) i nomi dei referees che hanno collabo- rato alle due annate precedenti. «Studi medievali e umanistici» is a peer-reviewed journal. STUDI MEDIEVALI E UMANISTICI XII 2014 CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI UMANISTICI Il periodico è iscritto al ROC con il numero 16132 dal 26/06/2007 Tutti i diritti riservati © 2014. Università degli Studi di Messina Centro internazionale di studi umanistici (Direttore Prof. Vincenzo Fera) c/o Dipartimento di Civiltà antiche e moderne - Polo dell’Annunziata Università degli Studi, I-98168 Messina Distribuzione: Centro internazionale di studi umanistici <http://www.cisu.unime.it> fax 090 3503899 e-mail: [email protected] Fotocomposizione e stampa: Futura Print Service srl - Messina ISSN 2035-3774 SOMMARIO CATERINA MALTA, Storici e storia nella riflessione petrar- chesca. Il problema del canone 9 MONICA BERTÉ - SILVIA RIZZO,«Valete amici, valete episto- le»: l’ultimo libro delle Senili 71 GIOVANNI CASCIO, Sul destinatario di Sine nomine 14: l’ar- civescovo Arnošt z Pardubic 109 DÁNIEL KISS, Ludovico Regio, Giovanni Luchino Corti and Manilio Cabacio Rallo 125 LUIGI ORLANDI, Baldassar Migliavacca lettore e possessore di codici greci 141 ANTONINO ANTONAZZO, Ecdotica e interpretazione in un di ctamen del giovane Boccaccio (Epist. -

Alessandro Cesareo
1 Alessandro Cesareo L'EPISTOLARIO DI COLUCCIO SALUTATI ED IL CARTEGGIO CON FRANCESCO PETRARCA COME ESEMPIO DI LATINO UMANISTICO: UNA RICERCA FILOLOGICO-LETTERARIA. TESIS DOCTORAL Director: Ángel Sierra De Cózar Codirectora: Michelina Vermicelli FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA MADRID, DICIEMBRE DE 2014 2 INDICE INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES 7 PREAMBOLO 10 CAPITOLO I : COLUCCIO A PETRARCA E SUL PETRARCA: I PROTAGONISTI E LE OPERE. I.1 Un primo profilo di Coluccio Salutati uomo politico e cancelliere. 29 I.2. L'importanza dell’Epistolario del Salutati. 38 I.3. Coluccio Salutati e Francesco Petrarca: alcuni punti di contatto. 53 I.4. Gli autori e le biblioteche. 61 I.5. Petrarca nell’opinione di Coluccio: una prima presentazione. 68 I.6. Alcune scelte politiche di Coluccio. 79 I.7. Un profilo di Francesco Petrarca. 102 I.8. Coluccio e l’ambiente petrarchesco. 119 I.9. Coluccio Salutati tra impegno politico ed amore per gli studia humanitatis. 149 1.10. Alcune considerazioni. 163 CAPITOLO II : INTRODUZIONE AL CARTEGGIO SALUTATI-PETRARCA. II.1.Natura e tipologia dell'Epistolario del Salutati. 169 II. 2. La serie delle Epistulae indirizzate a Francesco Petrarca. 185 II. 3. Coluccio scrive sul Petrarca a: Roberto Guidi, Benvenuto da Imola, Lombardo della Seta, Giovanni Bartolomei, Poggio Bracciolini. 238 CAPITOLO III : IL CARTEGGIO DI SALUTATI AL PETRARCA, E AD ALTRI SUL PETRARCA: TESTO LATINO, TRADUZIONE E NOTE. III. 1. Prima lettera al Petrarca. 269 III. 2. Seconda lettera al Petrarca. 274 III. 3. Terza lettera al Petrarca. 286 III. 4. Quarta lettera al Petrarca. 298 III. 5. Quinta lettera al Petrarca. -

Il Modello Autobiografico Delle Familiares Di Petrarca
Antognini- fronte-396-5 22-12-2008 10:18 Pagina 1 STUDI E RICERCHE Roberta Antognini IL PROGETTO AUTOBIOGRAFICO DELLE FAMILIARES DI PETRARCA ISBN 978-88-7916-396-5 Copyright 2008 Via Cervignano 4 - 20137 Milano Catalogo: www.lededizioni.com - E-mail: [email protected] I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l’inserimento in banche dati) sono riservati per tutti i paesi. _________________________________________________________________________ Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 – 20122 Milano E-mail [email protected] - sito web www.aidro.org __________________________________________________________________________________________ In copertina: Francesco Petrarca, Epistolae familiares (editio princeps), a cura di Sebastiano Manilio Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 13 settembre 1492 (Milano, Biblioteca Ambrosiana, Inc. 604 c. 1r) Diritti Biblioteca Ambrosiana. Vietata la riproduzione. Aut. F 146/08ce Videoimpaginazione e redazione grafica: Claudio Corvino Stampa: Digital Print Service SOMMARIO Premessa 11 1. Fortuna e sfortuna delle ‘Familiares’ 15 1.1. Storia editoriale delle ‘Familiares’ (p. 15) – 1.2. La questione del titolo (p. 18) – 1.3. La critica e le ‘Familiares’ (p. 21) – 1.4. Autobiografi a nel Medioevo? (p. 24) 2. -

Der Petrarkismus – Ein Europäischer Gründungsmythos
Gründungsmythen Europas in Literatur, Musik und Kunst Band 4 herausgegeben von Uwe Baumann, Michael Bernsen und Paul Geyer Michael Bernsen / Bernhard Huss (Hg.) Der Petrarkismus – ein europäischer Gründungsmythos Mit 9 Abbildungen V&R unipress Bonn University Press Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-89971-842-3 ISBN 978-3-86234-842-8 (E-Book) Veröffentlichungen der Bonn University Press erscheinen im Verlag V&R unipress GmbH. 2011, V&R unipress in Göttingen / www.vr-unipress.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages Printed in Germany. Titelbild: Andrea del Sarto: »Dama col Petrarchino«, ca. 1528, Florenz, Galleria degli Uffizi, Wikimedia Commons. Druck und Bindung: CPI Buch Bücher.de GmbH, Birkach Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. Inhalt Vorwort der Herausgeber . ................... 7 Michael Bernsen Der Petrarkismus, eine lingua franca der europäischen Zivilisation . 15 Stefano Jossa Petrarkismus oder Drei Kronen? Die Ursprünge eines Konfliktes . 31 Catharina Busjan Franciscus Petrarca posteritati salutem: Petrarcas Selbstentwurf und sein Widerhall in den Petrarca-Biographien der Frühen Neuzeit . ...... 51 Martina Meidl »Benedetto sia ’l -

Tradurre Petrarca
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Petali Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 12 Biblioteca “Ezio Raimondi” TRADURRE PETRARCA a cura di FRANCESCA FLORIMBII e ANDREA SEVERI Petali 12 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Biblioteca “Ezio Raimondi” TRADURRE PETRARCA a cura di Francesca Florimbii e Andrea Severi 2018 Questo volume raccoglie gli atti del Convegno omonimo organizzato dal Dipartimento Ficlit dell’Università di Bologna il 22 novembre 2016. Comitato scientifico Gian Mario Anselmi, Paola Italia, Giuseppe Ledda, Federica Rossi, Gino Ruozzi, Mercedes López Suárez, Maria Gioia Tavoni Realizzazione editoriale Biblioteca “Ezio Raimondi” del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via Zamboni, 32, 40126 Bologna - Tel. 051-2098558 - Fax 051-2098589 E-mail: [email protected] Politiche editoriali Tutti i contributi presenti in questo volume sono stati selezionati con il metodo della peer review. Prima edizione 2017 ISBN 978-88-98-01076-9 Deposito marzo 2018 I numeri della collana sono disponibili on-line in ALMA-DL AMS Acta: <http://amsacta.unibo.it/view/series/Petali.html> Io tenni sempre la traduzione dover essere come un ritratto. Fu chi disse dover parlare il traduttore come oggi parlerebbe l’autore nella lingua in cui si traduce. A me parve più giusta la sentenza di quelli che dissero doversi sforzare il traduttore a parlare nella sua lingua, come l’autore ch’ei traduce parlò nella sua... Giuseppe Fracassetti Sommario Premessa Francesca Florimbii e Andrea Severi .................................p. 11 «Magna res ac difficilis interpretatio recta». Tradurre Petrarca, tradurre gli umanisti. Esperimenti Donatella Coppini .............................................................. -

Download Download
Downloaded from the Humanities Digital Library http://www.humanities-digital-library.org Open Access books made available by the School of Advanced Study, University of London ***** Publication details: The Afterlife of Apuleius Edited by F. Bistagne, C. Boidin, and R. Mouren https://humanities-digital-library.org/index.php/hdl/catalog/book/afterlife-apuleius DOI: 10.14296/121.9781905670956 ***** This edition published in 2021 by UNIVERSITY OF LONDON SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU, United Kingdom ISBN 978-1-905670-95-6 (PDF edition) This work is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International License. More information regarding CC licenses is available at https://creativecommons.org/licenses THE AFTERLIFE OF APULEIUS EDITED BY F. BISTAGNE, C. BOIDIN, & R. MOUREN INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES SCHOOL OF ADVANCED STUDY UNIVERSITY OF LONDON THE AFTERLIFE OF APULEIUS BULLETIN OF THE INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES SUPPLEMENT 140 DIRECTOR & EDITOR: GREG WOOLF THE AFTERLIFE OF APULEIUS EDITED BY FLORENCE BISTAGNE, CAROLE BOIDIN, AND RAPHAËLE MOUREN INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES SCHOOL OF ADVANCED STUDY UNIVERSITY OF LONDON PRESS 2021 The cover image shows an initial letter from a manuscript in the Vatican Library: Vat. Lat. 2194, p. 65 v. Used with permission. ISBN 978-1-905670-88-8 (paperback) ISBN 978-1-905670-95-6 (PDF) ISBN 978-1-905670-96-3 (epub) © 2021 Institute of Classical Studies, University of London. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. -

Introduction 1
NOTES Introduction 1. For text and discussion of this important letter, see Petrarch, Senile V 2, ed. Monica Berté (Florence: Le Lettere, 1998). Petrarch’s scribe, who attaches the date “August 28,” seems to have dictated it in 1364, but Boccaccio didn’t receive it until 1366. It was one of three letters (Seniles 5.1–3) stolen and kept as souvenirs of their famed author by the messenger charged with their deliv- ery. Petrarch recovered them and asked his trusted friend Donato Albanzani to carry them to their destination. See the commentary by Ugo Dotti in Pe- trarch’s Lettres de la veillesse. Rerum senilium, ed. Elvira Nota (Paris: Les Belles Lettres, 2003), 2:529, n. 42. For the English, see Petrarch, Letters of Old Age. Rerum senilium libri I–XVII, trans. Aldo S. Bernardo, Saul Levin, and Reta A. Bernardo (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992). 2. Petrarch tries to soothe Boccaccio by recalling Seneca, who ranked Cicero second after Virgil among Latin writers, followed by Asinius Pollio, and then Livy. The fl attering implication is that Boccaccio is “one up” on Livy. In an earlier letter to Boccaccio (Familiares 21.15), Petrarch cringes to think of Dante’s plebian public—fullers, tavern keepers, and woolworkers. He acknowledges, however, Dante’s superiority in the vernacular. See Petrarch Familiares 21.15.24 in Le familiari, ed. Vittorio Rossi and Umberto Bosco (Florence: Sansoni, 1926–42), 4:99: “in vulgari eloquio quam carminibus aut prosa clarior atque altior assurgit”; for the translation, Letters on Familiar Mat- ters: Rerum familiarium libri XVII–XXIV, trans. -

Anche Per La Fortuna Del Petrarca, Come Per Quella Di Dante, L'età De- Gli Incunaboli, Dal Al
Verbum VII/I, pp. 185–219 1585-079X/$ 20.00 c Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005 I MERCANTI LETTORI DEL PETRARCA Simona Brambilla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Largo A. Gemelli, 1 I–20123 Milano Italy [email protected] The article is divided into two parts. The first part analyses how, between the 14th and the 16th century, the Italian merchants read the works of Petrarch, paying attention to material aspects, such as ownership, support, mercantesca hand, language and circulation; the study is based on the available catalogues of manuscripts by Petrarch. The second part studies the circulation of Pe- trarch's works among a small group of readers who lived in Florence and Prato (late 14th and early 15th century): the merchant and politician Guido del Palagio, the merchant Francesco Datini, the notary Lapo Mazzei and two churchmen, Giovanni dalle Celle and Luigi Marsili. The paper is based on ma- terial already published as well as research in archives. “Anche per la fortuna del Petrarca, come per quella di Dante, l’età de- gli incunaboli, dal 1470 al 1500, consente di fare uno spedito bilancio. DiYcile oggi sarebbe, sui dati di una tradizione manoscritta che ancora non è stata suYcientemente descritta, nonché studiata, fare un bilan- cio dell’età precedente.” Nel 1974 Carlo Dionisotti apriva così il suo contributo sulla Fortuna del Petrarca nel Quattrocento.¹ A quell'altezza, chi avesse voluto studiare la fortuna di Petrarca basandosi su cataloghi di manoscritti aveva a disposizione pochi, ancorché importanti, strumen- ti, alcuni legati all'anniversario del 1874 (e ai nomi di Enrico Narducci e Giuseppe Valentinelli),² almeno altri due a quello del 1904: il primo ₁ C. -

The Making of the Humanities Focuses on the Early Modern Period
WESTSTEIJN ( BOD, MAAT & This book launches the first comparative his- tory of the humanities. Specialists in philology, eds musicology, art history, linguistics, literary .) RENS BOD, theory, and other disciplines highlight the JAAP MAAT & intertwining of the various fields and their The THIJS WESTSTEIJN impact on the sciences. MAKING (eds.) This first volume in the seriesThe Making of the Humanities focuses on the early modern period. Different perspectives reveal how the humanities developed from the ‘liberal arts’, via the curriculum of humanistic schools, to modern disciplines. The authors show in particular how ofthe discoveries in the humanities contributed to a The MAKING secular world view, pointing up connections HUMANITIES with the ScientificR evolution. of the Contributions come from a selection of inter- nationally renowned European and American scholars, including Floris Cohen, David Cram, HUMANITIES and Ingrid Rowland. The book offers a wealth of insights for specialists, students, and those interested in the humanities in a broad sense. volume i rens bod is professor in Cognitive Systems at i volume Early Modern Europe the University of St Andrews, and Vici-laureate of the Netherlands Organization for Scientific Research at the University of Amsterdam. ModernEarly Europe jaap maat is a lecturer at the Department of Philosophy, University of Amsterdam, and a researcher at the Centre for Linguistics, University of Oxford. thijs weststeijn is a postdoctoral fellow of the Netherlands Organization for Scientific Research, based at the Department of Art History at the University of Amsterdam. 978 90 8964 269 1 · .. amsterdam university press the making of the humanities – vol. i Th e Making of the Humanities Volume 1: Early Modern Europe Edited by Rens Bod, Jaap Maat and Th ijs Weststeijn This book was made possible by the generous support of the J.E. -

East Asia History Sourcebook
Appendix Eta: The T’ang Intellectual Line Connecting brothers of Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University, tracing their fraternal Big Brother/Little Brother line to tri-Founder John Andrew Rea (1869) John Andrew Rea, tri-founder of Phi Kappa Psi at Cornell . . was advised by Andrew Dickson White, President of Cornell . who was mentored by Henry . von Tschirnhaus was a confidante Tappan, president of Michigan of Gottfried Liebniz. University . we then follow Appendix Zeta, . Liebniz traveled the circles of the recording the Sankore line to Immanuel Huygens brothers . Kant, the intellectual forebearor of Henry Tappan . Immanuel Kant’s thesis advisor . Constantin Huygens saloned was Martin Knutzen . with Pieter Hooft . Knutzen’s thesis advisor was Christian . and there is a direct intellectual line von Wolff . from Hooft through the Italian Renaissance and Capetian court to . von Wolff’s thesis advisor was Rabban Bar Sauma, the Beijing-born Ehrenfried von Tschirnhaus. Mongol ambassador to the European princes, who was inspired by the Chinese historian Ch'iu T'ang-shu writing in the 12th century . Below we present short biographies of the T’ang intellectual line of the Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University. “Who defends the House?” Through the intellectual genealogy provided by the mentorship of Andrew Dickson White by Henry Tappan, we arrived, via Appendix Zeta, the Sankoré Line, at the life of Immanuel Kant: Immanuel Kant (22 April 1724 – 12 February 1804) was an 18th-century German philosopher from the Prussian city of Königsberg (now Kaliningrad, Russia). He is regarded as one of the most influential thinkers of modern Europe and of the late Enlightenment.