München Von a Bis Z
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Praktischer Teil
Bahnhöfe. — Gepäckbeförderung. — Dienstmänner. IX Praktischer Teil. Von der Angabe von Preisen wurde in den nachfolgenden Ab- schnitten grundsätzlich Abstand genommen, da diese sich in der heutigen Zeit zu häufig ändern. — Die Zahlen und Buchstaben in den eckigen Klammern bezeichnen die Quadrate des Stadtplans, auf welchen sich die erwähnten Straßen, Gebäude usw. befinden. — Ein alphabetisches Verzeichnis der Straßen befindet sich auf der Rückseite des beiliegenden Stadtplans. Bahnhöfe. Alle Straßenbahnen, deren Wagen an der Stirnseite mit einem roten Querstrich versehene Schilder haben, berühren den Haupt- bahnhof, an den sich der Starnberger und der Holzkirchner Bahnhof anschließen. Zum Isartalbahnhof führen die Straßen- bahnlinien 10 und 30. Hauptbahnhof [E5] S. 123; Kopfstation, die ausschließlich dem großen Fernverkehr dient. — Starnberger Bahnhof [E 5], S. 123, Arnulfstr., an der Nordseite des Hauptbahnhofs, für die Züge nach Starnberg, Murnau, Partenkirchen, Ober- ammergau, Kochel, sowie für den Nahverkehr über Pasing nach Gauting, Grafrath. —Holzkirchner Bahnhof [E 5], Bayerstr., an der Südseite des Hauptbahnhofs, für die Züge nach Holz- kirchen, Bad Tölz, Tegernsee und für den Nahverkehr nach Solln und Großhesselohe. — f sartal-Bahnhof [E 9], Schäftlarnstr., für die Bahn durch das fsartal nach Ebenhausen, Wolfratshausen, Bichl und für den Nahverkehr nach Prinz-Ludwigshöhe, Pullach, Höllriegelsgreuth-Grünwald. — Südbahnhof [Dg] und Ost- bahnhof [L 8], Nebenbahnhöfe für die Rosenheimer und Mühl- dorfer Strecke, gleichzeitig Güterbahnhöfe. Gepäckbeförderung. Zustellung des Reisegepäcks (Expreßdienst) sowie Abfertigung desselben durch das Amtliche Bayerische Reisebureau vorm. Schenker & Co. im Hauptbahnhof, Mittelbau (8—6, So. 9—12 Uhr) und Promenadeplatz 16 [G 5] (8%—6, So. 10—12 Uhr). Dienstmänner und Eilboten. Dienstmannbestellung am Bahnhofplatz 1 (Telegraphenamt), (tägl. -

The Fate of National Socialist Visual Culture: Iconoclasm, Censorship, and Preservation in Germany, 1945–2020
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works School of Arts & Sciences Theses Hunter College Fall 1-5-2021 The Fate of National Socialist Visual Culture: Iconoclasm, Censorship, and Preservation in Germany, 1945–2020 Denali Elizabeth Kemper CUNY Hunter College How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/hc_sas_etds/661 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] The Fate of National Socialist Visual Culture: Iconoclasm, Censorship, and Preservation in Germany, 1945–2020 By Denali Elizabeth Kemper Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History, Hunter College The City University of New York 2020 Thesis sponsor: January 5, 2021____ Emily Braun_________________________ Date Signature January 5, 2021____ Joachim Pissarro______________________ Date Signature Table of Contents Acronyms i List of Illustrations ii Introduction 1 Chapter 1: Points of Reckoning 14 Chapter 2: The Generational Shift 41 Chapter 3: The Return of the Repressed 63 Chapter 4: The Power of Nazi Images 74 Bibliography 93 Illustrations 101 i Acronyms CCP = Central Collecting Points FRG = Federal Republic of Germany, West Germany GDK = Grosse Deutsche Kunstaustellung (Great German Art Exhibitions) GDR = German Democratic Republic, East Germany HDK = Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) MFAA = Monuments, Fine Arts, and Archives Program NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (National Socialist German Worker’s or Nazi Party) SS = Schutzstaffel, a former paramilitary organization in Nazi Germany ii List of Illustrations Figure 1: Anonymous photographer. -
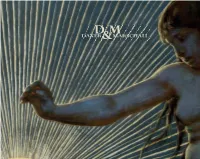
Daxer & Marschall 2015 XXII
Daxer & Marschall 2015 & Daxer Barer Strasse 44 - D-80799 Munich - Germany Tel. +49 89 28 06 40 - Fax +49 89 28 17 57 - Mobile +49 172 890 86 40 [email protected] - www.daxermarschall.com XXII _Daxer_2015_softcover.indd 1-5 11/02/15 09:08 Paintings and Oil Sketches _Daxer_2015_bw.indd 1 10/02/15 14:04 2 _Daxer_2015_bw.indd 2 10/02/15 14:04 Paintings and Oil Sketches, 1600 - 1920 Recent Acquisitions Catalogue XXII, 2015 Barer Strasse 44 I 80799 Munich I Germany Tel. +49 89 28 06 40 I Fax +49 89 28 17 57 I Mob. +49 172 890 86 40 [email protected] I www.daxermarschall.com _Daxer_2015_bw.indd 3 10/02/15 14:04 _Daxer_2015_bw.indd 4 10/02/15 14:04 This catalogue, Paintings and Oil Sketches, Unser diesjähriger Katalog Paintings and Oil Sketches erreicht Sie appears in good time for TEFAF, ‘The pünktlich zur TEFAF, The European Fine Art Fair in Maastricht, European Fine Art Fair’ in Maastricht. TEFAF 12. - 22. März 2015, dem Kunstmarktereignis des Jahres. is the international art-market high point of the year. It runs from 12-22 March 2015. Das diesjährige Angebot ist breit gefächert, mit Werken aus dem 17. bis in das frühe 20. Jahrhundert. Der Katalog führt Ihnen The selection of artworks described in this einen Teil unserer Aktivitäten, quasi in einem repräsentativen catalogue is wide-ranging. It showcases many Querschnitt, vor Augen. Wir freuen uns deshalb auf alle Kunst- different schools and periods, and spans a freunde, die neugierig auf mehr sind, und uns im Internet oder lengthy period from the seventeenth century noch besser in der Galerie besuchen – bequem gelegen zwischen to the early years of the twentieth century. -

Register Der Bauten Und Personen M Ü N C H E N
Register der Bauten und Personen M Ü N C H E N Exkursionsführer München Mai 2013 Technische Universität München Lehrstuhl für Entwerfen und Denkmalpflege Gastprofessor Andreas Hild Konzeption, Redaktion und Gestaltung Christof Bedall Bild- und Text-Zusammenstellung, Recherche und Layout Noemi Orth Alexander Richert Matthias Buchenberg Laura Wollenhaupt Velichka Dyulgerova A Werneck-Schlößchen 108.I Werner, Georg 270.V Akademie 214.II Widmann, Franz Xaver 198.II Allerheiligen-Hofkirche 380.II Wiedemann, Josef 359, 138.I, 184.II, 200.I, Allerheiligen-Kirche am Kreuz mit St. Peter Friedhof 25, 114.I 210.III, 428.I, 428.II, Allianz Hauptverwaltung | ehem. Rhein-Main-Donau AG 268.II 430.I, 430.II, 430.III, Allianz-Generaldirektion 428.I 432.I, 432.II, 436.I, Alte Heide | Arbeitersiedlung 33, 256.II 436.II, 438.I, 438.II, Alte Pinakothek 200.II 438.III, 440.I, 440.II, Alten Akademie | Wiederaufbau 428.II 440.III, 442.I Alten Pinakothek | Wiederaufbau 374 Wilbrechtsturm oder Schäfflertor 142.4 Alter Hof | Finanzamt 22, 48, 66 Wittelsbacherbrunnen 190.II Altersheim 262.II Wittlesbacherbrücke 176.IV Altes Rathhaus 112.II Wohn- und Geschäftshaus | Gebrüder Parcus 238.II Altes und Neues Schloß Schleißheim 124.II Wohnbauten „Neue Südstadt“ 324.III Amalienburg 82.I Wohnblöcke und St. Sebastian 264.V Amerikahaus 384.I Wohnhaus Balthasar Trischberger | Wohnhaus Matthias Widmann 130.III Amerikanisches Generalkonsulat 414.IV Wohnhaus der Brüder Asam 76.I Amtsgebäude des Evangelisch Lutherischen Kirchenrats 252.I Wohnhaus Gunetzrhainer 106.III Anatomie 208.IV Wohnhaus Hans Doellgast 378 Angertor 142.18 Wohnhaus Ignaz Günther 110.III Arco-Palais 198.I Wohnhaus Johann Baptist Straub 102.I Arnhofer d. -

Orientierung Deutsch
DIE PINAKOTHEKEN IM KUNSTAREAL MÜNCHEN Schelling- ORIENTIERUNG straße Bus 154 Bus 154 U H H Universität Arcisstraße H 7/28 2 6 DEUTSCH m U a / 3 NEUE Tr Heßstraße PINAKOTHEK U e ß e MUSEUM REICH a U2 ß r a t e DER KRISTALLE Bus 100 r s t ß n s a e Theresienstraße g i U H H H i l w a sstr i Pinakotheken MUSEUM d m c u A BRANDHORST L Ar TÜRKENTOR e ALTE ß ra PINAKOTHEK PINAKOTHEK t DER MODERNE Gabelsbergerstraße r S re H a e B Bus 100 ß 00 1 ra ÄGYPTISCHES s st LENBACH- n MUSEUM Karolinen- Bu e HAUS platz k H r ü GLYPTOTHEK T NS-DOKU- U U Königsplatz ZENTRUM Brienner S traße H KUNSTBAU STAATL. GRAPH. Odeonsplatz SAMMLUNG 00 STAATLICHE 1 s ANTIKEN- Bu SAMMLUNGEN U4/U5 6 U / 3 U Alter B otanischer 7/28 ALTE PINAKOTHEK Garten 2 m a Täglich außer MO 10.00–18.00 | DI 10.00–20.00 www.pinakothek.de/alte-pinakothek Tr NEUE PINAKOTHEK H S U S U S1–S8 Täglich außer DI 10.00–18.00S U H | MI 10.00–20.00Karlsplatz (Stachus) Marienplatz www.pinakothek.de/neue-pinakothekS1–S8 Hauptbahnhof DB PINAKOTHEK DER MODERNEU2 Täglich außer MO 10.00–18.00 | DO 10.00–20.00 www.pinakothek.de/pinakothek-der-moderne MUSEUM BRANDHORST Täglich außer MO 10.00–18.00 | DO 10.00–20.00 www.museum-brandhorst.de SAMMLUNG SCHACK MI–SO 10.00–18.00 | Jeden 1. und 3. -

Aubrey Cox Professor Marcuse Hist 133A November 14, 2018 Source
Aubrey Cox Professor Marcuse Hist 133A November 14, 2018 Source exploration "Mass Rally in Front of Feldherrnhalle [Field Marshal's Hall] in Munich - Adolf Hitler in the Crowd (August 2, 1914)." GHDI - Image. Accessed November 01, 2018. http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=3736. This source exploration investigates the photograph that supposedly shows Adolf Hitler among a crowd to hear the declaration of war against Russia that sparked the beginning of World War I. Mass Rally in Front of Feldherrnhalle [Field Marshals’ Hall] in Munich – Adolf Hitler in the Crowd. (August 2, 1914). The photograph of a large crowd gathered on the Odeonsplatz, taken 2 by Heinrich Hoffmann, shows Hitler celebrating the start of World War I. The photo is copyrighted Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz/ Heinrich Hoffmann. "Heinrich Hoffmann (photographer)." Wikipedia. September 26, 2018. Accessed November 01, 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hoffmann_(photographer). The Photographer to capture such a historic photograph was a man by the name of Heinrich Hoffmann. Hoffmann (b. 12 Sept. 1885- 15 Dec. 1957) was a photographer and a publicist who published his works in the Nazi party’s weekly magazine the illustrierter Beobachter. Hoffmann trained for years under various photographers learning many aspects of the trade. He met Adolf Hitler in 1919. Hoffmann would later become Hitler’s personal photographer, the only photographer allowed to photograph him and thus a major player in Nazi propaganda. This famous photograph was published on March 12, 1932; just before Hitler’s election to Reich President according to the welt.de article cited further below Google scholar search with terms “Heinrich Hoffmann”, “Odeonsplatz”, and “Hitler” returned the result of the book titled “Germans into Nazis”. -

Der Sinn Fürs Schöne
© Sabine Pollato Muriel Hensch-Coulon Fachbereichsleitung Kultur Der Sinn [email protected] fürs Schöne Erst das Zusammenwirken des Homo faber (des „Werkzeug schaffenden“ Menschen) mit dem Andreas Mayer Homo ludens (dem spielerisch-kreativen in uns) Fachbereichsleitung Beruf EDV, Medien, Bildungsberater bringt alle in uns schlummernden Begabungen und [email protected] Möglichkeiten zum Vorschein und lässt uns dadurch ganz Mensch werden: Homo sapiens eben. Das aus dem Griechischen kommende „téchne“, unser heutiges Wort Technik, wurde ja ursprünglich nicht ohne Bedacht mit „Kunst“ übersetzt. Beratung, Anmeldung, Kursbuchung: Tel. 089 442 389-0 www.vhs-suedost.de [email protected] 53 Kunst- und Kulturfahrten Leistungen: Programmänderungen vorbehalten 3x ÜF im zentralgelegenen Hotel in Amsterdam, Weitere Angaben bzgl. Abfahrt können erst ab Bootsfahrt auf den Grachten, Stadtführung Ams- September 2016 bekannt gegeben werden. terdam, Besichtigung der Porzellanmanufaktur, Veranstalter: Unterwegs zu Kunst und Kultur, Besuch des Reichsmuseums mit Führung, Be- Marianne Werner, Tel.: 089 60150 72 such des Mauritius Museums Die VHS SüdOst tritt nur als Vermittler auf Gesellschaft Bahnfahrt mit dem ICE mit reservierten Plätzen Kunst- und Kulturfahrten Vsl. Abfahrt in München 5:52 Uhr, Ankunft in 23203 Amsterdam 13:27 Uhr Fr – So, ab 25.11. Vorankündigung: Rückfahrt ab Amsterdam: 12:35 Uhr, Ankunft in Treffpunkt: München Hbf Reisen mit Marianne Werner in 2017: München 20:04 Uhr Marianne Werner 350,00 € • Meran – Gardasee – Verona – Mantua (Busreise Reisebegleitung: Marianne Werner im April 2017) Kultur Änderungen im Programmverlauf sind vorbe- Vorweihnachtliches in Augsburg halten. Tagesfahrt zum Engelesspiel und Besuch im „Fugger Tagesfahrt nach Kochel zum Besuch des Die Zeiten für die Bahnfahrt und genaue Preis- und Welser Erlebnismuseum“ Da es bis zum Auftritt Franz-Marc-Museums angaben zu Hotel und Fahrtkosten können erst der Engel noch Zeit ist, besuchen wir vorher noch Am 4. -

Orientation English
ALL PINAKOTHEK MUSEUMS IN THE KUNSTAREAL MÜNCHEN ORIENTATION Schelling- straße Bus 154 Bus 154 U H H Universität Arcisstraße H 7/28 2 ENGLISH 6 m U a / 3 NEUE Tr Heßstraße PINAKOKTHE U e ß e a U2 ß r a Pinakotheken t Bus 100 r s t n s e Theresienstraße g i U H H H i l w a MUSEUM d ALTE m u A PINAKOTHEK BRANDHORST L TÜRKENTOR e ß e a ß PINAKOTHEK DER r a t r S t MODERNE s r s e Gabelsbergerstraße i H r e c a ß 100 B Ar Bus a 0 r t 10 s PALAIS en LENBACH- s s Karolinen- k PINAKOTHEK Bu r HAUS platz ü GLYPTOTHEK H T U U Königsplatz Brienner Straße H KUNSTBAU STAATLICHE Odeonsplatz ANTIKENSAMMLUNGEN 6 U ALTE PINAKOTHEK / 3 Daily except MON 10.00–18.00 | TUE 10.00–20.00 8 U /2 www.pinakothek.de/en/alte-pinakothekAlter B otanischer 7 Garten 2 m a NEUE PINAKOTHEK Tr 8 U Daily except TUE 10.00–18.00 | WED 10.00–20.00 S1–S S Marienplatz www.pinakothek.de/en/neue-pinakothek H S S U H PINAKOTHEK DER MODERNE Karlsplatz (Stachus) S1–S8 Hauptbahnhof DB Daily except MON 10.00–18.00 | THU 10.00–20.00 www.pinakothek.de/en/pinakothek-der-moderne U2 MUSEUM BRANDHORST Daily except MON 10.00–18.00 | THU 10.00–20.00 www.museum-brandhorst.de/en SAMMLUNG SCHACK WED–SUN 10.00–18.00 | Every 1st und 3rd WED in a month 10.00–20.00 www.pinakothek.de/en/sammlung-schack DEAR VISITORS, ALTE PINAKOTHEK We wish you a pleasant visit to the Alte Pinakothek. -

Travelling from the Airport Travelling from the Main Train Station in Munich
Travelling from the airport Towards MPQ in Garching (from the airport): Take the S1 directed to Ostbahnhof and exit at Neufahrn. There you can take Bus No. 690 to Garching Forschungszentrum. (For this option please buy the “outer district” ticket) You could also take the S1 or S8 (big green/white S sign) = direction “Central Station/Marienplatz” to go to Munich. (The S8 is quicker, S1 has more stops; they run every 5- 10 min). At Marienplatz you have to change to the U6 towards Garching Forschungszentrum and exit at the last stop Garching Forschungszentrum. (You’ll have to buy an entire Network ticket for this option.) (If you want to go to the Hotel in Garching see option below) Towards Munich from the airport Take the S1 or S8 (big green/white S sign) = direction “Central Station/Marienplatz”. (The S8 is quicker, S1 has more stops; they run every 5-10 min). Travelling from the main train station in Munich To travel to the MPQ, take the subway U2 (towards Messestadt) to Sendlinger Tor. From there you take the U6 directed to Garching Forschungszentrum to the final destination Garching Forschungszentrum. To travel to the Hotel Hauser from the Main station please take the S1 (direction: München Ost) towards Marienplatz. At Marienplatz change to U6 (direction: Garching Forschungszentrum) and exit at Universität. Ticket Options: If you arrive at the airport and travel to Garching or Munich, please buy a single trip ticket unless you need to go somewhere else on the day of your arrival (LMU and/or MPQ). Then you can purchase a day ticket. -

Lauren Grace Hamer, BA
Copyright by Lauren Grace Hamer 2009 Im Geist der Gegenwart: The Speculative Method of the Art Historian Fritz Burger by Lauren Grace Hamer, B.A. Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts The University of Texas at Austin August 2009 Im Geist der Gegenwart: The Speculative Method of the Art Historian Fritz Burger Approved by Supervising Committee: Richard Shiff Linda Henderson Dedicated to Erandi de Silva Acknowledgements The writing of this thesis would not have been possible without the sage advice and unfailing support of my thesis advisor Dr. Richard Shiff and my second reader Dr. Linda Henderson, both of whom encouraged my pursuit of a difficult methodological subject. I would also like to thank Dr. Kimberly Smith of Southwest Texas State University for calling my attention to Fritz Burger's writings and for giving me my first opportunity to work as a translator of art historical material. To Kenneth McKerrow at the University of Toronto, I owe an immeasurable debt for his friendship and for his translation expertise in the editing of the appendix. At the University of Texas I would like to thank Caitlin Haskell, to whom I am profoundly grateful for her conversation and encouragement. Of course I would also like to thank my terrifically smart parents and my three lovely sisters for supporting my academic work for so many years and for tempering their enthusiasm with just enough doubt to keep me motivated. August 2009 v Im Geist der Gegenwart: the Speculative Method of the Art Historian Fritz Burger Lauren Grace Hamer, M.A. -

Inhalts-Verzeichnis
Inhalts-Verzeichnis. Seite Allgemeines .....' 1-15 Reisegebiet, Landschaftliches, Reisezeit, Reiseausrüstung S. 1. — Gepäck, Reisekosten, Geld, Paßkarte S. 2. — Zoll, Eisenbahnen, Posten, Kraft- und Stellwagen, Führer. Wanderregeln S. 3. — Bitten an die Bergwanderer. Gasthöfe S. 4. — Trinkgelder. Vereine. Literatur S. 5. — Landkarten. Höhenangaben. Entfernungen. Reisepläne S. 6. — Sommerfrischen und Standquartiere S. 7. — Das bayerische Hochland und Allgäu S. 10. — Winter- sport und Winterbesuch im bayerischen Hochland S. 15. 1. München 16-124 Wirtschaftliche' Angaben S. 16. — Kunstgeschichtliches- S. 26. — I. Residenz, Maximilianstraße, Alpines Museum, Schackgalerie, Nationalmuseum S.-31. — n. Theatiner- kirche, Ludwigstraße, Bibliothek, Ludwigskirche, Theater- museum, Pinakotheken, Propyläen, Glyptothek, Lenbach- galerie S. 64. — III. Marienplatz - Frauenkirche - Michaels- kirche-Akademie der Wissenschaften - Friedhöfe S. 111. — IV. Tal - Isartor - Mariahilfkirche - Gärtnerplatz S. 117. — Theresienwiese-Bavaria-Englischer Garten-Tier- park Hellabrunn S. 119. — Umgebung: Isartal-Ra- mersdorf S. 121. — Dachau - Nymphenburg S. 122. — Schleißheim - Fürstenfeld S. 123. — Altötting - Burg- hausen S. 124. 2. Die Isartalbahn von München nach Wolfratshansen 124-127 3. Starnberger See. Von München nach Starnberg . 127-132 4. Ammersee, Peißenberg und Oberammergau 132-138 Von München an den Ammersee S. 132. — Andechs S. 133. — Von München auf den Peißenberg S. 134. — Von München nach Oberammergau. Bad Kohlgrub S. 136. — Ettal S. 137. http://d-nb.info/573869855 VIII • Inhalts -Verzeichnis. Seite 5. Von München über Kochelsee und Walchen- see'nach Mittenwald . '. 138-146 Benediktenwand S. 139^— MUhlberg S. 140. — Schleh- dorf. Heimgarten S. 141. — Herzogstand. Jochberg S. 143. — Vorderriß S. 145. — Sehöttlkarspitze S. 146. 6. Von München nach Garmisch-Partenkirchen und über Mittenwald und Scharnitz nach Innsbruck ^ 146-153 Staffelsee S. -

MÜNCHEN, City Center D a Es the Entry Is Described
Liste der Karteneinträge Map Index Die Seitenzahlen verweisen The numbers behind g n auf die Seite mit der each entry refer to the U S tr. Beschreibung im Buch. page in the book where MÜNCHEN, City Center D A es the entry is described. to V u . r ch r. n e r . s r t t st E.- . H r. t . i r . tr t r s s s k r C s s t h t i D n É t e p st t e S y s l o uc - h - c [O11] Marienplatz S. 58 h s o Toller- t E e es e .- L h r - k S k d S c u R e a e to r l en d es s r t F D z e r b s l F tr r . r. e U r e i n . o t P ge a r n y n s t la t n B y c u r r k s . a u L Pl. t i t e r o r a öw t S . r Bayernplatz u ss i Ê th o t s g - r- str. b t w a - Sa s M s [O11] Viktualienmarkt S. 59 l e g r C w i p i e i M lem l We S g p n s e m t e n i r e s . a Englischer n - e l r n a t i r g o . - u s r r e i S m Ë o t g r r s - Bayer.